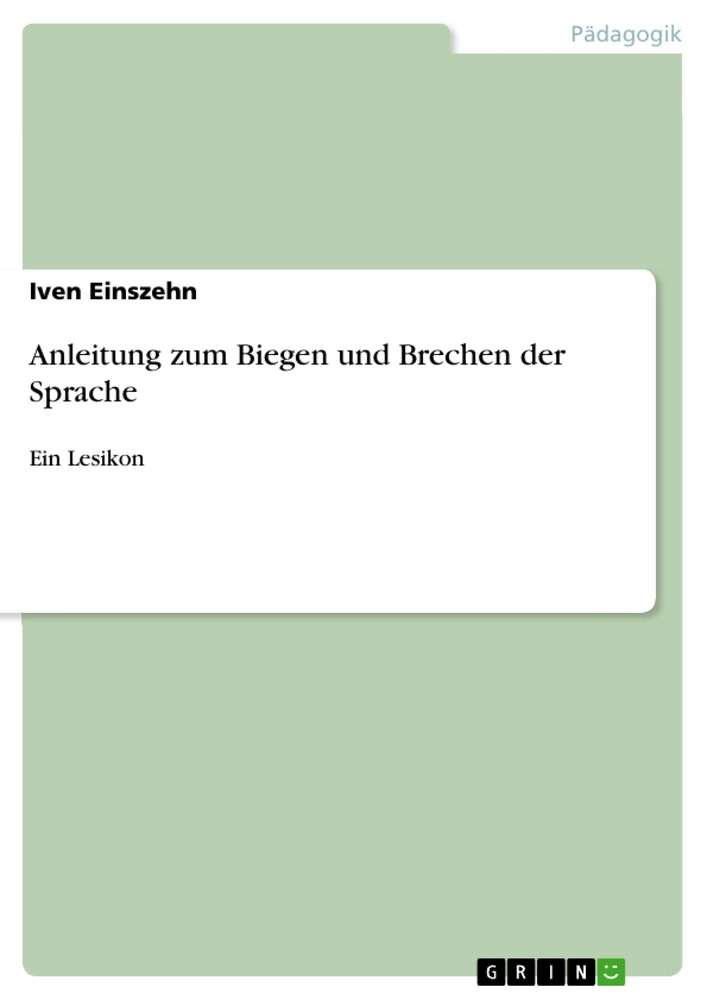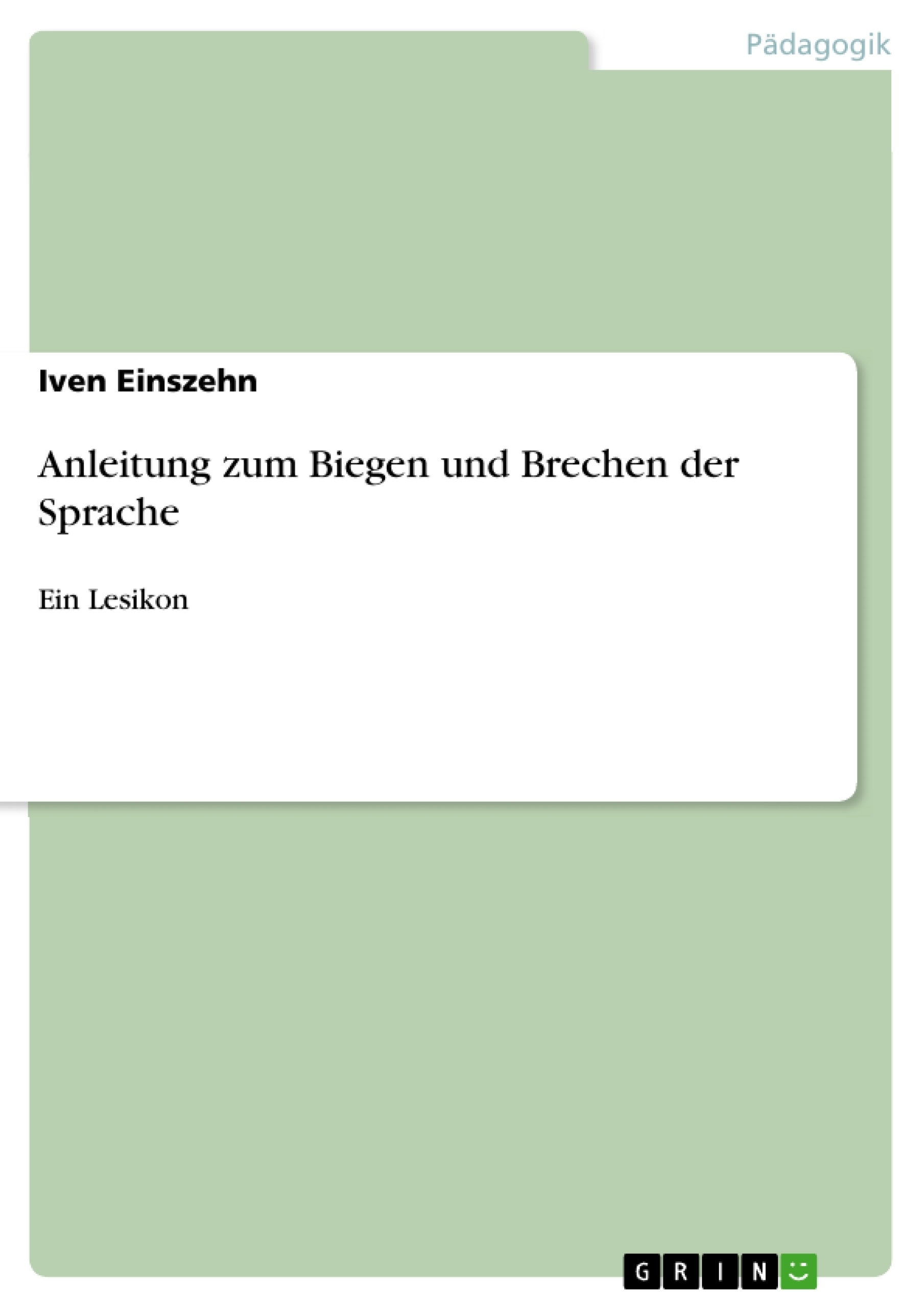Wir unterhalten uns, wir reden miteinander. Daß wir uns dabei verstehen, ist erstaunlich, das sollten wir uns mal bewußt machen: Viele Wörter haben nämlich gar keinen Sinn, bei genauerer Betrachtung, jedenfalls nicht den, den wir kennen. Das fängt in dieser Sammlung gleich mit dem Vorwort an: Ein Wort ist nun wirklich nur ein Wort. Es müßte Vorworte oder Vorwörter heißen.
Mal gibt es Wörter im Überfluß, mal herrscht Mangel. Durch vermeintliche Regelwerke gezogen, dürfte es manches Wort gar nicht geben, jedenfalls nicht so.
Sprache wird gesprochen, nicht gespracht, müßte demnach Sproche heißen – oder Spreche, weil wir sie sprechen. Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe nicht, er nimmt sie entgegen. Der Fernseher sieht nichts, er bildet ab. Der Aschenbecher ist kein Becher, sondern ein Schälchen. Die Kartoffel müßte geschalt werden, nicht geschält, sie hat keine Schäle. In genau 79 Fällen sprechen wir Zahlen numerisch falsch herum. Dem Schluckauf fehlt sein Verb, obwohl man bei diesem Leiden definitiv etwas tut. Rohr und Röhre unterscheiden sich nicht, aber welches Wort ist zuviel?
Solche Beispiele sind hier gesammelt, dabei geht es aber nicht um Besserwissenschaft. Mein Interesse gilt keiner Korrektur. Der Sprache soll nicht zu – vermeintlicher – Genauigkeit ver-holfen werden. Eher soll denen geholfen werden, die auf diese Genauigkeit vertrauen: Es gibt sie nicht. Sprache ist nicht geradlinig und genau. Bücher, von denen wir annehmen, wir hätten sie dort nachzuschlagen, gaukeln uns das bloß vor.
Dabei ist der Begriff Rechtschreibung schon falsch, es gibt nämlich gar kein Recht auf Schreibweisen. Man kann niemanden, der etwas falsch geschrieben hätte, verklagen. Sprache ist gebogen und gebrochen. Und Sprache machen wir uns erst zu eigen, wenn wir sie biegen und brechen. Sprache ist nicht Pflicht, sondern Kür.
Daß die Sache durchaus einen kleinen Haken hat, ist mir bewußt: Man muß die Sprache zunächst einigermaßen gut beherrschen, um dann lustvoll mit ihr richtigfalsch umzugehen. Man muß sehr scharf hinsehen, um dann augenzinkernd vorbeizugucken oder ein Auge zuzudrücken ...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Vorworte
- sprachen
- schreiben
- Vehler/Feler
- Was fehlt dir?
- Was ist dir?
- abern
- Unpech
- Pechwunsch
- Glückwunsch
- begreifstutzig
- Stutz
- Rohr und Röhre
- öftern
- Elter
- erschmerzen
- ein Glück
- bemöbeln
- Demoen
- auf ein Wort
- telefonier mich
- Überfluss & Mangel
- es schnieselt
- Wie spät ist es?
- satt
- Mittwoch
- tausendtausend
- Magma & Lava
- Liebe
- S
- Rechts sprechung
- deutsche Richtigschreibweise
- Glück = Unglück
- entschalen
- z. B. dämlich
- Arbeitsie
- Obst und Gemüse
- Freund und Freund
- halb voll halb leer
- nächste Woche
- Krankheitsamt
- Babyöl
- miteinander schlafen
- Im Namen des Volkes
- Teelicht
- Was gefällt (wird).
- elf zwölf
- Aschenbecher
- kalter Atmer
- Zeitangaben
- echt Gold
- (k)einen (schlechten) Geschmack
- - zimmer
- – und -
- Leserichtungen
- Zwillinge
- Deckel und -?
- Schwarz und Weiß
- rückwärts denken
- Brannt und Brand
- löffeln, messern, gabeln.
- Teller und Tassen
- der Tag
- altlich
- nachdenken
- Un 1
- Un 2
- Sinn
- Geschwist
- ?
- ungemeint
- Sprachverständnis
- Fragewörter
- der Mann und der Junge
- geradewärts
- Un-/Rechtsbewusstsein
- Was macht der Artikel da?
- Wörter zusammennageln
- Anspruchsvölle
- Kompliment und kompliziert
- Lüger
- hochzeiten
- Anrufentgegennehmer
- spülen und waschen_
- hicks
- vom Krebsen
- Fragen - bogen_
- Uhrzeit
- in der Späte
- Waisen & ?
- - logik
- auf Immerwiedersehen
- spenden und spendieren
- irgend -
- der Indik
- der Ohnemensch
- es dringt
- Begatt (in)
- Klebe(r).
- Verwechslungen
- eins
- die schlaue 1
- Fernseher & Fernhörer
- der Zugeschlossene.
- es orkant
- hockern und sesseln und
- Knaben und ?
- unentschlossene Art_
- Konsequenz
- Vielleichtigkeit
- der Anderländer
- halbe Stunden
- notizieren
- sieb -
- in Zahlen
- Asphaltauto
- Brüder und Schwestern
- aum
- die Ältern
- das Schrumpftum
- Nachworte
- Iven Einszehn
- Letzte Veröffentlichungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Lexikon-Lesikon, "Anleitung zum Biegen und Brechen der Sprache", bietet eine einzigartige Perspektive auf die deutsche Sprache und ihre Eigenheiten. Es strebt danach, die sprachlichen Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten und Spielarten aufzuzeigen und somit ein tiefes Verständnis für die Komplexität der deutschen Sprache zu fördern.
- Sprachliche Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten
- Die Vielfältigkeit der deutschen Sprache und ihre Eigenheiten
- Die Bedeutung von Kontext und Interpretation in der Sprache
- Die Rolle von Wortbildung und Wortbedeutung in der Kommunikation
- Die Grenzen zwischen Korrektheit und Kreativität in der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort stellt das Lexikon-Lesikon vor und skizziert seine Intentionen und Zielsetzungen. Es verdeutlicht die Bedeutung der Sprache als lebendiges und formbares Medium.
- Vorworte: Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Sprache und ihre Bedeutung, etwa die Rolle von Sprache als Werkzeug des Denkens und der Kommunikation.
- sprachen: Der Abschnitt "sprachen" analysiert die spezifischen Eigenheiten der deutschen Sprache im Vergleich zu anderen Sprachen. Hierbei werden Unterschiede in Grammatik, Wortschatz und Syntax beleuchtet.
- schreiben: In diesem Kapitel werden Schreibfehler und ihre Entstehung thematisiert. Es wird auf die Bedeutung von Rechtschreibung und Grammatik für eine präzise Kommunikation eingegangen.
- Vehler/Feler: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Arten von Fehlern in der Sprache und deren Ursachen. Es behandelt Themen wie Rechtschreibfehler, Grammatikfehler und Ausdrucksfehler.
- Was fehlt dir?: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Bedeutung von fehlenden Wörtern und deren Einfluss auf die Bedeutung eines Satzes oder Textes.
- Was ist dir?: In diesem Kapitel werden verschiedene Arten von sprachlichen Missverständnissen und deren Ursachen analysiert. Es beleuchtet die Bedeutung von Präzision in der Sprache.
- abern: Dieses Kapitel untersucht den Gebrauch von Konjunktionen und deren Bedeutung für den Satzbau und die Argumentation.
- Unpech: Der Abschnitt "Unpech" beleuchtet den sprachlichen Ausdruck von Pech und Unglück und seine Bedeutung für die Kommunikation.
- Pechwunsch: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung von "Pechwünschen" und ihrer Rolle im sprachlichen Ausdruck von Emotionen.
- Glückwunsch: In diesem Kapitel werden Glückwünsche und ihre Bedeutung in der deutschen Kultur und Sprache analysiert.
- begreifstutzig: Der Abschnitt "begreifstutzig" untersucht die Bedeutung des Wortes "begreifstutzig" und seine Verwendung im Kontext von sprachlicher Unverständlichkeit.
- Stutz: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Stutz" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Rohr und Röhre: Dieser Abschnitt behandelt die Verwendung der Wörter "Rohr" und "Röhre" und ihre Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- öftern: In diesem Kapitel wird der Gebrauch des Wortes "öftern" und seine Bedeutung im Kontext von Häufigkeit und Wiederholung analysiert.
- Elter: Der Abschnitt "Elter" untersucht die Bedeutung des Wortes "Elter" und seine Verwendung in der Sprache.
- erschmerzen: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "erschmerzen" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- ein Glück: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung des Ausdrucks "ein Glück" und seine Verwendung im Kontext von Glück und Zufriedenheit.
- bemöbeln: In diesem Kapitel wird der Gebrauch des Wortes "bemöbeln" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur analysiert.
- Demoen: Der Abschnitt "Demoen" untersucht die Bedeutung des Wortes "Demoen" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- auf ein Wort: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "auf ein Wort" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- telefonier mich: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "telefonier mich" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Überfluss & Mangel: In diesem Kapitel werden die Konzepte von Überfluss und Mangel im Kontext von Sprache und Kultur analysiert.
- es schnieselt: Der Abschnitt "es schnieselt" untersucht die Bedeutung des Wortes "schnieselt" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Wie spät ist es?: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Frage "Wie spät ist es?" und ihre Rolle in der deutschen Sprache.
- satt: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "satt" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Mittwoch: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Mittwoch" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- tausendtausend: Der Abschnitt "tausendtausend" untersucht die Bedeutung des Wortes "tausendtausend" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Magma & Lava: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung der Wörter "Magma" und "Lava" und ihre Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Liebe: Dieser Abschnitt beleuchtet den Ausdruck "Liebe" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- S: In diesem Kapitel wird der Buchstabe "S" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Rechts sprechung: Der Abschnitt "Rechts sprechung" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "Rechts sprechung" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- deutsche Richtigschreibweise: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Rechtschreibung und ihre Bedeutung für eine präzise Kommunikation.
- Glück = Unglück: Dieser Abschnitt beleuchtet das Verhältnis zwischen Glück und Unglück im Kontext von Sprache und Kultur.
- entschalen: In diesem Kapitel wird der Gebrauch des Wortes "entschalen" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur analysiert.
- z. B. dämlich: Der Abschnitt "z. B. dämlich" untersucht die Verwendung des Ausdrucks "z. B. dämlich" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Arbeitsie: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Arbeitsie" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Obst und Gemüse: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Wörter "Obst" und "Gemüse" und ihre Verwendung in der deutschen Sprache.
- Freund und Freund: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Freund und Freund" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- halb voll halb leer: Der Abschnitt "halb voll halb leer" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "halb voll halb leer" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- nächste Woche: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "nächste Woche" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Krankheitsamt: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Krankheitsamt" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Babyöl: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Babyöl" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- miteinander schlafen: Der Abschnitt "miteinander schlafen" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "miteinander schlafen" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Im Namen des Volkes: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Im Namen des Volkes" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Teelicht: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Teelicht" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Was gefällt (wird).: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Was gefällt (wird)." und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- elf zwölf: Der Abschnitt "elf zwölf" untersucht die Bedeutung der Wörter "elf" und "zwölf" und ihre Verwendung in der deutschen Sprache.
- Aschenbecher: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Aschenbecher" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- kalter Atmer: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "kalter Atmer" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Zeitangaben: In diesem Kapitel wird die Verwendung von Zeitangaben in der deutschen Sprache analysiert.
- echt Gold: Der Abschnitt "echt Gold" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "echt Gold" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- (k)einen (schlechten) Geschmack: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "(k)einen (schlechten) Geschmack" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- - zimmer: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "- zimmer" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- – und -: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "– und -" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Leserichtungen: Der Abschnitt "Leserichtungen" untersucht die Bedeutung von Leserichtungen und ihre Rolle in der Kommunikation.
- Zwillinge: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Zwillinge" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Deckel und -?: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Deckel" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Schwarz und Weiß: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Schwarz und Weiß" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- rückwärts denken: Der Abschnitt "rückwärts denken" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "rückwärts denken" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Brannt und Brand: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Brannt und Brand" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- löffeln, messern, gabeln.: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch der Wörter "löffeln", "messern" und "gabeln" und ihre Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Teller und Tassen: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Teller und Tassen" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- der Tag: Der Abschnitt "der Tag" untersucht die Bedeutung des Wortes "Tag" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- altlich: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "altlich" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- nachdenken: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "nachdenken" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Un 1: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Un 1" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Un 2: Der Abschnitt "Un 2" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "Un 2" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Sinn: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Sinn" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Geschwist: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Geschwist" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- ?: In diesem Kapitel wird das Fragezeichen und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- ungemeint: Der Abschnitt "ungemeint" untersucht die Bedeutung des Wortes "ungemeint" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Sprachverständnis: Dieses Kapitel analysiert das Sprachverständnis und seine Bedeutung für die Kommunikation.
- Fragewörter: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch von Fragewörtern und ihre Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- der Mann und der Junge: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "der Mann und der Junge" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- geradewärts: Der Abschnitt "geradewärts" untersucht die Bedeutung des Wortes "geradewärts" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Un-/Rechtsbewusstsein: Dieses Kapitel analysiert das Un-/Rechtsbewusstsein und seine Bedeutung für die Kommunikation.
- Was macht der Artikel da?: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Artikel" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Wörter zusammennageln: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Wörter zusammennageln" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Anspruchsvölle: Der Abschnitt "Anspruchsvölle" untersucht die Bedeutung des Wortes "Anspruchsvölle" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Kompliment und kompliziert: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Kompliment und kompliziert" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Lüger: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Lüger" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- hochzeiten: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "hochzeiten" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Anrufentgegennehmer: Der Abschnitt "Anrufentgegennehmer" untersucht die Bedeutung des Wortes "Anrufentgegennehmer" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- spülen und waschen_: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "spülen und waschen_" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- hicks: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "hicks" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- vom Krebsen: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "vom Krebsen" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Fragen - bogen_: Der Abschnitt "Fragen - bogen_" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "Fragen - bogen_" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Uhrzeit: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Uhrzeit" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- in der Späte: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Ausdrucks "in der Späte" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Waisen & ?: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Waisen & ?" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- - logik: Der Abschnitt "- logik" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "- logik" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- auf Immerwiedersehen: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "auf Immerwiedersehen" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- spenden und spendieren: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch der Wörter "spenden" und "spendieren" und ihre Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- irgend -: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "irgend -" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- der Indik: Der Abschnitt "der Indik" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "der Indik" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- der Ohnemensch: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "der Ohnemensch" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- es dringt: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "dringt" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Begatt (in): In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Begatt (in)" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Klebe(r).: Der Abschnitt "Klebe(r)." untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "Klebe(r)." und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- Verwechslungen: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Verwechslungen in der Sprache und deren Ursachen.
- eins: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "eins" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- die schlaue 1: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "die schlaue 1" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Fernseher & Fernhörer: Der Abschnitt "Fernseher & Fernhörer" untersucht die Bedeutung der Wörter "Fernseher" und "Fernhörer" und ihre Verwendung in der deutschen Sprache.
- der Zugeschlossene.: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "der Zugeschlossene." und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- es orkant: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "orkant" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- hockern und sesseln und: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "hockern und sesseln und" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- Knaben und ?: Der Abschnitt "Knaben und ?" untersucht die Bedeutung des Ausdrucks "Knaben und ?" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- unentschlossene Art_: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "unentschlossene Art_" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Konsequenz: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "Konsequenz" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- Vielleichtigkeit: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "Vielleichtigkeit" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- der Anderländer: Der Abschnitt "der Anderländer" untersucht die Bedeutung des Wortes "Anderländer" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- halbe Stunden: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "halbe Stunden" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- notizieren: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch des Wortes "notizieren" und seine Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- sieb -: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "sieb -" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- in Zahlen: Der Abschnitt "in Zahlen" untersucht die Bedeutung von Zahlen und deren Verwendung in der deutschen Sprache.
- Asphaltauto: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "Asphaltauto" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Brüder und Schwestern: Dieser Abschnitt beleuchtet den Gebrauch der Wörter "Brüder" und "Schwestern" und ihre Bedeutung im Kontext von Sprache und Kultur.
- aum: In diesem Kapitel wird der Ausdruck "aum" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache analysiert.
- die Ältern: Der Abschnitt "die Ältern" untersucht die Bedeutung des Wortes "Ältern" und seine Verwendung in der deutschen Sprache.
- das Schrumpftum: Dieses Kapitel analysiert den Ausdruck "das Schrumpftum" und seine Bedeutung in der deutschen Sprache.
- Nachworte: Der Abschnitt "Nachworte" bietet zusätzliche Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Lexikon-Lesikons und seine Bedeutung für die deutsche Sprache.
- Iven Einszehn: Dieser Abschnitt bietet Informationen über den Autor des Buches, Iven Einszehn.
- Letzte Veröffentlichungen: Dieser Abschnitt enthält Informationen über die letzten Veröffentlichungen des Autors.
Schlüsselwörter
Das Lexikon-Lesikon "Anleitung zum Biegen und Brechen der Sprache" widmet sich den Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten und Spielarten der deutschen Sprache. Die wichtigsten Themenfelder sind: Sprache, Schreibfehler, Wortbildung, Wortschatz, Grammatik, Kommunikation, Ausdruck, Interpretation, Kontext, Kultur, Deutsch, Rechtschreibung.
- Quote paper
- Iven Einszehn (Author), 2013, Anleitung zum Biegen und Brechen der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/214483