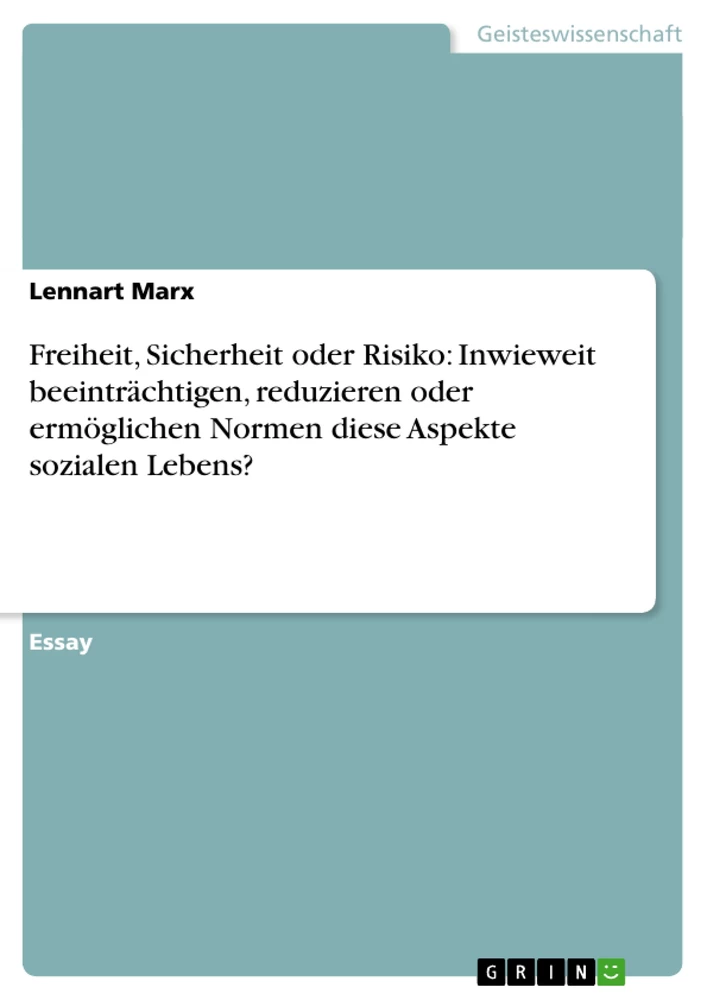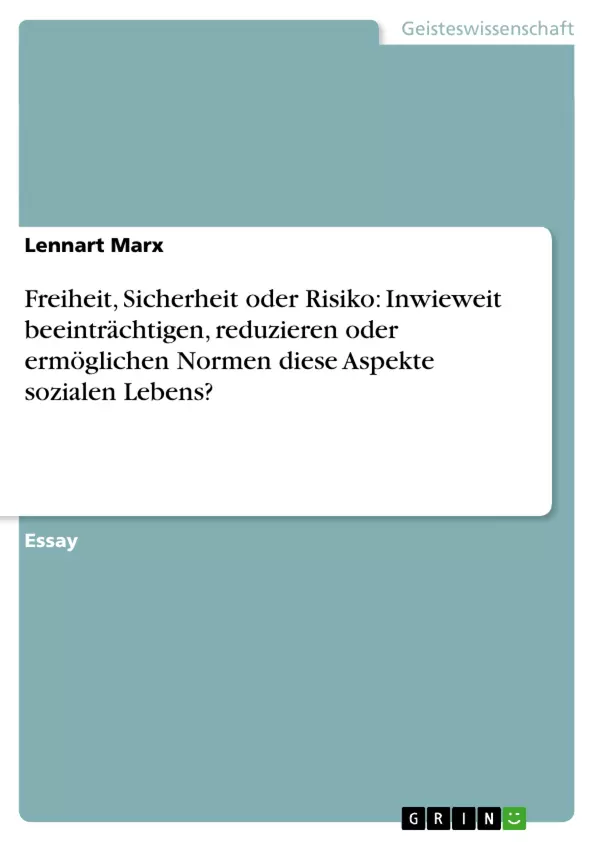Dieses Essay untersucht und bewertet die komplexen Wirkungsweisen von sozialen Normen. Dabei wird die Frage beantwortet, inwieweit die Aspekte Freiheit, Sicherheit und Risiko durch soziale Normen beeinflusst werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Einen Tee zum Andante (Mauró 2013)
Dieser Zeitungsartikel verdeutlicht die komplexen Wirkungsweisen von sozialen Normen, die in diesem Essay untersucht und bewertet werden sollen. Dabei wird die Frage beantwortet, inwieweit die Aspekte Freiheit, Sicherheit und Risiko durch soziale Normen beeinflusst werden.
Es kann argumentiert werden, dass Normen die persönliche Freiheit einschränken, weil sie Menschen zu einem bestimmten Verhalten zwingen, das in der jeweiligen zwischenmenschlichen Situation angepasst und von der Gesellschaft vorgeschrieben ist: In der Oper könnte theoretisch laut geredet und während der Vorstellung aufgestanden werden – auf Grund des „Benimm-Kodex[es]“ (ebd.) werden die Handlungsoptionen des Individuums aber stark eingeschränkt. Jedoch würde in einem Gesellschaftsmodell ohne Normen Chaos entstehen, weil keinerlei Regeln für soziale Interaktionen existieren würden. Folglich kann individuelle Freiheit erst durch diese Gesetzmäßigkeiten entstehen, weil sie Richtlinien geben und dadurch soziale Interaktionen berechenbar werden lassen, indem sie ihre Komplexität reduzieren: „Soziale Normen begrenzen offenbar die Willkür in der Beziehung von Menschen zueinander. Sie bewirken, dass Menschen sich mit einiger Sicherheit und Dauerhaftigkeit aufeinander verlassen können“ (Popitz 2006: 64). So kann in der Oper das Verhalten der anderen Zuschauer vorhergesehen werden und das Individuum kann erst dadurch die künstlerische Leistung genießen.
Auch soziale Rollen helfen bei der Entstehung und Beibehaltung der Ordnung. Laut Talcott Parsons existieren bestimmte Rollenmuster, die „unabhängig von konkreten Individuen [bestehen], und sie gelten für jeden, der in einer konkreten Situation handeln soll“ (Abels 2009: 132). An jede Rolle würden von der Gesellschaft entsprechende Erwartungen gestellt, die das Verhalten vorgeben und somit ein normales, sozial akzeptiertes und angepasstes Verhalten ermöglichen. In diesem Beispiel wissen die Zuschauer auf Grund der Rolle, die sie für diesen Moment innehaben, dass sie pünktlich zur Vorstellung erscheinen, sich in bestimmter Form kleiden, sich während des Stückes nicht unterhalten und am Ende des Stücks applaudieren.
Die Anpassung an soziale Gepflogenheiten und die Erfüllung von Rollenerwartungen ist nicht unbedingt wie bei Thomas Hobbes als Zwang zur Konformität unter Androhung von Sanktionen zu verstehen, weil sie häufig unbewusst funktioniert und im Laufe der Sozialisation indirekt vermittelt wird. Laut Emile Durkheim wird das „kulturelle System“ (ebd.) der Gesellschaft, das ist die Gesamtheit der sozialen Normen und Werte, im Sozialisationsprozess vermittelt, sodass „wir die gesellschaftlichen Regelungen so in uns hinein nehmen, dass wir schließlich automatisch so handeln, wie wir handeln sollen“ (ebd.). Dieser Aspekt wird von Parsons aufgegriffen, der die Motivation für normkonformes Verhalten mit der Motivation der Individuen begründet. Demnach würden Individuen die Schutzfunktion von Normen, die von der Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert werden, realisieren, weil sie „dem Einzelnen Halt geben, wenn er sich auf das Handeln zusammen mit anderen einlässt, und dass nach ihrer Maßgabe auch das ‚richtige’ Verhalten belohnt [...] wird“ (ebd.: 134). Normen geben demnach nicht nur dem Individuum Sicherheit in Bezug auf das richtige Verhalten, sondern ermöglichen eine Ordnung, die elementar für jede Gesellschaft ist und nur dann entsteht, wenn „alle Handelnden etwas gemeinsam [...] und freiwillig wollen“ (ebd.).
[...]
- Quote paper
- Lennart Marx (Author), 2013, Freiheit, Sicherheit oder Risiko: Inwieweit beeinträchtigen, reduzieren oder ermöglichen Normen diese Aspekte sozialen Lebens?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/214350