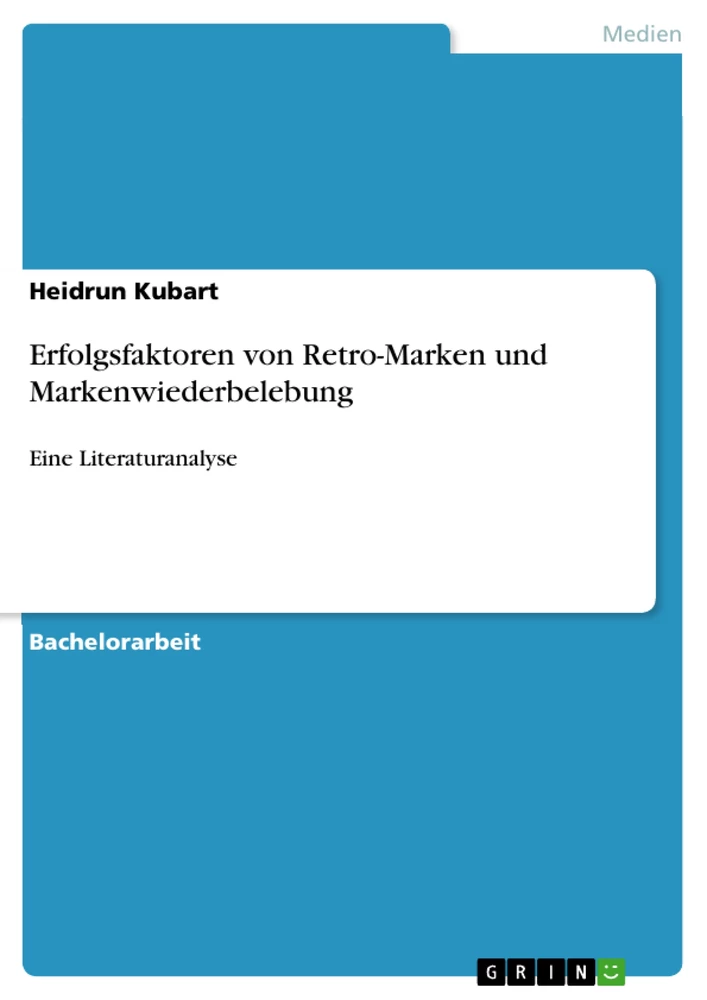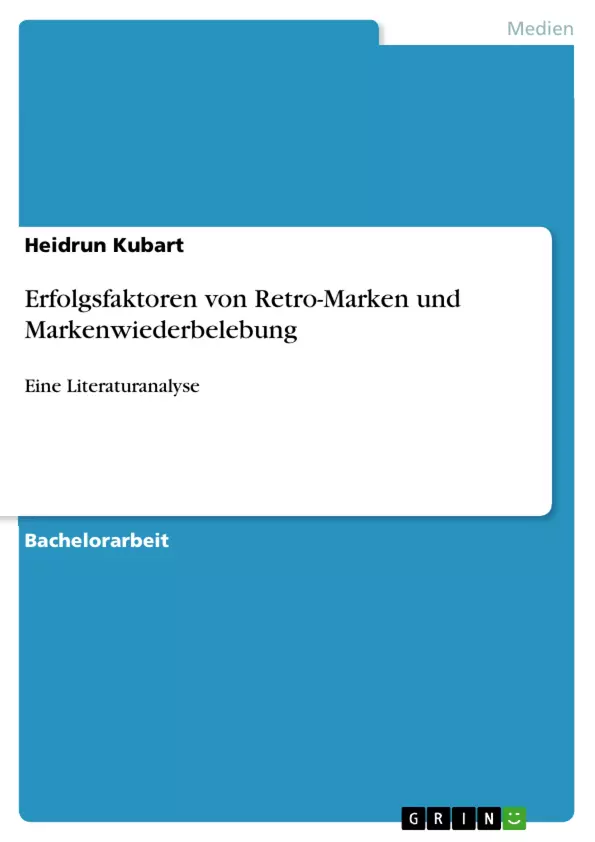In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Retro-Marken ständig an. Afri-Cola, Frucade, die Neuauflage des Yps-Hefts und wiederbelebte Automarken wie der MINI von BMW oder der Beetle von VW sind nur einige der zahlreichen Beispiele. Diese Marken, so unterschiedlich sie auch sind, haben eine Eigenschaft gemeinsam: sie waren vor längerer Zeit schon am Markt präsent, wurden eingestellt und eines Tages wiederbelebt.
Der Forschungsgegenstand dieser Arbeit ist die Frage, warum Retro-Marken in den letzten Jahren einen so großen Erfolg feierten und von welchen Faktoren dies abhängig ist. Mittels einer Literaturanalyse sollen unterschiedliche wissenschaftliche Theorien und Modelle zu den Erfolgsfaktoren gegenübergestellt werden. Durch das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden soll versucht werden, diese Fragen zu klären.
Für eine erfolgreiche Markenwiederbelebung müssen vorab einige Faktoren erfüllt sein. Diese Faktoren werden in dieser Arbeit analysiert und gegenübergestellt. Dabei zeigt sich neben dem Einfluss der Konsumenten in Form einer Markengemeinschaft bzw. einer Brand Community vor allem, dass Retro-Marken mit positiven Werten in Verbindung gebracht werden. Diese Werte basieren teilweise auf der Geschichte, der Authentizität und dem Erbe einer Marke und sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Retro-Marken. Durch den Kauf von Retro-Marken wird das Bedürfnis nach diesen Werten befriedigt und ein Stück kostbare Vergangenheit erworben – so kann etwa Afri Cola Erinnerungen an unbeschwerte Jugendzeiten wachrufen.
Eine Retro-Marke muss gleichzeitig so wenig wie möglich und so viel wie notwendig adaptiert werden; die Konsumenten sollen sie als trendig und nostalgisch empfinden. Durch das geschickte Zusammenspiel von Alt und Neu sollen neben den einst treuen Konsumenten auch jüngere Konsumenten, die eine Marke erst als Retro-Marke kennenlernen, erreicht werden. Diese Gratwanderung zwischen der Geschichte der Marke und den aktuellen Qualitätsanforderungen stellt eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Wiederbelebung dar, zählt durch ihre Empfindlichkeit aber gleichzeitig zu den Risiken. Neben den Risiken bringt die Markenwiederbelebung einige Vorteile mit sich, die ebenfalls Bestandteil dieser Arbeit sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Forschungsfragen
- 1.3.1 Hauptforschungsfrage
- 1.3.2 Subforschungsfragen
- 1.4 Forschungsmethode
- 1.5 Aufbau der Arbeit
- 2 Marken und Retro-Marken
- 2.1 Marken
- 2.1.1 Begriffsdefinition
- 2.1.2 Unterscheidung Marke/Produkt
- 2.1.3 Funktion der Marke
- 2.1.4 Wert der Marke
- 2.1.5 Markenhistorie, Marken-Authentizität und Markenerbe
- 2.2 Retro-Marken
- 2.2.1 Begriffsdefinition
- 2.2.2 Unterscheidung Retro-Marke/Retro-Produkt
- 2.2.3 Merkmale von Retro-Marken
- 2.2.4 Ursachen für den Erfolg von Retro-Marken
- 3 Retro-Marketing
- 3.1 Begriffsdefinition
- 3.1.1 Begriffsdefinition Marketing
- 3.1.2 Begriffsdefinition Retro-Marketing
- 3.2 Markenwiederbelebung
- 3.2.1 Begriffsdefinition
- 3.2.2 Voraussetzungen für erfolgreiche Markenwiederbelebungen
- 3.2.3 Brand Communities
- 3.2.4 Vorteile von Markenwiederbelebungen
- 3.2.5 Risiken
- 4 Conclusio und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Erfolgsfaktoren von Retro-Marken. Ziel ist es, durch eine Literaturanalyse verschiedene wissenschaftliche Theorien und Modelle gegenüberzustellen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen, um die Frage nach dem Erfolg dieser Marken zu beantworten. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die für eine erfolgreiche Markenwiederbelebung notwendig sind.
- Definition und Abgrenzung von Marken und Retro-Marken
- Analyse des Retro-Marketings und der Markenwiederbelebung
- Bedeutung von Brand Communities für den Erfolg von Retro-Marken
- Erfolgsfaktoren und Risiken der Markenwiederbelebung
- Verbindung von Nostalgie und aktuellen Marktanforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Retro-Marken ein und stellt die Problemstellung dar: Warum erleben einst eingestellte Marken ein Comeback? Die Arbeit beschreibt die Zielsetzung, Forschungsfragen und die angewandte Forschungsmethode (Literaturanalyse). Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und liefert erste Beispiele erfolgreicher Retro-Marken aus verschiedenen Branchen.
2 Marken und Retro-Marken: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Marke“ und „Retro-Marke“ und unterscheidet sie von Produkten. Es beleuchtet die Funktionen und den Wert von Marken, sowie die Bedeutung von Markenhistorie, -authentizität und -erbe. Der Abschnitt zu Retro-Marken untersucht deren Merkmale und die Ursachen für ihren Erfolg, wobei der Fokus auf der Verbindung von Nostalgie und aktuellen Marktanforderungen liegt.
3 Retro-Marketing: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Retro-Marketing“ und beleuchtet die Markenwiederbelebung als einen wichtigen Teilbereich. Es analysiert die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Markenwiederbelebung, die Rolle von Brand Communities, die Vorteile und die Risiken, die mit einer solchen Wiederbelebung verbunden sind. Der Abschnitt zeigt die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen der Bewahrung der Markenhistorie und der Anpassung an moderne Anforderungen auf.
Schlüsselwörter
Retro-Marken, Markenwiederbelebung, Retro-Marketing, Brand Community, Nostalgie, Markenhistorie, Markenauthentizität, Markenerbe, Erfolgsfaktoren, Konsumentenverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Erfolgsfaktoren von Retro-Marken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Erfolgsfaktoren von Retro-Marken. Sie analysiert, warum einst eingestellte Marken ein Comeback erleben und welche Faktoren für eine erfolgreiche Markenwiederbelebung notwendig sind.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, durch eine Literaturanalyse verschiedene wissenschaftliche Theorien und Modelle zum Thema Retro-Marken gegenüberzustellen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Letztendlich soll die Frage nach dem Erfolg dieser Marken beantwortet werden.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Hauptforschungsfrage nach den Erfolgsfaktoren von Retro-Marken und weiteren Subfragen, die sich auf die Definition und Abgrenzung von Marken und Retro-Marken, die Analyse des Retro-Marketings und der Markenwiederbelebung, die Bedeutung von Brand Communities, die Erfolgsfaktoren und Risiken der Markenwiederbelebung sowie die Verbindung von Nostalgie und aktuellen Marktanforderungen beziehen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Literaturanalyse als Forschungsmethode. Sie vergleicht verschiedene wissenschaftliche Theorien und Modelle, um die Erfolgsfaktoren von Retro-Marken zu identifizieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Marken und Retro-Marken, ein Kapitel zum Retro-Marketing und eine Schlussfolgerung mit Ausblick. Die Einleitung definiert die Problemstellung, die Zielsetzung, die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet Marken und Retro-Marken, Kapitel 3 das Retro-Marketing und die Markenwiederbelebung. Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Definition und Abgrenzung von Marken und Retro-Marken, die Analyse des Retro-Marketings und der Markenwiederbelebung, die Bedeutung von Brand Communities für den Erfolg von Retro-Marken, die Erfolgsfaktoren und Risiken der Markenwiederbelebung und die Verbindung von Nostalgie und aktuellen Marktanforderungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Retro-Marken, Markenwiederbelebung, Retro-Marketing, Brand Community, Nostalgie, Markenhistorie, Markenauthentizität, Markenerbe, Erfolgsfaktoren und Konsumentenverhalten.
Wie werden Marken und Retro-Marken definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff "Marke" und "Retro-Marke" und grenzt diese von Produkten ab. Sie untersucht die Funktionen und den Wert von Marken sowie die Bedeutung von Markenhistorie, -authentizität und -erbe im Kontext von Retro-Marken.
Was ist Retro-Marketing und welche Rolle spielt die Markenwiederbelebung?
Die Arbeit definiert Retro-Marketing und analysiert die Markenwiederbelebung als wichtigen Teilbereich. Sie untersucht die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Markenwiederbelebung, die Rolle von Brand Communities, sowie die Vorteile und Risiken einer solchen Wiederbelebung. Es wird der Balanceakt zwischen der Bewahrung der Markenhistorie und der Anpassung an moderne Anforderungen beleuchtet.
Welche Bedeutung haben Brand Communities für den Erfolg von Retro-Marken?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Brand Communities für den Erfolg von Retro-Marken. Es wird analysiert, wie diese Gemeinschaften zur Markenwiederbelebung und zum langfristigen Erfolg beitragen können.
Welche Erfolgsfaktoren und Risiken bestehen bei der Markenwiederbelebung?
Die Arbeit identifiziert die Erfolgsfaktoren und Risiken, die mit der Wiederbelebung von Marken verbunden sind. Sie untersucht, welche Faktoren zum Erfolg und welche zum Scheitern beitragen können.
Wie wird die Verbindung zwischen Nostalgie und aktuellen Marktanforderungen hergestellt?
Die Arbeit analysiert, wie der Erfolg von Retro-Marken durch die Verbindung von Nostalgie und aktuellen Marktanforderungen erreicht werden kann. Es wird untersucht, wie Marken ihre Geschichte effektiv nutzen können, ohne dabei den aktuellen Bedürfnissen und Trends des Marktes zu widersprechen.
- Arbeit zitieren
- Heidrun Kubart (Autor:in), 2013, Erfolgsfaktoren von Retro-Marken und Markenwiederbelebung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/212180