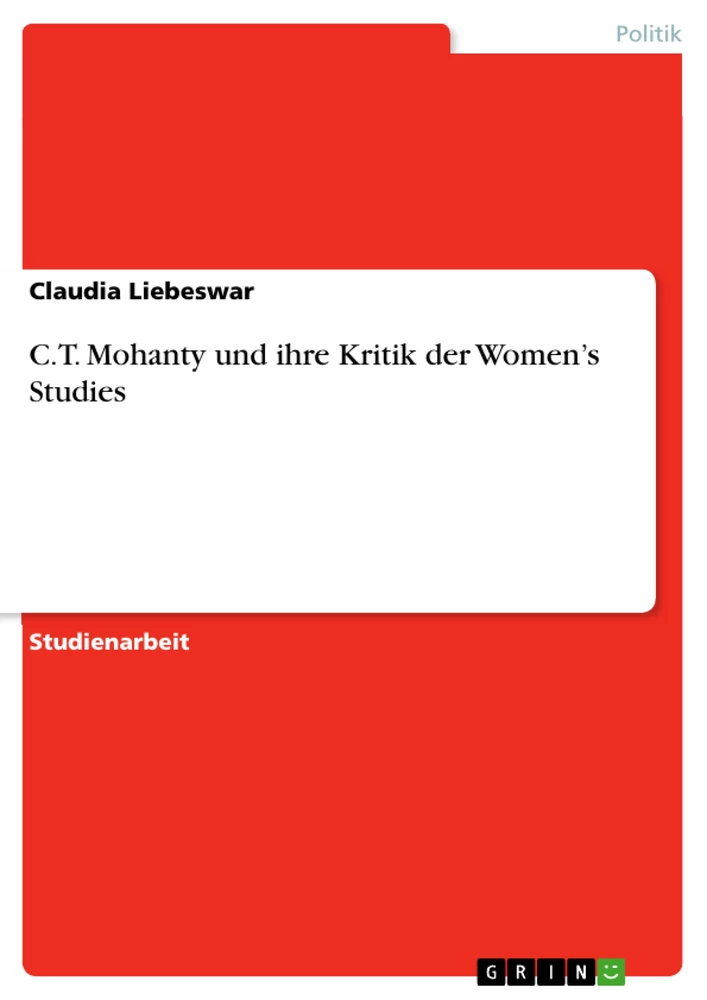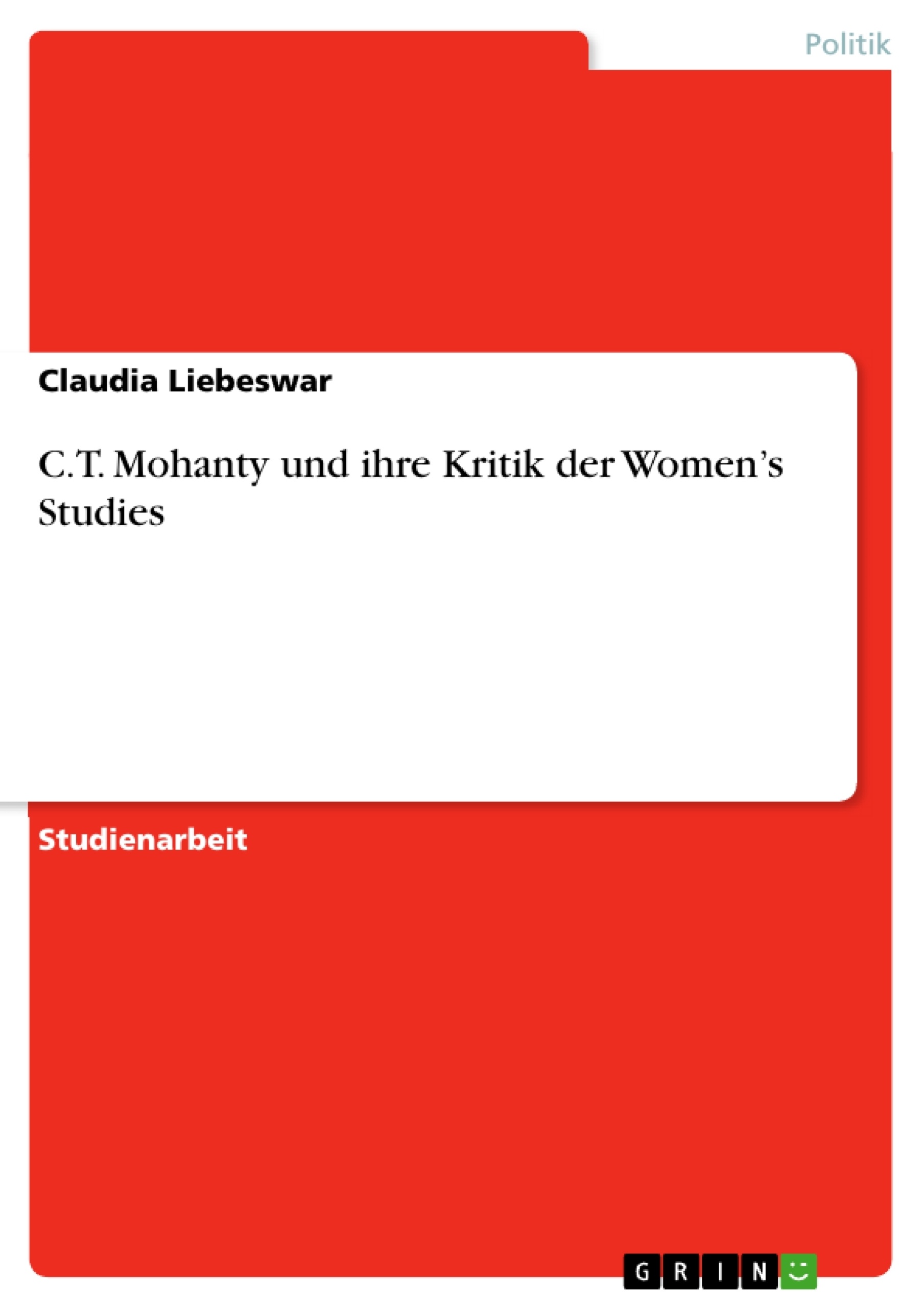Konkret werde ich zunächst die drei, von Mohanty modellhaft beschriebenen, Zugänge der Gender Studies beschreiben, welche sich in Grad und Form der Internationalisierung unterscheiden, bevor ich das zu betrachtende Forschungsobjekt und meine methodische Vorgehensweise umreißen werde. Der zentrale Teil der Arbeit soll darin bestehen, dass ich die verschiedenen Modelle Mohantys mit Stoff und Aufbau des konkreten Objekts des Interesses, welches das Modul „Geschlecht und Politik“ repräsentieren soll, vergleichen werde. In einer abschließenden Conclusio sollen die Schlüsse zusammengefasst und ihre Relevanz diskutiert werden.
Einleitung
Chandra Talpade Mohanty nutzt in ihrem 2003 erschienenen Text „Under Western Eyes Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles“ ihre Erfahrungen als US-amerikanische Universitäts-Professorin der women’s studies um zu erfassen, inwiefern eine Internationalisierung jenes Studienganges stattgefunden hat und welche Strategien hierbei verfolgt wurden (Vgl. Mohanty, 2003: S.517). Als wesentlich erachtet sie hierbei, wie sie bereits in ihrem bekannten Text „Under Western Eyes“ des Jahres 1986 erläutert (Vgl. Mohanty, 1986: S.347) und im Jahre 2003 erneut betont hat (Vgl. Mohanty, 2003: S.517), die Verknüpfung zwischen dem Lokalen und dem Globalen in den Betrachtungen.
In Anbetracht der Tatsache, dass es eine der wesentlichsten Aussagen des vielzitierten Textes Mohantys aus 1986 ist, dass unzulässige Generalisierungen zu entlarven und zu vermeiden sind (Vgl. z.B. Mohanty, 1986: S.338), wäre es natürlich komplett entgegen dem Anliegen der Autorin, würde jene Feststellung nun einfach auf einen anderen zeitlichen und örtlichen Kontext übertragen und davon ausgehen, dass die Situation in den aktuellen Studienplänen der Universität Wien die selbe ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es sehr angebracht zu betrachten, inwiefern das Angebot der Politikwissenschaft aus dem Bereich „Geschlecht und Politik“, welches an der Universität Wien entsprechend dem Studienplan des Jahres 2011 zur Verfügung steht, den Ansprüchen Mohantys nach Internationalisierung und dem Aufbrechen der Dichotomie von „lokal“ und „global“ gerecht wird. Zwar betont die Autorin, dass sich jene Forderungen nicht bloß auf Women’s Studies beziehen (sollten), es erschien mir aber im Lichte ihrer Arbeit des Jahres 2003 angebracht, ihr Vorgehen so gut als möglich nachzustellen und zumindest den groben Themenbereich beizubehalten. Insofern schien die Wahl des entsprechenden Spezialisierungsmoduls in einem mehr oder minder fachfremden Studium die ideale Kombination beider Intentionen zu sein.
Konkret werde ich zunächst die drei, von Mohanty modellhaft beschriebenen, Zugänge der Gender Studies beschreiben, welche sich in Grad und Form der Internationalisierung unterscheiden, bevor ich das zu betrachtende Forschungsobjekt und meine methodische Vorgehensweise umreißen werde. Der zentrale Teil der Arbeit soll darin bestehen, dass ich die verschiedenen Modelle Mohantys mit Stoff und Aufbau des konkreten Objekts des Interesses, welches das Modul „Geschlecht und Politik“ repräsentieren soll, vergleichen werde. In einer abschließenden Conclusio sollen die Schlüsse zusammengefasst und ihre Relevanz diskutiert werden.
Modelle der Internationalisierung
Wie bereits erwähnt, beschreibt Mohanty in ihrem Text des Jahres 2003 drei mögliche Modelle der Vorgehensweisen der Women’s Studies. Die beiden dominanten jener pädagogischen Modelle sind zum einen das „feminist-as-tourist model“ und zum anderen das „feminist-as-explorer model“. Ersteres ist dadurch gekennzeichnet, dass die Frauen der sogenannten Dritten Welt den feministischen Analysen lediglich hinzuaddiert werden, wohingegen es nicht zu einer konzeptuellen Erweiterung der Analysekategorien kommt (Vgl. Mohanty, 2003: S.518). Das Resultat jener Vorgehensweise, in der die nichtwestlichen Frauen als bestätigende Beispiele für die Analysen westlicher Frauen verwendet werden, ist ein Aufrechterhalten der Dichotomie zwischen „west“ und „rest“ ebenso wie zwischen dem Lokalen und dem Globalen (Vgl. ed.), was dem Anliegen Mohantys entgegenwirkt. Jene Dichotomie bleibt im Wesentlichen auch im zweiten dominanten Modell, welches die feministische Vorgangsweise als erkundende ausführt, erhalten. Dennoch werden, in kulturrelativistischer Weise, die Kontexte der feministischen Anliegen und Problematiken erörtert, wobei die jeweiligen geografischen und kulturellen Grenzen der Betrachtungen thematisiert werden (Vgl. ed.: S.520). Interessanter Weise werden die USA selbst nicht in jene Analysen einbezogen (Vgl. ed.: S.519-520).
Keines der beiden Modelle kann Mohantys Ansprüche zufriedenstellend erfüllen. Aufgrund dessen stellt sie ihnen das Modell der „comparative feminist studies“ beziehungsweise der „feminist solidarity“ entgegen, welches sie als „most useful and productive pedagogical strategy for feminist cross-cultural work“ (ed.: S.518) sieht. In jenem stehen die Auflösung von Dichotomie und die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Lokalen und dem Globalen, zwischen den verschiedenen geografischen und kulturellen Gegebenheiten und zwischen den individuellen und kollektiven Erfahrungen im Mittelpunkt (Vgl. ed.: S.521). Das Innovative an jenem Ansatz ist also im Wesentlichen die Erkenntnis, dass einzelne Phänomene nicht isoliert und unabhängig voneinander sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen sowie konstituieren (Vgl. ed.). Hierdurch solle letztlich der Eurozentrismus ebenso wie der Kulturrelativismus zugunsten einer transnationalen Solidarität überwunden werden (Vgl. ed.: S.525).
Forschungsobjekt und Methodik
Aufgrund der stark eingeschränkten Ressourcen und Länger dieser Arbeit ebenso wie aufgrund des erschwerten Zuganges zu den entsprechenden E-Learning-Plattformen wäre es ein unmögliches Unterfangen, das gesamte Spezialisierungsmodul „Geschlecht und Politik“ eines Semesters ausreichend detailliert durchzuarbeiten und mit den Modellen Mohantys zu vergleichen. Aufgrund dessen fokussierte ich mich auf das Seminar „Seilschaft – Begehren – Gewalt – Zur patriarchalen Organisation von Männerbund und Homosozialität“, welches im Sommersemester 2012 von Mag. Scheibelhofer abgehalten worden war. Die Entscheidung für dieses Seminar scheint insbesondere aus forschungstechnischen Gründen gerechtfertigt, handelt es sich hierbei doch um eine Veranstaltung, die durch die E-Learning-Plattform Moodle unterstützt wurde (Vgl. Universität Wien, 2012). Aus diesem Grund war es auch mir, als einer Studentin, die nicht an der Veranstaltung teilgenommen hat, möglich, sowohl Inhalt als auch Diskussionstendenzen und didaktische Taktiken festzustellen und mit Mohanty in Bezug zu setzen. Dies geschah mit freundlicher Erlaubnis des Lehrveranstaltungsleiters.
[...]
- Arbeit zitieren
- Claudia Liebeswar (Autor:in), 2012, C.T. Mohanty und ihre Kritik der Women’s Studies , München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/211581