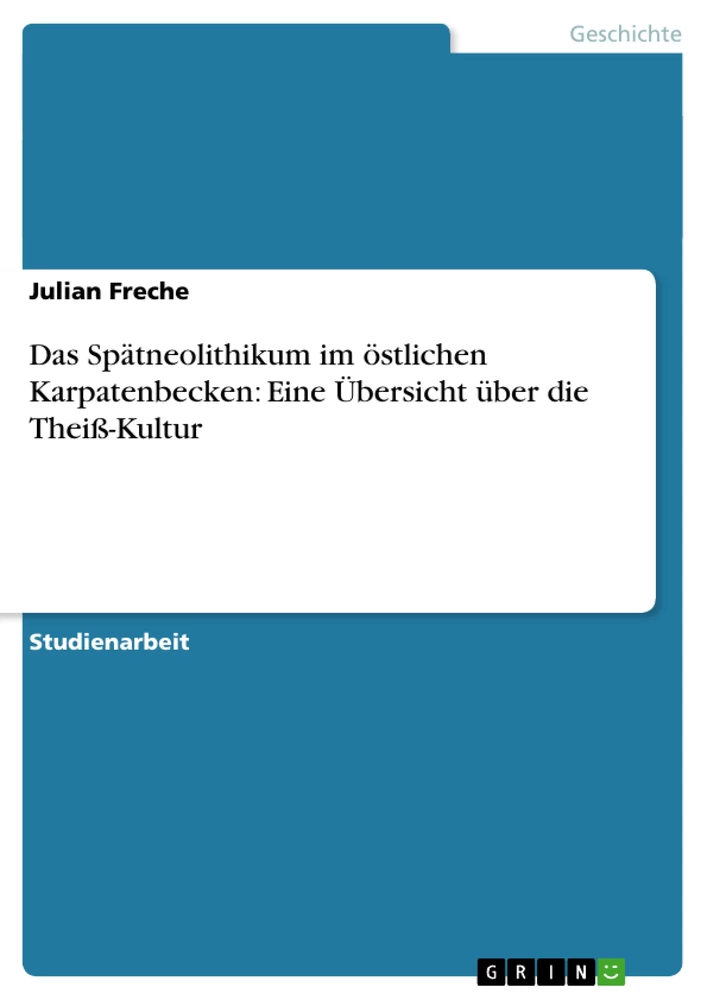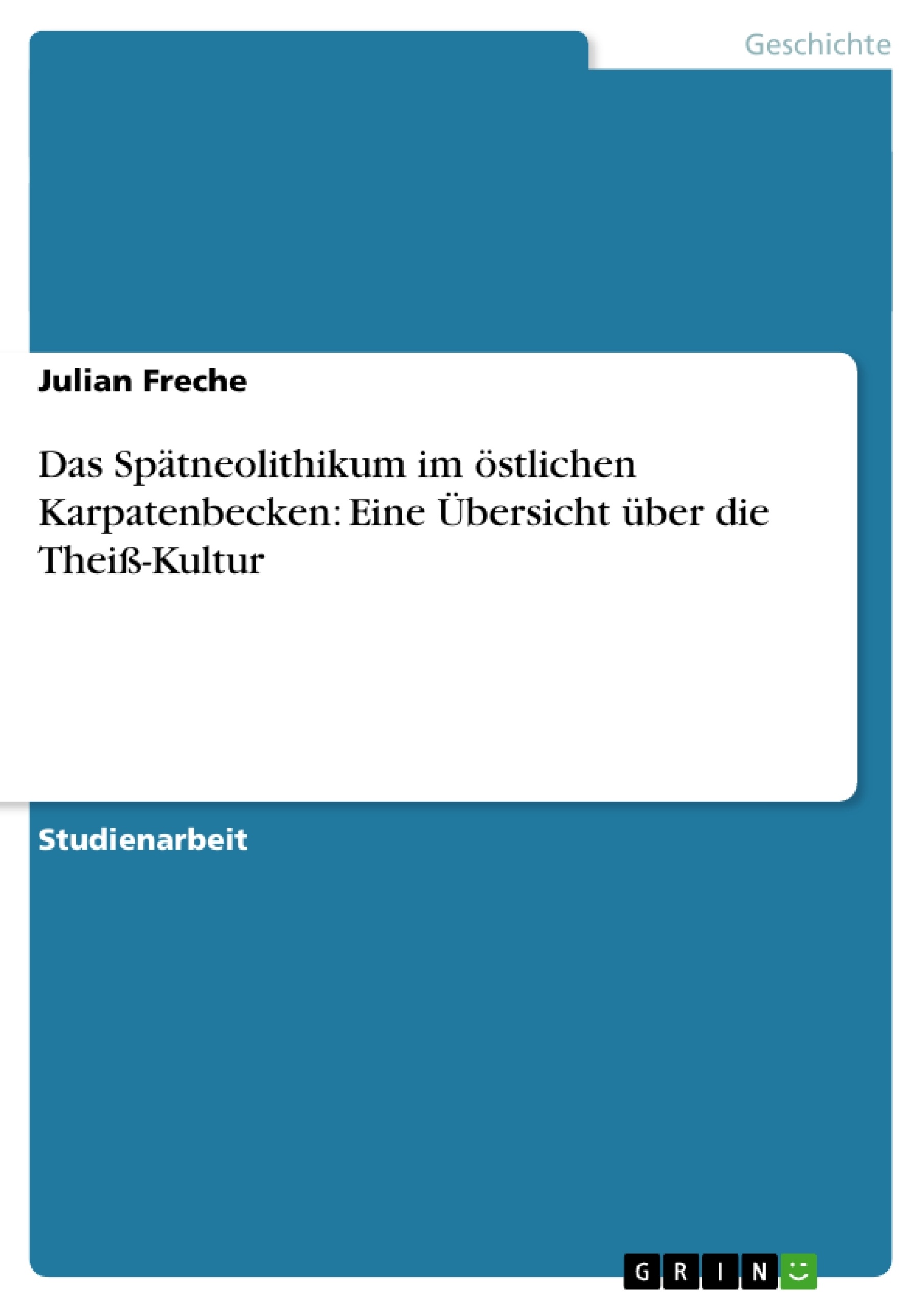Entlang der Theiß und einiger Nebenflüsse hatte sich im 5. Jahrtausend vor Christus die so genannte Theiß-Kultur herausgebildet. Diese Kultur wies, in starker Anlehnung an die Vinča-Kultur, viele rituelle Gegenstände auf, vor allem Gesichtsgefäße und Statuetten. Diese Kultur bildete in Ostungarn den Übergang vom Spätneolithikum zum Chalkolithikum, also der beginnenden Metallzeit. Die Frage ist also auch, inwiefern bereits die neolithischen Kulturen am Übergang zur Metallzeit Kupfer nutzten.
In dieser Arbeit soll eine Übersicht über die Theiß-Kultur erstellt werden. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie sich diese Kultur anhand ihrer Siedlungen, Gräber und Funde darstellt, wie sie zeitlich einzuordnen ist und auf welche Art sich die Menschen der Theiß-Kultur ernährt haben.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Kurzcharakteristik
3 Forschungsgeschichte
4 Verbreitung und Umweltbedingungen
5 Quellen
5.1 Art der Quellen
5.2 Quellenlage
6 Siedlungsstruktur
6.1 Lage
6.2 Siedlungsplan
6.3 Hausgrundrisse
6.4 Bautechnik
7 Gräber
7.1 Gräberform
7.2 Bestattungsweise
8 Depot – und Einzelfunde
9 Formenkunde
9.1 Keramik
9.1.1 Gefäßformen und Technik
9.1.2 Verzierungen
9.1.3 Besondere Objekte
9.2 Felsgestein
9.2.1 Beile und Äxte
9.3 Silex
9.4 Knochen und Hirschgeweih
9.5 Metall
9.6 Schmuck
10 Chronologie
10.1 Chronologisches Verhältnis zu anderen Gruppen
10.2 Interne chronologische Gliederung
10.2.1 Relative Chronologie
10.2.2 Absolute Chronologie
11 Kulturelle Einbindung
12 Wirtschaftsweise
12.1 Subsistenzwirtschaft
12.2 Handwerkliche Produktion
12.3 Handel und Transport
13 Sozialstruktur
14 Geistige Kultur
15 Ausblick
Abbildungsverzeichnis
Abbildungen
Tabellen
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Entlang der Theiß und einiger Nebenflüsse hatte sich im 5. Jahrtausend vor Christus die so genannte Theiß-Kultur herausgebildet. Diese Kultur wies, in starker Anlehnung an die Vinča-Kultur, viele rituelle Gegenstände auf, vor allem Gesichtsgefäße und Statuetten. Diese Kultur bildete in Ostungarn den Übergang vom Spätneolithikum zum Chalkolithikum, also der beginnenden Metallzeit. Die Frage ist also auch, inwiefern bereits die neolithischen Kulturen am Übergang zur Metallzeit Kupfer nutzten.
In dieser Arbeit soll eine Übersicht über die Theiß-Kultur erstellt werden. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie sich diese Kultur anhand ihrer Siedlungen, Gräber und Funde darstellt, wie sie zeitlich einzuordnen ist und auf welche Art sich die Menschen der Theiß-Kultur ernährt haben.
2 Kurzcharakteristik
Die Menschen des Spätneolithikums in Ostungarn lebten in einem relativ dünn besiedelten Gebiet, vor allem auf erhöhten Geländeabschnitten an Flüssen. Die Handelsverbindungen reichten von der Adria bis an das Schwarze Meer und von Siebenbürgen bis hinein in das Gebiet des heutigen Serbiens, damals war dort die Vinča-Kultur ansässig. Die Menschen lebten in einfachen Häusern mit Satteldach oder auch in Grubenhäusern und lebten vor allem vom Ackerbau und der Viehzucht, bzw. dem Fischfang.
Die Keramik war sehr vielfältig, hier fallen vor allem die großen Vorratsgefäße und die wohl kultischen Statuetten auf. Diese Statuetten konnten bis zu 80 cm groß sein. Auch die Nutzung von Äxten und Beilen für kultische Zwecke scheint belegt, diese wurden auch in sogenannten Altarkisten gefunden.
3 Forschungsgeschichte
Die ältesten Funde, die der Theiß-Kultur zugerechnet werden, wurden wohl bereits im Jahr 1876 gefunden. Allerdings fanden die ersten systematischen Grabungen, welche Erkenntnisse über die Theiß-Kultur zutage förderten, erst zwischen 1907 und 1913 in Csóka statt. Diese Ausgrabung blieb allerdings unpubliziert (Korek 1989, 17).
Ende der 1920er Jahre begannen im Gebiet der Theiß weitere Grabungen. Dazu gehörten die Grabungen 1928 und 1930 in Tápé-Lebó, die von F. Mora durchgeführt worden waren, sowie die Grabungen von Hódmezővásárhely-Kökénydomb von J. Banner, die zwischen 1928 und 1944 durchgeführt wurden. Die Forschungsergebnisse von Hódmezővásárhely-Kökénydomb bildeten die Grundlage für die weitere Erforschung der Theiß-Kultur. Die von Tompa beschriebene Bükk-Kultur wurde 1941 von Csalog in weitestgehende Parallelität zur Theiß-Kultur gestellt. Diese These, welche die vorherigen Versuche zusammenfasste, die Theiß-Kultur in einen überregionalen Zusammenhang zu stellen, fand weite Verbreitung, stellte sich aber einige Jahre später als falsch heraus.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitere wichtige Siedlungsplätze erforscht. Dazu gehörten die Grabungen bei Hódmezővásárhely-Gorzsa, wo von 1955 an immer wieder verschiedene Grabungskampagnen durchgeführt worden sind. Ebenfalls seit 1955 wurde der Fundplatz Szegvár-Tűzköves erforscht. Auch diese Siedlung wurde in den darauf folgenden Jahrzehnten öfter untersucht. Die Ergebnisse dieser Grabungen führten auch dazu, dass die Theiß-Kultur in die Herpaly-, die Czőszhalom- und eine stark verkleinerte Theiß-Kultur aufgeteilt wurde. Diese neue Einteilung wurde von Korek und Patay (Herpaly) 1956 und von Bognár-Kutzián (Czőszhalom) 1963 erstmals vertreten. Nach diesen neuen Erkenntnissen konzentrierte sich die Forschung in den 1960er Jahren auf die Wechselwirkungen zwischen den in Ungarn vorhandenen Kulturen. Dies betraf die Untersuchungen der Lengyel- sowie der drei Theiß-Kulturen. In diese Phase fallen auch Grabungen an neu entdeckten Siedlungsplätzen. Dies betraf zum einen Kisköre-Gát, ergraben zwischen 1963 und 1966, und zum anderen die Siedlung von Vésztö-Mágor, die ab 1972 bis 1976 erforscht worden ist. Ebenfalls in den 1970er Jahren wurden in der Gegend um Battonya die Fundorte Parázs-tanya und Gödrösök erforscht.
Durch diese groß angelegten Grabungskampagnen gelang es erstmals, die vorhandenen Erkenntnisse über die Theiß-Kultur auf eine breitere Basis zu stellen. Dadurch gelang auch eine bessere Abgrenzung gegenüber den anderen Kulturen, die in geografischer Nähe zur Theiß-Kultur angesiedelt gewesen waren (Kalicz / Raczky 1990, 11-14).
4 Verbreitung und Umweltbedingungen
Die Frage, in welchem Gebiet Siedlungen der Theiß-Kultur gefunden worden sind, lässt sich nur mithilfe einer Verbreitungskarte sinnvoll klären. Auf dieser Karte ist zu sehen, dass sich die meisten Siedlungen im südlichen Theißgebiet, südlich des Körös, ballen (Abb. 1). Untersuchungen haben ergeben, dass das Verbreitungsgebiet der Theiß-Kultur allerdings starken Schwankungen unterworfen war. So reichte es in der frühen Phase von der Theiß im Westen bis in die Karpaten Siebenbürgens im Osten. Später zerfiel die Kultur in die genannten Untergruppen, wobei sich am Nordlauf der Theiß die Czőszhalom-Kultur etablierte. Die Herpály-Kultur war vor allem an den beiden Quellflüssen des Körös zu finden, die sich östlich der Mittleren Theiß befinden.
Im Gebiet der mittleren Theiß sowie des Körös konnte eine weitestgehende Siedlungskontinuität der Theiß-Kultur festgestellt werden. Innerhalb dieses Gebietes lassen sich nach der Aufspaltung zwei Siedlungsgebiete erkennen, die sich vor allem in der Siedlungsdichte unterscheiden. Die südliche Zone reicht von Aranka in Serbien (damals Jugoslawien) bis zum Zusammenfluss von Theiß und Körös. Die zweite Zone erstreckt sich von dort aus nach Norden bis nach Czőszhalom (Kalicz / Raczky 1990, 16).
Über die Umweltbedingungen mit denen die Menschen der Theiß-Kultur umgehen mussten, ist bisher wenig bekannt. Eine genaue Erforschung steht hier noch aus.
5 Quellen
5.1 Art der Quellen
Als Quellen werden vor allem Siedlungsfunde herangezogen, ebenso Gräber. Hierbei spielen die gefundenen Keramiken eine sehr große Rolle, weil vor allem die Statuetten und Gesichtsgefäße sehr wichtig für die Forschung sind. Auch die gefundenen Hausreste bieten einen guten Einblick in die Theiß-Kultur. Weitere Quellen sind Schmuckgegenstände aus den Gräbern.
5.2 Quellenlage
Durch die zunehmende Störung der Fundschichten in der Region Battonya ist die Quellenlage zumindest in diesem Gebiet relativ schlecht geworden. Die dort erfolgten Rettungsgrabungen wurden nicht in dem Umfang und der Sorgfalt durchgeführt, welche notwendig gewesen wäre (Goldman 1984, 4 – 6). Die Tatsache, dass nur etwa 110 Siedlungen der Theiß-Kultur bekannt sind, und viele davon bereits ausgegraben worden sind, verbessert die Quellenlage nicht. Dennoch ist ein Großteil der Siedlungsgrabungen gut publiziert und bietet einen guten Einblick in die Theiß-Kultur.
6 Siedlungsstruktur
6.1 Lage
Viele Siedlungen der Theiß-Kultur lagen, wie auch bereits der Name vermuten lässt, entlang der Theiß oder ihren Nebenflüssen. Dabei waren sie immer in etwas erhöhter Lage anzutreffen, damit etwaiges Hochwasser keinen großen Schaden anrichten konnte (Banner 1942, 32). Obwohl viele Annahmen Banners bereits seit Jahrzehnten als veraltet gelten, trifft seine Beobachtung, die Lage der Siedlungen betreffend, auch für die heutige Forschung noch zu. So kennt man bis heute fast nur Siedlungsplätze, die auf Hochufern gelegen waren. Insgesamt sind etwa 110 Fundorte bekannt (Kalicz / Raczky 1990, 17). Diese 110 Fundorte erstreckten sich allerdings über ein großes Gebiet, die Gegend scheint sehr dünn besiedelt gewesen zu sein. Die Lage, vor allem der tellartigen und echten Tell-Siedlungen (vg. Kap 6.2), an Flussmündungen war allerdings für den Handel sehr gut geeignet (Kalicz 1998b, 310).
6.2 Siedlungsplan
Man kann anhand der bisher gefundenen Siedlungsplätze drei verschiedene Arten von Siedlungstypen unterscheiden. Das sind die echte Tell-Siedlung, die tellartige Siedlung sowie die einschichtige Siedlung. Die echte Tell-Siedlung zeichnet sich dadurch aus, dass dort immer ein sehr dicht überbautes Wohngebiet zu finden ist. Die Kulturschichten sind in solchen Siedlungen etwa 3 – 4 m stark und die Siedlungen ragen sehr deutlich aus der Landschaft hervor. Dieser Siedlungstyp konnte bis zu 3,8 ha groß sein, zumeist waren die Siedlungen im Durchschnitt aber kleiner. Die tellartigen Siedlungen werden dadurch definiert, dass die dort gefundene Bebauung lockerer ist als bei echten Tell-Siedlungen (Abb. 7). Die Zahl der Siedlungsebenen ist ebenfalls geringer, die Ausdehnung der Siedlung aber größer, sie erreicht im Durchschnitt etwa 6 ha. Bei dieser Art der Siedlung kann eine Kulturschicht zwischen einem und zweieinhalb Meter dick sein. Der dritte Siedlungstyp zeichnet sich durch relativ dünne Siedlungsschichten aus, nur etwa 25 bis 50 cm, und wird sehr viel häufiger als die beiden anderen Typen gefunden. Diese Siedlungen können die größte Ausdehnung erreichen, bis zu 12 ha große Siedlungen sind für diesen Typ bekannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Siedlungen einem anderen Zweck als die ersten beiden Typen dienten. Um die Siedlungen herum wurden teilweise Gräben gefunden, teilweise auch Zäune. Diese waren aber nie um die gesamte Siedlung herum angelegt und dienten wohl nicht dem Schutz der ganzen Siedlung (Kalicz / Raczky 1990, 16 – 17).
Aus der Lage der Bauten, die Korek in Kisköre-Damm ausgegraben hatte, konnte er keine Siedlungsfunktion erschließen. Dies traf auch auf viele andere Siedlungen der Theiß-Kultur zu. Allerdings konnte er rekonstruieren, dass sich in Kisköre etwa 10 Wohngruben, 2 Häuser und 6 Wirtschaftsgebäude befanden (Abb. 2), was eine Fläche von etwa 140 m² pro Haus ergibt. Dies wäre eine relativ dünn besiedelte Siedlung. Berechnet man die übrigen Gruben allerdings als genutzte Gebäude mit ein, ergibt sich eine dichte Siedlungsstruktur (Korek 1989, 51).
Pro Siedlung kann man pro Phase von etwa 4 – 6 Häusern ausgehen, plus die Arbeitsplätze, Lehmgruben, von denen einige als Vorratslager genutzt worden sind, und Gräberanlagen (Kalicz 1998b, 310).
6.3 Hausgrundrisse
Die ursprüngliche Annahme, dass die Menschen der Theiß-Kultur in Grubenhäusern aus Lehm gewohnt hätten, die etwa acht oder neun Meter lang gewesen seien, wurde 1942 von Banner postuliert (Banner 1942, 34). Bei späteren Ausgrabungen wurde festgestellt, dass diese Annahme auf einer Fehlinterpretation der gefundenen Hausfundamente beruhte und die Theiß-Kultur ganz im Gegensatz dazu über relativ große Häuser verfügte (etwa 16 bis 18 Meter lang).
Doch auch Grubenhäuser scheinen in der Theiß-Kultur als Wohnstätten genutzt worden zu sein, wenn auch nicht ausschließlich. So fand Korek in der Siedlung Kisköre-Damm 10 Gruben, die durchaus als Wohnstätte für Menschen gedient haben könnten. Vier dieser Gruben waren 10 – 12 m² groß (Abb. 2, Gruben 2, 3, 6, 8), die übrigen wiesen eine Größe von 20 – 22 m² auf (ebd. , 1, 4, 5, 7, 9, 10). Die größere Variante der Gruben entspricht von ihrer Fläche her ungefähr den normalen Häusern mit Satteldach, wie sie in der Theiß-Kultur vorkamen. Die Annahme, dass es sich bei diesen Gruben um Wohngruben gehandelt haben könnte, beruht vor allem auf der Tatsache, dass innerhalb dieser Gruben Hinweise auf Feuerstellen gefunden worden sind (Korek 1989, 50).
6.4 Bautechnik
Der Aufbau eines Hauses der Theiß-Kultur soll anhand eines Beispiels aus der Siedlung Hódmezővásárhely-Gorzsa erläutert werden. Der Hauskomplex 2 war, wie die meisten Häuser aus einer Holzkonstruktion und Lehmverputz errichtet, reine Lehmhäuser waren relativ selten. Die Tür war oft am südlichen Ende des Hauses eingebaut, wobei die meisten Häuser ins Südost-Nordwest-Orientierung erbaut worden waren (Kalicz 1998b, 310). So auch in Hódmezővásárhely-Gorzsa. Man kann dort auch erkennen, dass jedes Haus mehrere Feuerstellen hatte, oft auch mehr als eine in einem Raum. Einige dieser Feuerstellen waren gemauert. Auch eine der tönernen Vorratskisten lässt sich im südlichen Raum erkennen (Abb. 9 und Abb. 10) .
In Kisköre waren die gefundenen Häuser meist oval oder eckig und durch die gefundenen Pfostenlöcher konnte nachgewiesen werden, dass die Dachkonstruktion auf vier Pfosten ruhte. Innerhalb der Häuser wurden fast immer zwei Feuerstellen gefunden, eine davon war wohl als Kochstelle genutzt worden, während die andere als Heizung für das Haus fungierte (Korek 1989, 51).
Die Wände bestanden aus Pfosten, zwischen denen sich ein Schilf- und Rutengeflecht erstreckte. Dieses Geflecht wurde sowohl von Innen als auch von Außen mit Lehm verputzt. Dieser Lehmverputz wurde mit Ornamenten verziert. Diese zeigten für die Theiß-Kultur typische zoomorphe und anthropomorphe Motive. An den Giebeln einiger Häuser ließen sich Tierköpfe aus Ton nachweisen (Kalicz / Raczky 1990, 20 – 21 ). Das Dach war mit Stroh und Schilf gedeckt (Korek 1989, 51)
Die Fußböden in den Häusern konnten auf drei verschiedene Arten hergestellt worden sein. So finden sich leicht eingetiefte Fußböden, die einige Zentimeter unter der Oberfläche lagen. Außerdem wurden Häuser gefunden, in denen der Fußboden aus einer Art Lehmestrich hergestellt worden war. Die dritte Variante ist für den gesamten südosteuropäischen Raum typisch, etwa auch für die Vinča. Dabei wurde zunächst ein Holzfundament angelegt, auf dem dann eine Lehmschicht aufgebracht und festgestampft wurde (Kalicz / Raczky 1990, 20 – 21).
Die Wohngruben, die z.B. in Kisköre-Damm gefunden worden sind, wiesen einen gleichmäßigen Fußboden auf. Die Wände waren sehr steil und mit Lehm verputzt. Feuerstellen, die vor allem auf die Nutzung als Wohngrube hinweisen, waren entweder am Boden zu finden oder etwa in halber Höhe in einer Vertiefung in der Wand. Im Gegensatz zu den anderen Häusern wurden keine Pfostenlöcher gefunden, was auf eine andere Art von Dachkonstruktion hinweist (Korek 1989, 50).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet die Theiß-Kultur des Spätneolithikums?
Die Theiß-Kultur (5. Jt. v. Chr.) ist bekannt für ihre rituellen Gegenstände wie Gesichtsgefäße und bis zu 80 cm große Statuetten.
Wo war die Theiß-Kultur verbreitet?
Das Kerngebiet lag im östlichen Karpatenbecken, entlang der Theiß und ihrer Nebenflüsse im heutigen Ostungarn und Teilen Serbiens.
Wie sahen die Siedlungsstrukturen dieser Kultur aus?
Man unterscheidet echte Tell-Siedlungen (dichte Wohnhügel), tellartige Siedlungen und einschichtige Flachsiedlungen auf erhöhten Geländeabschnitten.
Wovon ernährten sich die Menschen der Theiß-Kultur?
Die Basis bildeten Ackerbau und Viehzucht, ergänzt durch Fischfang in den flussnahen Gebieten.
Welche Rolle spielten Handelsverbindungen?
Es bestanden weitreichende Kontakte von der Adria bis zum Schwarzen Meer, über die Güter wie Silex, Schmuck und erste Kupferobjekte getauscht wurden.
- Arbeit zitieren
- Julian Freche (Autor:in), 2010, Das Spätneolithikum im östlichen Karpatenbecken: Eine Übersicht über die Theiß-Kultur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/211306