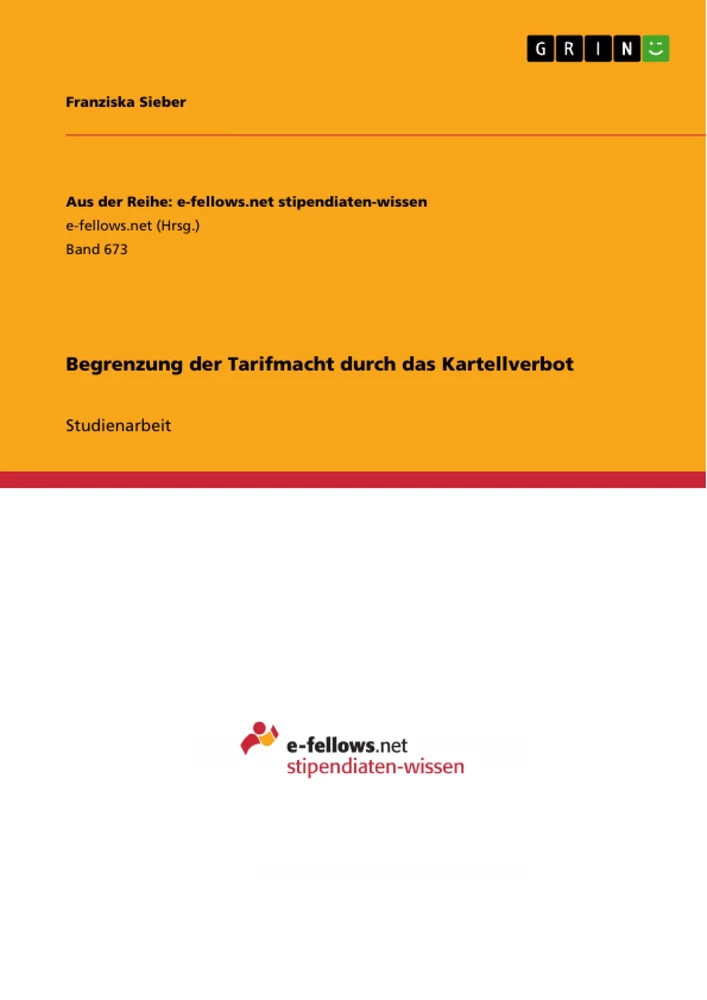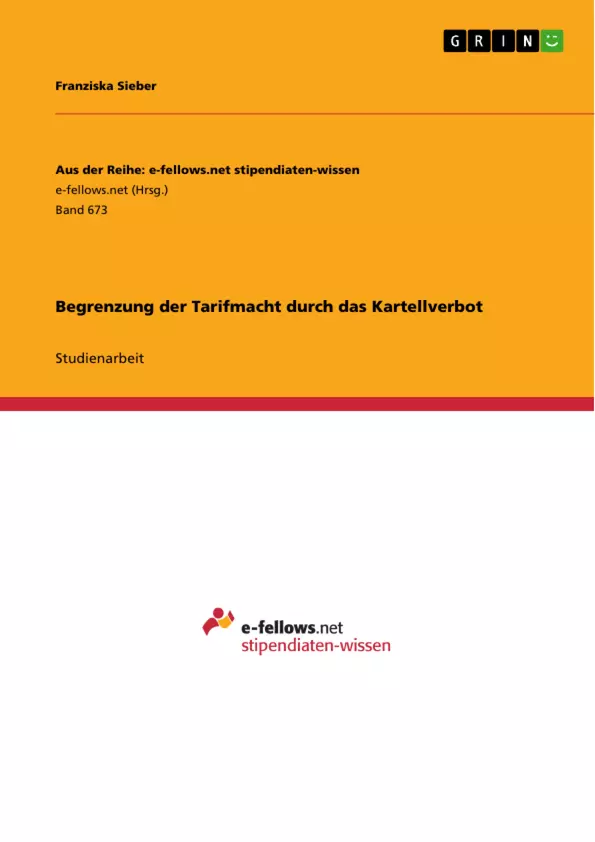Die Studienarbeit beschäftigt sich mit der bis heute umstrittenen
Frage, wie weit die Regeln des Wettbewerbsrechts auch auf den Arbeitsmarkt
Anwendung finden. Kennzeichnend für den Arbeitsmarkt ist eine strukturelle Unterlegenheit der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern. Deshalb hat der Verfassungsgeber in Art. 9 Abs. 3 GG eine Koalitionsbildung ermöglicht um Verhandlungsparität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern herzustellen. Dieses Gegenmachtprinzip soll hingegen auf dem Produktmarkt grundsätzlich nicht bestehen. Das Kartellrecht garantiert mit seinen Bestimmungen dafür, dass Einschränkungen des freien Wettbewerbs verhindert werden und die am Markt agierenden Rechtssubjekten selbst einen adäquaten Interessenausgleich durch Austauschverträge herstellen können (Wettbewerbsprinzip). Das Gegenmachtprinzip und das Wettbewerbsprinzip sind folglich keine Gegensätze, sondern verfolgen das gleiche Ziel: einen fairen, gegen Missbrauch gesicherten, privatautonomen Interessenausgleich.
Es kann jedoch zu Konflikten zwischen den beiden Ordnungsprinzipien kommen,
wenn die Ausübung der kollektiven Koalitionsfreiheit über den Arbeitsmarkt hinaus Auswirkungen auf den Produktmarkt hat und eine Anwendung des Wettbewerbsrechts durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) im Raum steht. Mögliche Einschränkungen der Tarifmacht können sich dabei durch eine Anwendbarkeit des Kartellverbots gem. Art. 101 AEUV, §§ 1, 2 GWB auf marktregelnde Tarifverträge, Absprachen im Bezug auf Tarifverhandlungen und den Bereich des Arbeitskampfes ergeben.
In einem ersten Schritt geht die Arbeit auf die verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Gewährleistungen der Tarifautonomie und des freien Wettbewerbs ein. Daraufhin wird im nächsten Abschnitt der Tatbestand des Art. 101 AEUV, §§ 1, 2 GWB darauf überprüft, ob Tarifverträge und andere Maßnahmen der Tarifvertragsparteien in Ausübung ihrer Tarifmacht überhaupt von dem Kartellverbot erfasst werden. Da dies, wie sich zeigen wird, zumindest teilweise der Fall ist, werden abschließend mögliche Lösungsvorschläge zur Auflösung des Konfliktes diskutiert und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Kollektive Koalitionsfreiheit und freier Wettbewerb im nationalen Recht und im Europarecht
1. Deutsche Rechtslage
2. Europäische Rechtslage
III. Beispielhafte Untersuchungsgegenstände
1. Regelungen über Ladenschlusszeiten in Tarifverträgen
2. Rationalisierungsschutzabkommen
3. Vorbesprechung der Arbeitgeber im Zuge von Tarifverhandlungen
4. Streikhilfeabkommen
IV. Tatbestandliche Anwendbarkeit des Kartellverbots gem. Art. 101 AEUV, §§1,2 GWB auf Tarifverträge
1. Unternehmensbegriff
a) Arbeitnehmer und Gewerkschaften
b) Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände
2. Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen
3. Bezwecken oder Bewirken einer spürbaren Wettbewerbsbeschränkung
4. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3,§ 2 GWB
5. Zwischenergebnis
V. Rechtfolgen einer Anwendbarkeit des Kartellverbots
VI. Mögliche Lösungsvorschläge
1. Geltungsvorrang des Kartellrechts oder des Arbeitsrechts
2. „Rule of Reason“
3. Ausnahmebereich Arbeitsmarkt
a) Geschützter Kernbereich der Koalitionsfreiheit
b) TVG als lex specialis
4. Stellungnahme
VII. Ergebnis
- Quote paper
- Franziska Sieber (Author), 2012, Begrenzung der Tarifmacht durch das Kartellverbot, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/211116