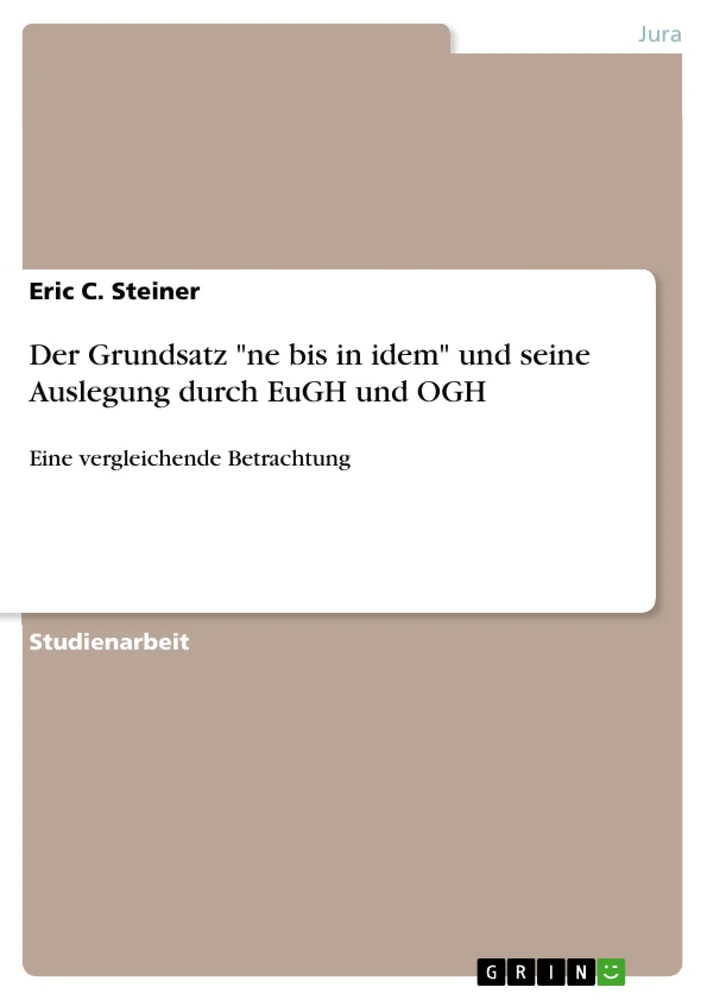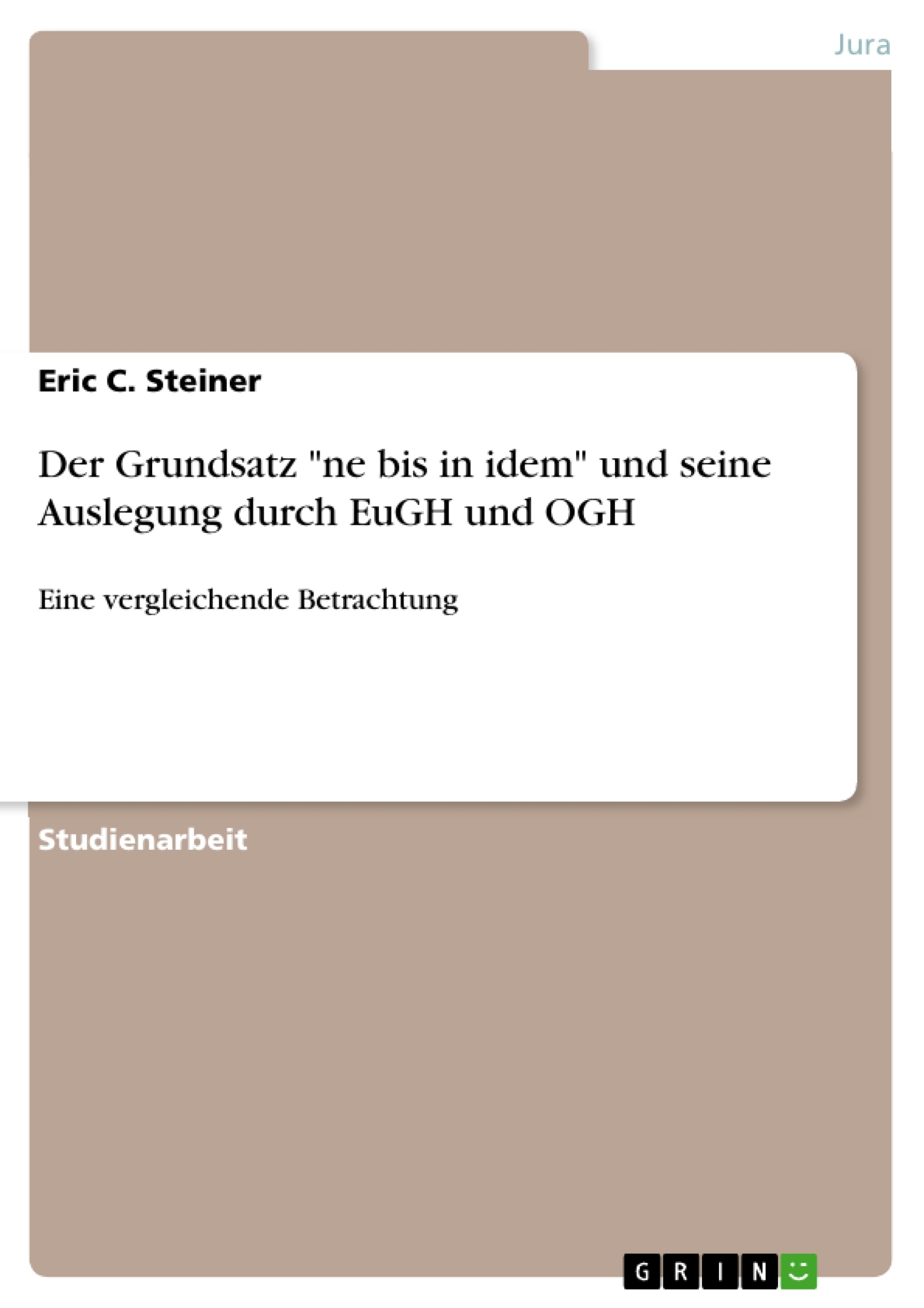Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit der unterschiedlichen Auslegung des Doppelbestrafungsverbotes („ne bis in idem“) durch den OGH und den EuGH.
Das Verbot der Doppelbestrafung war schon im 5. Jh. vC im attischen Recht bekannt, ebenso im römischen Recht und im Sachsenspiegel. Dieses fand 1791 als Grundfreiheit Eingang in die französische Verfassung, ebenso in das 5. Amendment der Verfassung der USA (als Verbot des „double jeopardy“).
Dieses Recht findet sich nicht in der EMRK selbst, sondern ist erst durch das 7. Zusatzprotokoll, welches durch Österreich ratifiziert wurde, aufgenommen worden. Durch erhebliche Auslegungsschwierigkeiten wird dieser Artikel in der Lehre oft auch als das „verflixte Siebente“ bezeichnet.
Dieses Recht dient dem Schutz des Normunterworfenen vor einem neuerlichen Strafverfahren, nachdem bereits ein Strafprozess durch einen Frei- oder Schuldspruch abgeschlossen wurde. Die Ziele des Doppelbestrafungsverbotes sind Rechtssicherheit und Berechenbarkeit der Strafjustiz. Diese „Sperrwirkung“ betrifft lediglich Strafen im Sinne des Art. 6 EMRK, also dem Recht auf ein faires Verfahren, nicht aber andere Sanktionen wie administrative Maßnahmen wie zB den Lenkberechtigungsentzug und Disziplinarmaßnahmen. Die rechtskräftige Aburteilung muss nicht vor einem Richter stammen, es kann sich durchaus auch um ein Urteil einer Verwaltungsbehörde handeln, da man darunter die förmliche Verhängung einer Strafe wegen eines rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens, mithin also auch eine rechtskräftige Strafverfügung oder ein solches Straferkenntnis, zB nach dem österreichischen Verwaltungsstrafgesetz - VStG, einer Verwaltungsstrafbehörde versteht. Auch ein Strafbefehl ist denkbar.
Selbst unter dem Begriff „Freispruch“ ist nicht bloß ein richterliches Urteil zu verstehen, sondern auch eine Verfahrenseinstellung einer Verwaltungsbehörde, sofern das Verfahren strafrechtlichen Charakter hatte. Sind Anklagefakten in Bezug auf die erfolge Verurteilung unwesentlich, sind sie durch das Urteil konsumiert. Der EuGH versteht darunter auch eine Verfahrenseinstellung der Ermittlungsbehörden (Staatsanwaltschaft) unter Auflagen, wenn darin eine Ahnung der Tat zu sehen ist und damit der staatliche Strafanspruch konsumiert ist.
Der EuGH legt also ein extensives Verständnis an den Art. 54 SDÜ an.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Rechtsordnungsinterne Bedeutung
- 1.2 Entscheidungen des OGH
- 2. Einheitlicher Rechtsraum in Europa
- 2.2 Das Verhältnis von Art. 54 SDÜ zu Art. 50 GRC
- 2.3 Voraussetzung und einheitliche Handhabung des Art. 54 SDÜ
- 3. Rechtskräftige Aburteilung
- 3.1 Der Tatbegriff des Art. 54 SDÜ
- 3.2 Das Vollstreckungselement des Art. 54 SDÜ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die unterschiedlichen Auslegungen des Doppelbestrafungsverbots („ne bis in idem“) durch den österreichischen Obersten Gerichtshof (OGH) und den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Sie analysiert die Rechtslage im nationalen und europäischen Kontext und beleuchtet die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen Rechtsraums in Europa bezüglich des Doppelbestrafungsverbots.
- Vergleichende Analyse der Auslegung des „ne bis in idem“-Grundsatzes durch OGH und EuGH
- Untersuchung der Rechtskraft und des Vollstreckungselements im Kontext des Doppelbestrafungsverbots
- Analyse des Verhältnisses zwischen nationalem und europäischem Recht (Art. 54 SDÜ und Art. 50 GRC)
- Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsraums in Bezug auf das Doppelbestrafungsverbot
- Die Rolle des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Doppelbestrafungsverbots („ne bis in idem“) ein und beschreibt den historischen Hintergrund sowie die Relevanz des Verbots für den Schutz des Einzelnen vor mehrfacher Strafverfolgung. Sie hebt die unterschiedlichen Auslegungen des Verbots durch den OGH und den EuGH hervor und deutet die daraus resultierenden Herausforderungen an. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Rechtssicherheit und Berechenbarkeit der Strafjustiz.
1. Rechtsordnungsinterne Bedeutung: Dieses Kapitel befasst sich mit der innerstaatlichen Bedeutung des „ne bis in idem“-Grundsatzes in Österreich. Es wird die Rechtsgrundlage in der österreichischen Strafprozessordnung (StPO) und im 7. Zusatzprotokoll zur EMRK erläutert. Der OGH wird vorgestellt und dessen Restriktionen im Hinblick auf die Anwendung des Doppelbestrafungsverbots bei pauschal individualisierten gleichartigen Taten werden beschrieben. Es wird diskutiert, welche Arten von Urteilen und Verfahrenseinstellungen als rechtskräftig gelten und somit das Doppelbestrafungsverbot auslösen.
2. Einheitlicher Rechtsraum in Europa: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen Rechtsraums in Europa in Bezug auf das Doppelbestrafungsverbot. Es werden der Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) und Artikel 50 der Grundrechtecharta der EU (GRC) im Detail untersucht und verglichen. Der Fokus liegt auf dem Unterschied zwischen der rein rechtsordnungsinternen Relevanz des nationalen „ne bis in idem“-Grundsatzes und dem Bestreben nach einem umfassenden transnationalen Grundsatz. Das Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit völkerrechtlicher Verträge zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten und Doppelbestrafungen im europäischen Kontext.
3. Rechtskräftige Aburteilung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der "rechtskräftigen Aburteilung" im Kontext des Art. 54 SDÜ. Es analysiert den Tatbegriff des Artikels und das damit verbundene "Vollstreckungselement". Der Unterschied in der Auslegung zwischen EuGH und OGH wird hervorgehoben und die Bedeutung der konkreten Ausgestaltung des Vollstreckungselements für die Anwendung des Doppelbestrafungsverbots wird erläutert. Das Kapitel beleuchtet, wie verschiedene Arten von Entscheidungen und Verfahrenseinstellungen (z.B. Strafbefehl, Verfahrenseinstellung unter Auflagen) in die Beurteilung der Rechtskraft einfließen.
Schlüsselwörter
ne bis in idem, Doppelbestrafungsverbot, EuGH, OGH, Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRC, 7. Zusatzprotokoll EMRK, Rechtskraft, Vollstreckung, Einheitlicher Rechtsraum, Transnationales Strafrecht, Strafprozessordnung (StPO), Pauschal individualisierte gleichartige Taten, Territorialitätsprinzip.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Doppelbestrafungsverbot ("ne bis in idem") im nationalen und europäischen Kontext
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die unterschiedlichen Auslegungen des Doppelbestrafungsverbots („ne bis in idem“) durch den österreichischen Obersten Gerichtshof (OGH) und den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Sie analysiert die Rechtslage im nationalen und europäischen Kontext und beleuchtet die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen Rechtsraums in Europa bezüglich des Doppelbestrafungsverbots.
Welche Rechtsquellen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert insbesondere Art. 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ), Art. 50 der Grundrechtecharta der EU (GRC), das 7. Zusatzprotokoll zur EMRK sowie die österreichische Strafprozessordnung (StPO).
Welche Themenschwerpunkte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich der Auslegung des „ne bis in idem“-Grundsatzes durch OGH und EuGH, die Untersuchung der Rechtskraft und des Vollstreckungselements im Kontext des Doppelbestrafungsverbots, die Analyse des Verhältnisses zwischen nationalem und europäischem Recht (Art. 54 SDÜ und Art. 50 GRC), die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsraums in Bezug auf das Doppelbestrafungsverbot und die Rolle des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, drei Hauptkapiteln und einem Abschnitt mit Schlüsselbegriffen. Kapitel 1 behandelt die rechtsordnungsinterne Bedeutung des Doppelbestrafungsverbots in Österreich. Kapitel 2 analysiert den einheitlichen Rechtsraum in Europa im Hinblick auf das Doppelbestrafungsverbot. Kapitel 3 befasst sich mit dem Begriff der "rechtskräftigen Aburteilung" im Kontext von Art. 54 SDÜ, insbesondere dem Tatbegriff und dem Vollstreckungselement.
Welche Rolle spielt der OGH in der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auslegung des Doppelbestrafungsverbots durch den OGH und vergleicht diese mit der Auslegung des EuGH. Es werden insbesondere die Restriktionen des OGH bei der Anwendung des Verbots bei pauschal individualisierten gleichartigen Taten beleuchtet.
Welche Rolle spielt der EuGH in der Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Auslegung des Doppelbestrafungsverbots durch den EuGH mit der des OGH. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Auslegung, insbesondere bezüglich des Vollstreckungselements von Art. 54 SDÜ.
Was versteht man unter "rechtskräftiger Aburteilung" im Kontext der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den Begriff der "rechtskräftigen Aburteilung" im Kontext von Art. 54 SDÜ und untersucht den Tatbegriff und das Vollstreckungselement dieses Artikels. Es wird beleuchtet, wie verschiedene Arten von Entscheidungen und Verfahrenseinstellungen (z.B. Strafbefehl, Verfahrenseinstellung unter Auflagen) in die Beurteilung der Rechtskraft einfließen.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Seminararbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: ne bis in idem, Doppelbestrafungsverbot, EuGH, OGH, Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRC, 7. Zusatzprotokoll EMRK, Rechtskraft, Vollstreckung, Einheitlicher Rechtsraum, Transnationales Strafrecht, Strafprozessordnung (StPO), Pauschal individualisierte gleichartige Taten, Territorialitätsprinzip.
Welche Herausforderungen werden im Hinblick auf einen einheitlichen europäischen Rechtsraum im Bereich des Doppelbestrafungsverbots diskutiert?
Die Seminararbeit beleuchtet die Herausforderungen bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsraums in Bezug auf das Doppelbestrafungsverbot, insbesondere die Notwendigkeit völkerrechtlicher Verträge zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten und Doppelbestrafungen im europäischen Kontext. Der Unterschied zwischen der rein rechtsordnungsinternen Relevanz des nationalen „ne bis in idem“-Grundsatzes und dem Bestreben nach einem umfassenden transnationalen Grundsatz wird analysiert.
- Arbeit zitieren
- Eric C. Steiner (Autor:in), 2010, Der Grundsatz "ne bis in idem" und seine Auslegung durch EuGH und OGH, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/210169