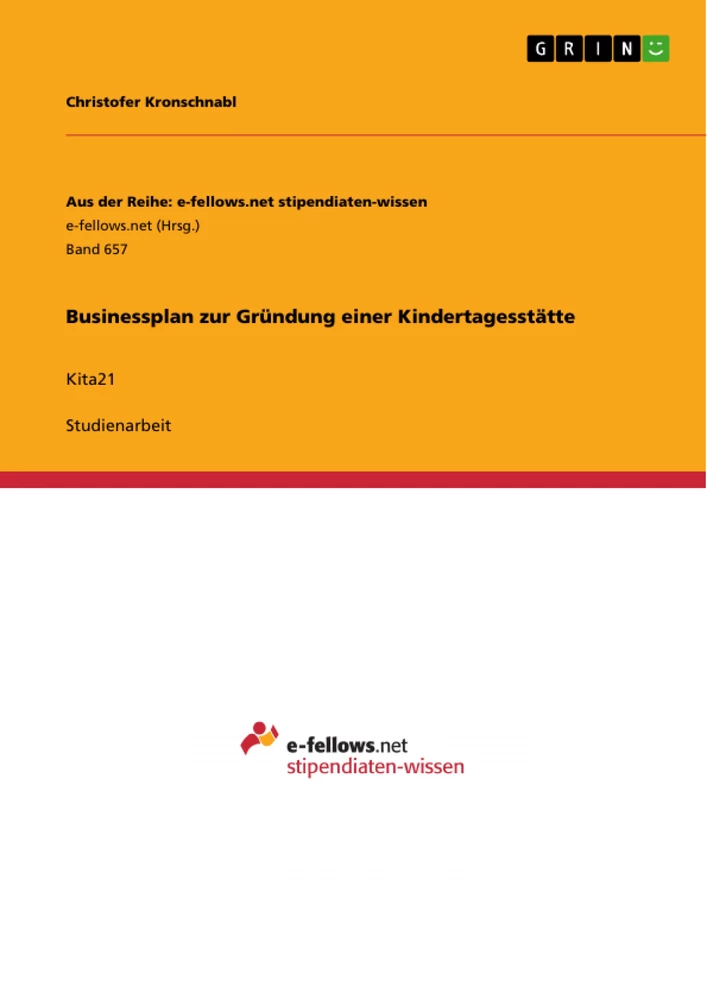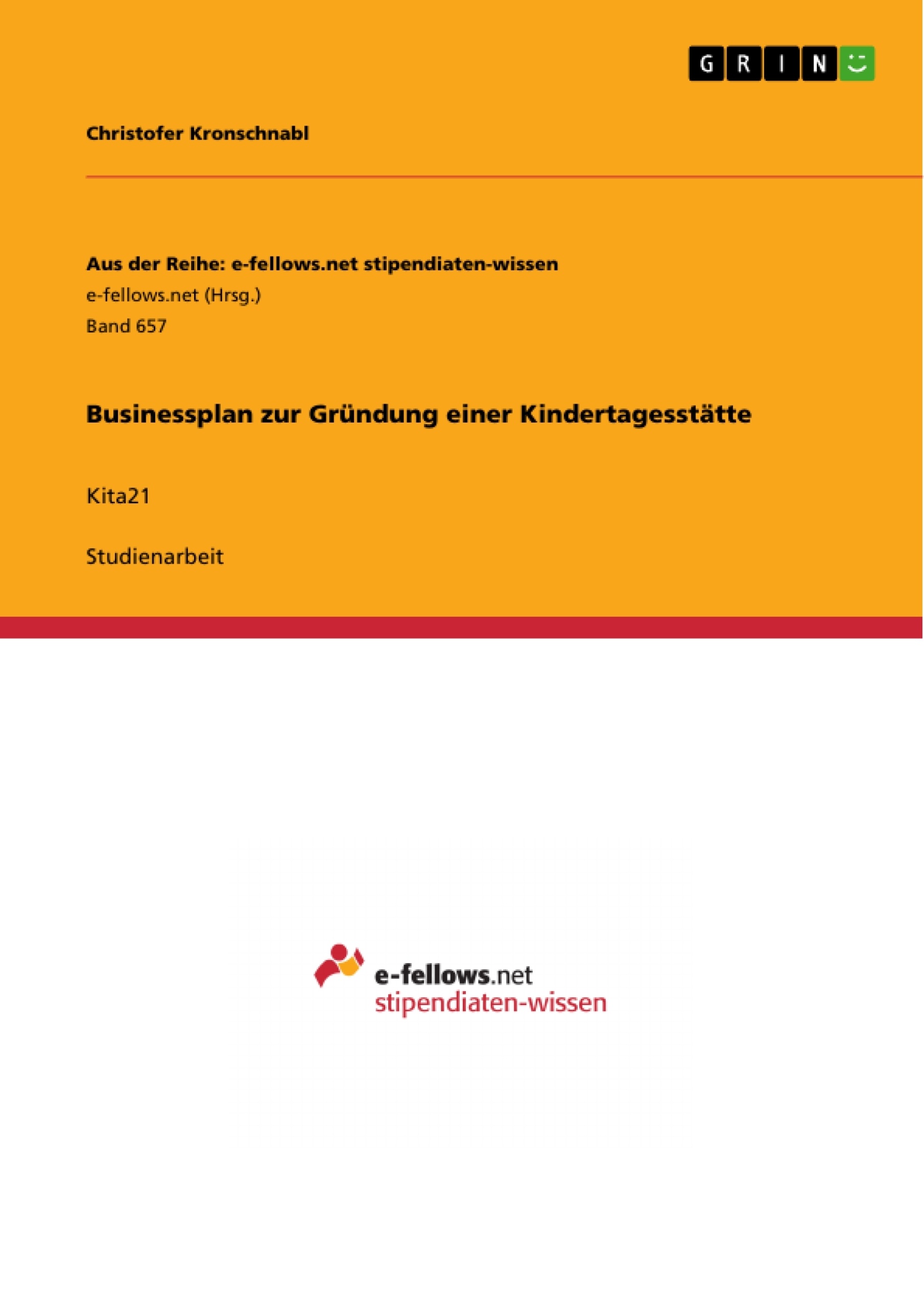Das Geschäftskonzept beschreibt die Gründung einer Kindertagesstätte mit der Verankerung sozialer und ökologischer Leitbilder. Die Kindertagesstätte richtet sich primär an einkommensstarke, junge Familien aus gehobenem Bildungsniveau. Gleichzeitig ist eine Quote festgelegt, die es sozial benachteiligten Familien erlaubt, ihre Kinder umsonst in die Ganztagsbetreuung zu geben.
Da es sich um eine Non-Profit-Organisation, also um eine Organisation ohne Gewinnabsicht handelt, werden Überschüsse zweckgebunden, wie z.B. für Weiterbildungsmaßnahmen der Kinderbetreuer oder eine Erhöhung der Förderquote sozial schwächer gestellter Kinder, verwendet. Die Management-Organisation ist einfach und mit flachen Hierarchien. Auf die Einstellung erfahrener Kinderbetreuer und Pädagogen wird Wert gelegt um eine hohe Betreuungsqualität zu erzielen. Diese bilden zugleich die Kernmannschaft des Teams.
Durch den sozio-ökologischen Fokus und die soziale Durchmischung grenzt sich diese Kita von den kirchlich und staatlich angebotenen Betreuungsstätten deutlich ab und bildet die bisher vom Markt nicht angebotene Lücke zwischen Waldkindergarten und minimalistischer Kinderbetreuung* der staatlichen Einrichtungen. Damit ist ein deutliches Alleinstellungsmerkmal vorhanden, welches im dem betrachteten Teilraum auf eine hohe Nachfrage stößt.
Bei der Standortwahl wurde ein strukturstarker Raum mit positiver demographischer Entwicklung gewählt. Zudem wurde darauf geachtet sowohl Kunden Zielgruppen, als auch die Gesellschaftsgruppe der sozialen Förderquote optimal zu erreichen. Dazu bietet der gewählte Standort, München Milbertshofen, den Vorteil, dass der Autor Sozialwissenschaftler * optimale Kenntnisse der sozio-ökonomischen Struktur des Teilraums hat. Gleiches gilt für den Mikrostandort (München-Milbertshofen). Dieser zeichnet sich neben den genannten Eigenschaften auch durch die gute Erreichbarkeit und die räumliche Nähe zu zahlreichen Industrieunternehmen und Dienstleistern aus.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung und Motivation
- Executive Summary
- Name und Logo
- Branchenüberblick und Alleinstellungsmerkmal der Kita21
- Marktanalyse
- Marketingplan
- Strategie und langfristige Ziele
- Management und Organisation
- Zeitplan
- Risiken und Konzeptschwächen
- Finanzplan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Businessplan beschreibt die Gründung der Kita21, einer Kindertagesstätte mit sozialem und ökologischem Fokus. Ziel ist die Schaffung einer qualitativ hochwertigen Betreuungseinrichtung, die sowohl einkommensstarken Familien als auch sozial benachteiligten Kindern Zugang ermöglicht. Die Kita21 soll sich durch ihr innovatives Konzept und ihr Alleinstellungsmerkmal von bestehenden Angeboten abheben.
- Gründung einer innovativen Kindertagesstätte
- Kombination von sozialer und ökologischer Verantwortung
- Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals im Markt
- Finanzplanung und Risikomanagement
- Soziale Inklusion und Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabenstellung und Motivation: Der Businessplan entstand im Rahmen eines Workshops zum betriebswirtschaftlichen Denken. Die gewählte Gründungsidee einer Kindertagesstätte resultiert aus deren hoher sozialpolitischer Relevanz und dem großen Bedarf an solchen Einrichtungen. Der Plan basiert teilweise auf realistischen Annahmen, da nicht zu allen Themen umfassendes Vorwissen vorhanden war.
Executive Summary: Das Geschäftskonzept der Kita21 beschreibt die Gründung einer Kindertagesstätte mit sozialem und ökologischem Fokus, die sich an einkommensstarke Familien richtet, aber gleichzeitig sozial benachteiligten Kindern kostenlose Betreuung ermöglicht. Als Non-Profit-Organisation werden Überschüsse zweckgebunden eingesetzt. Die Managementstruktur ist flach, und erfahrenes Personal soll eine hohe Betreuungsqualität gewährleisten. Durch die Kombination aus sozio-ökologischem Ansatz und sozialer Durchmischung hebt sich die Kita21 von bestehenden Angeboten ab und füllt eine Marktlücke.
Name und Logo: Der Name „Kita21“ und das dazugehörige Logo sollen die zukunftsweisende Ausrichtung der Kita auf Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit verdeutlichen. Der Bezug zur „Agenda 21“ unterstreicht den Non-Profit-Charakter. Das Logo mit Weltkugel und „21“ symbolisiert Nachhaltigkeit, Weltoffenheit und Interkulturalität. Es ist einfach, einprägsam und kostengünstig reproduzierbar.
Branchenüberblick und Alleinstellungsmerkmal der Kita21: Der Bedarf an Kindertagesstätten ist hoch, insbesondere in wirtschaftlich starken Regionen wie Süddeutschland. Die Kita21 hebt sich von den überwiegend staatlichen und kirchlichen Standardkonzepten durch ihren sozio-ökologischen Ansatz und die soziale Durchmischung ab. Dies schafft ein Alleinstellungsmerkmal und verspricht eine hohe Nachfrage.
Schlüsselwörter
Kindertagesstätte, Businessplan, Kita21, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, Non-Profit-Organisation, Marktanalyse, Alleinstellungsmerkmal, Finanzplanung, Risikomanagement, soziale Inklusion.
Kita21 Businessplan: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Kita21 Businessplan?
Der Businessplan beschreibt die Gründung der Kita21, einer innovativen Kindertagesstätte mit sozialem und ökologischem Fokus. Er beinhaltet Aufgabenstellung und Motivation, Executive Summary, Marktanalyse, Marketingplan, Strategie und langfristige Ziele, Management und Organisation, Zeitplan, Risiken und Konzeptschwächen, sowie einen Finanzplan und ein Fazit. Der Plan entstand im Rahmen eines Workshops zum betriebswirtschaftlichen Denken und basiert teilweise auf realistischen Annahmen.
Welche Ziele verfolgt die Kita21?
Die Kita21 zielt auf die Schaffung einer qualitativ hochwertigen Betreuungseinrichtung ab, die sowohl einkommensstarken Familien als auch sozial benachteiligten Kindern Zugang ermöglicht. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination von sozialer und ökologischer Verantwortung und die Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmals im Markt durch einen sozio-ökologischen Ansatz und soziale Durchmischung. Die Kita21 möchte soziale Inklusion und Chancengleichheit fördern.
Wie unterscheidet sich die Kita21 von anderen Kindertagesstätten?
Die Kita21 hebt sich durch ihren sozio-ökologischen Ansatz und die soziale Durchmischung von den überwiegend staatlichen und kirchlichen Standardkonzepten ab. Sie richtet sich an einkommensstarke Familien, bietet aber gleichzeitig sozial benachteiligten Kindern kostenlose Betreuung an. Als Non-Profit-Organisation werden Überschüsse zweckgebunden eingesetzt. Dieses Alleinstellungsmerkmal soll eine hohe Nachfrage gewährleisten.
Welche Kapitel umfasst der Businessplan?
Der Businessplan enthält folgende Kapitel: Aufgabenstellung und Motivation, Executive Summary, Name und Logo, Branchenüberblick und Alleinstellungsmerkmal der Kita21, Marktanalyse, Marketingplan, Strategie und langfristige Ziele, Management und Organisation, Zeitplan, Risiken und Konzeptschwächen, Finanzplan und Fazit. Jedes Kapitel fasst die relevanten Informationen zusammen.
Wie ist die Managementstruktur der Kita21?
Die Managementstruktur der Kita21 ist flach. Der Plan setzt auf erfahrenes Personal, um eine hohe Betreuungsqualität zu gewährleisten. Die Organisation soll effizient und effektiv sein, um die Ziele des Businessplans zu erreichen.
Welche Risiken und Konzeptschwächen werden im Businessplan angesprochen?
Der Businessplan benennt Risiken und Konzeptschwächen, die mit der Gründung und dem Betrieb der Kita21 verbunden sind. Die konkreten Risiken und Schwachstellen werden im entsprechenden Kapitel detailliert erläutert und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
Wie ist der Finanzplan der Kita21 aufgebaut?
Der Finanzplan beinhaltet eine detaillierte Darstellung der Einnahmen und Ausgaben der Kita21. Er umfasst Prognosen für die kommenden Jahre und berücksichtigt die Finanzierung der Einrichtung. Die Planung basiert auf realistischen Annahmen, jedoch mit Berücksichtigung möglicher Schwankungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Kita21 Businessplan?
Schlüsselwörter, die den Kita21 Businessplan beschreiben, sind: Kindertagesstätte, Businessplan, Kita21, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, Non-Profit-Organisation, Marktanalyse, Alleinstellungsmerkmal, Finanzplanung, Risikomanagement, und soziale Inklusion.
- Arbeit zitieren
- Christofer Kronschnabl (Autor:in), 2012, Businessplan zur Gründung einer Kindertagesstätte, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/210094