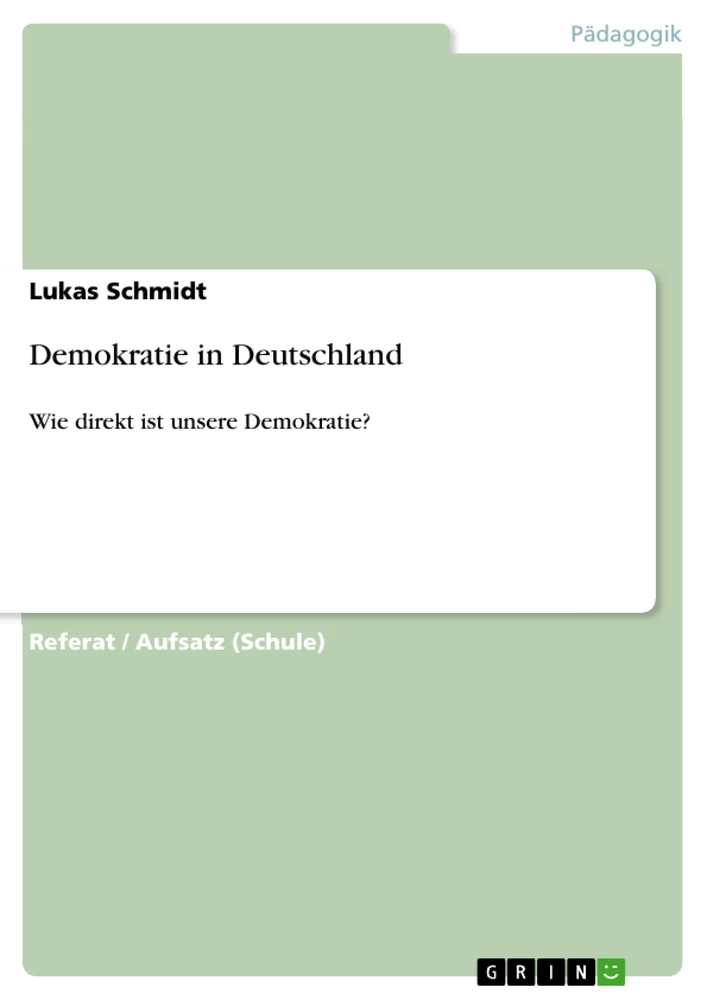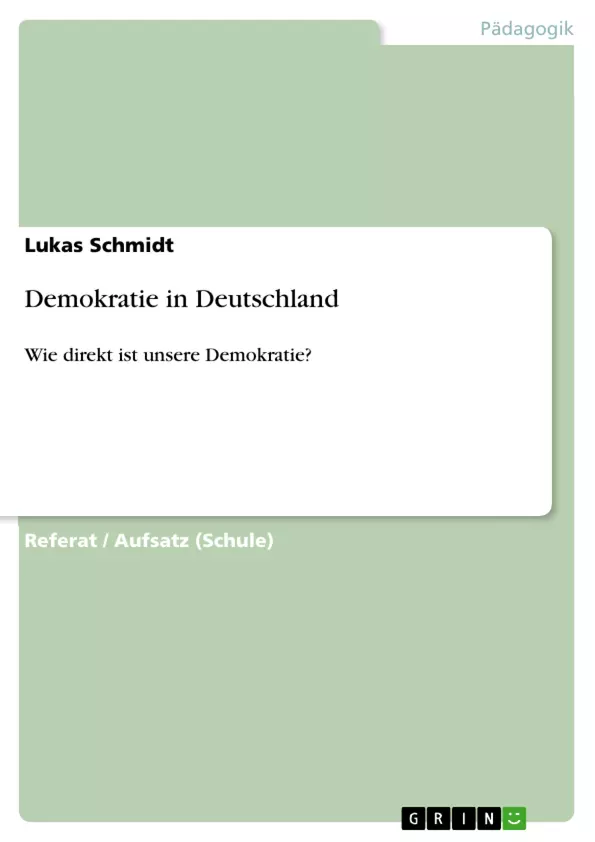Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie, bei der politische Entscheidungen von einem vom Volk gewählten Parlament getroffen werden. Durch das Verhältniswahlrecht sind Koalitionsbildungen nötig, die oft dazu führen, dass wichtige Bundesminister von Parteien gestellt werden, die nur die wenigsten der Wähler repräsentieren. Da Regierungen repräsentativer Demokratien nicht vom Volk direkt gewählt werden, sondern von einer Mehrheit des Parlamentes, sind die Regierungen von dem Vertrauen des Parlaments abhängig und müssen sich diesem gegenüber verantworten. Im Wahlrecht gibt es eine Sperrklausel von fünf Prozent, die dazu führt, dass nur die großen etablierten Parteien die Politik prägen.
„Deutschland ist weltweit die einzige Demokratie, in der von den drei Gewalten - der gesetzgeberischen Gewalt des Parlaments, der ausführenden Gewalt der Regierung und der kontrollierenden Gewalt der Gerichte - keine einzige durch das Volk allein bestimmt werden darf“.
Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, sollen die Teilnahme von Bürgern am politischen Leben fördern, zur Übernahme politischer Ämter motivieren und laut Parteiengesetz für eine „ständige, lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen“. Die Parteien tun sich schwer diese Aufgaben zu erfüllen. Politisch interessierte Bürger müssen sich ihnen anschließen oder werden weitestgehend ausgegrenzt. Seit den neunziger Jahren kämpfen alle etablierten Parteien (CDU, SPD, Grüne, FDP, CSU) mit einen Mitgliederschwund und einer sich vergrößernden Distanz zum Volk. Fast alle Parteien haben ein Großteil ihrer Wähler enttäuscht. Viele der Nichtwähler können sich weder an die Spitzenkandidaten der Union und SPD erinnern, noch wissen sie welche Parteien seit dem regieren. Trotzdem interessieren sich die Mehrheit von ihnen für die Politik. Das sie trotzdem nicht wählen liegt wohl an einer Parteienverdrossenheit.
Inhaltsverzeichnis
- Analyse der aktuellen Demokratie in Deutschland
- Das Wahlrecht und die Parteien
- Die Rolle der Medien
- Bürgerbeteiligung und politische Partizipation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die aktuelle Demokratie in Deutschland, untersucht die Herausforderungen des politischen Systems und beleuchtet die Rolle der Bürgerbeteiligung. Die Arbeit zielt darauf ab, Stärken und Schwächen des deutschen demokratischen Systems aufzuzeigen und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Das deutsche Parteiensystem und seine Herausforderungen
- Die Rolle der Medien in der politischen Meinungsbildung
- Die begrenzte politische Partizipation der Bürger
- Der Einfluss des Fraktionszwangs auf die Entscheidungsfindung
- Möglichkeiten zur Stärkung der direkten Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Analyse der aktuellen Demokratie in Deutschland: Dieser Abschnitt beschreibt die Bundesrepublik Deutschland als parlamentarische Demokratie und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem Verhältniswahlrecht und der Sperrklausel ergeben. Es wird hervorgehoben, dass keine der drei Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) allein vom Volk bestimmt wird, was zu einer Distanz zwischen Politik und Bevölkerung führt. Die zunehmende Parteienverdrossenheit und sinkende Wahlbeteiligung werden als Symptome einer demokratischen Krise dargestellt. Die begrenzte Möglichkeit der politischen Partizipation durch den vierjährigen Wahlrhythmus und den mangelnden Einfluss der Bürger auf Parteiprogramme werden ebenfalls thematisiert.
Das Wahlrecht und die Parteien: Dieses Kapitel analysiert das deutsche Parteiensystem und die Herausforderungen, denen es gegenübersteht. Der Mitgliederschwund der etablierten Parteien und die zunehmende Distanz zum Volk werden untersucht, ebenso wie die Enttäuschung vieler Wähler und Nichtwähler. Der Fraktionszwang wird kritisiert, da er die Abgeordneten an die Weisungen ihrer Partei bindet und somit die Repräsentation des Wählerwillens beeinträchtigt. Die mangelnde Transparenz bei der Gesetzgebung, insbesondere durch „Kuhhandel“ im Bundesrat, wird als Glaubwürdigkeitsverlust für die Parteien dargestellt. Es wird gezeigt, wie die Parteien oft im Interesse der Partei und nicht im Interesse des Wählers handeln.
Die Rolle der Medien: Hier wird die Rolle der Medien in der politischen Meinungsbildung beleuchtet und kritisiert. Die Fokussierung auf Skandale und die Kommerzialisierung der Medien führen zu einer Verzerrung der Berichterstattung und einer Scheinwirklichkeit in der Politik. Die Abhängigkeit von polarisierenden Schlagzeilen und die Einflussnahme durch Nähe zu bestimmten Parteien werden als problematisch dargestellt. Beispiele wie die mediale Darstellung von Karl-Theodor zu Guttenberg und Christian Wulff illustrieren die manipulative Kraft der Medien.
Bürgerbeteiligung und politische Partizipation: Dieses Kapitel analysiert die Unzufriedenheit der Bürger mit dem bestehenden System, die sinkende Wahlbeteiligung und die zunehmende Politikverdrossenheit. Es wird untersucht, inwiefern die Politik die Interessen des Volkes vertritt und wie das Gefühl der fehlenden Teilhabe zu einer Krise der Demokratie beiträgt. Der Erfolg extremistischer Parteien wird als Symptom einer mangelnden Repräsentation der breiten Bevölkerung dargestellt. Die Möglichkeit, die Mandate an die Wahlbeteiligung zu koppeln, wird als Lösungsansatz diskutiert, um Parteien zu einer höheren Wahlbeteiligung zu motivieren.
Schlüsselwörter
Parlamentarische Demokratie, Verhältniswahlrecht, Sperrklausel, Parteienverdrossenheit, Wahlbeteiligung, Fraktionszwang, Medien, politische Partizipation, direkte Demokratie, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbeteiligung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der aktuellen Demokratie in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die aktuelle Demokratie in Deutschland, untersucht die Herausforderungen des politischen Systems und beleuchtet die Rolle der Bürgerbeteiligung. Sie zeigt Stärken und Schwächen des deutschen demokratischen Systems auf und diskutiert mögliche Lösungsansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das deutsche Parteiensystem und seine Herausforderungen, die Rolle der Medien in der politischen Meinungsbildung, die begrenzte politische Partizipation der Bürger, den Einfluss des Fraktionszwangs auf die Entscheidungsfindung und Möglichkeiten zur Stärkung der direkten Demokratie. Konkret werden das Verhältniswahlrecht, die Sperrklausel, Parteienverdrossenheit, sinkende Wahlbeteiligung, die Medienlandschaft und deren Einfluss auf die politische Meinungsbildung sowie die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Analyse der aktuellen Demokratie in Deutschland, zum Wahlrecht und den Parteien, zur Rolle der Medien und zur Bürgerbeteiligung und politischen Partizipation. Jedes Kapitel analysiert einen spezifischen Aspekt des deutschen demokratischen Systems und dessen Herausforderungen.
Wie wird die aktuelle Demokratie in Deutschland analysiert?
Die Analyse beschreibt die Bundesrepublik Deutschland als parlamentarische Demokratie und beleuchtet Herausforderungen, die sich aus dem Verhältniswahlrecht und der Sperrklausel ergeben. Sie hebt die Distanz zwischen Politik und Bevölkerung hervor, die aus der Tatsache resultiert, dass keine der drei Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) allein vom Volk bestimmt wird. Zunehmende Parteienverdrossenheit und sinkende Wahlbeteiligung werden als Symptome einer demokratischen Krise dargestellt. Die begrenzte Möglichkeit der politischen Partizipation wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird das deutsche Parteiensystem analysiert?
Das Kapitel analysiert den Mitgliederschwund der etablierten Parteien, die zunehmende Distanz zum Volk, die Enttäuschung vieler Wähler und Nichtwähler und den Fraktionszwang, der die Abgeordneten an die Weisungen ihrer Partei bindet und somit die Repräsentation des Wählerwillens beeinträchtigt. Die mangelnde Transparenz bei der Gesetzgebung und das Handeln der Parteien im Interesse der Partei anstatt im Interesse des Wählers werden ebenfalls kritisiert.
Welche Rolle spielen die Medien laut der Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet und kritisiert die Rolle der Medien in der politischen Meinungsbildung. Die Fokussierung auf Skandale und die Kommerzialisierung der Medien führen zu einer Verzerrung der Berichterstattung und einer Scheinwirklichkeit in der Politik. Die Abhängigkeit von polarisierenden Schlagzeilen und die Einflussnahme durch Nähe zu bestimmten Parteien werden als problematisch dargestellt. Beispiele wie die mediale Darstellung von Karl-Theodor zu Guttenberg und Christian Wulff illustrieren die manipulative Kraft der Medien.
Wie wird die Bürgerbeteiligung und politische Partizipation behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Unzufriedenheit der Bürger mit dem bestehenden System, die sinkende Wahlbeteiligung und die zunehmende Politikverdrossenheit. Es untersucht, inwiefern die Politik die Interessen des Volkes vertritt und wie das Gefühl der fehlenden Teilhabe zu einer Krise der Demokratie beiträgt. Der Erfolg extremistischer Parteien wird als Symptom einer mangelnden Repräsentation der breiten Bevölkerung dargestellt. Die Möglichkeit, die Mandate an die Wahlbeteiligung zu koppeln, wird als Lösungsansatz diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Parlamentarische Demokratie, Verhältniswahlrecht, Sperrklausel, Parteienverdrossenheit, Wahlbeteiligung, Fraktionszwang, Medien, politische Partizipation, direkte Demokratie, Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbeteiligung.
- Quote paper
- Lukas Schmidt (Author), 2012, Demokratie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/208908