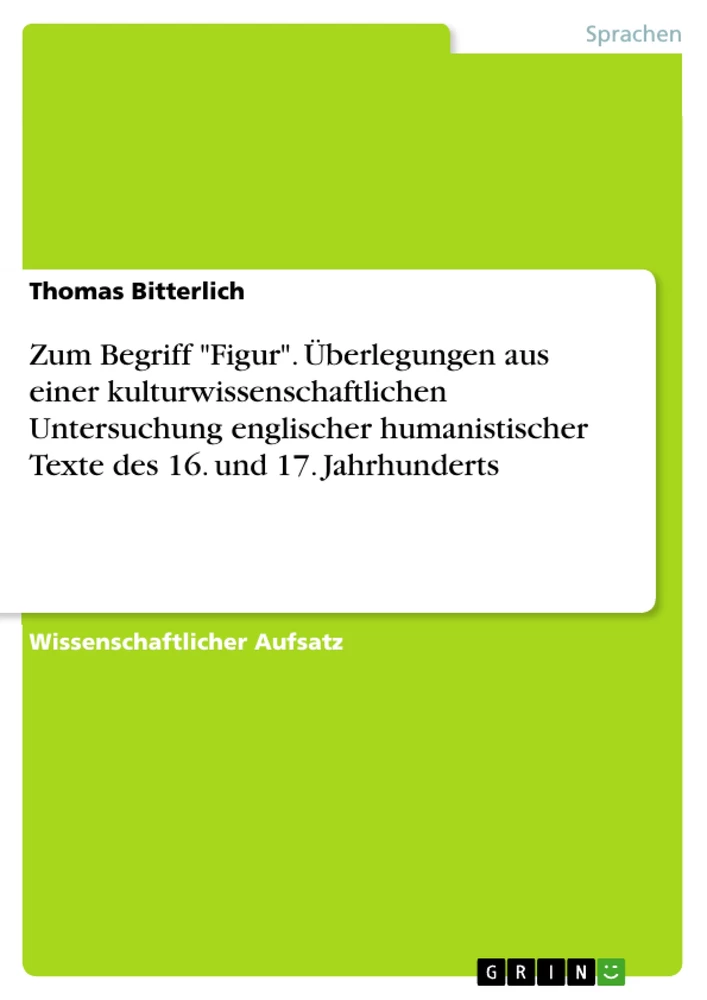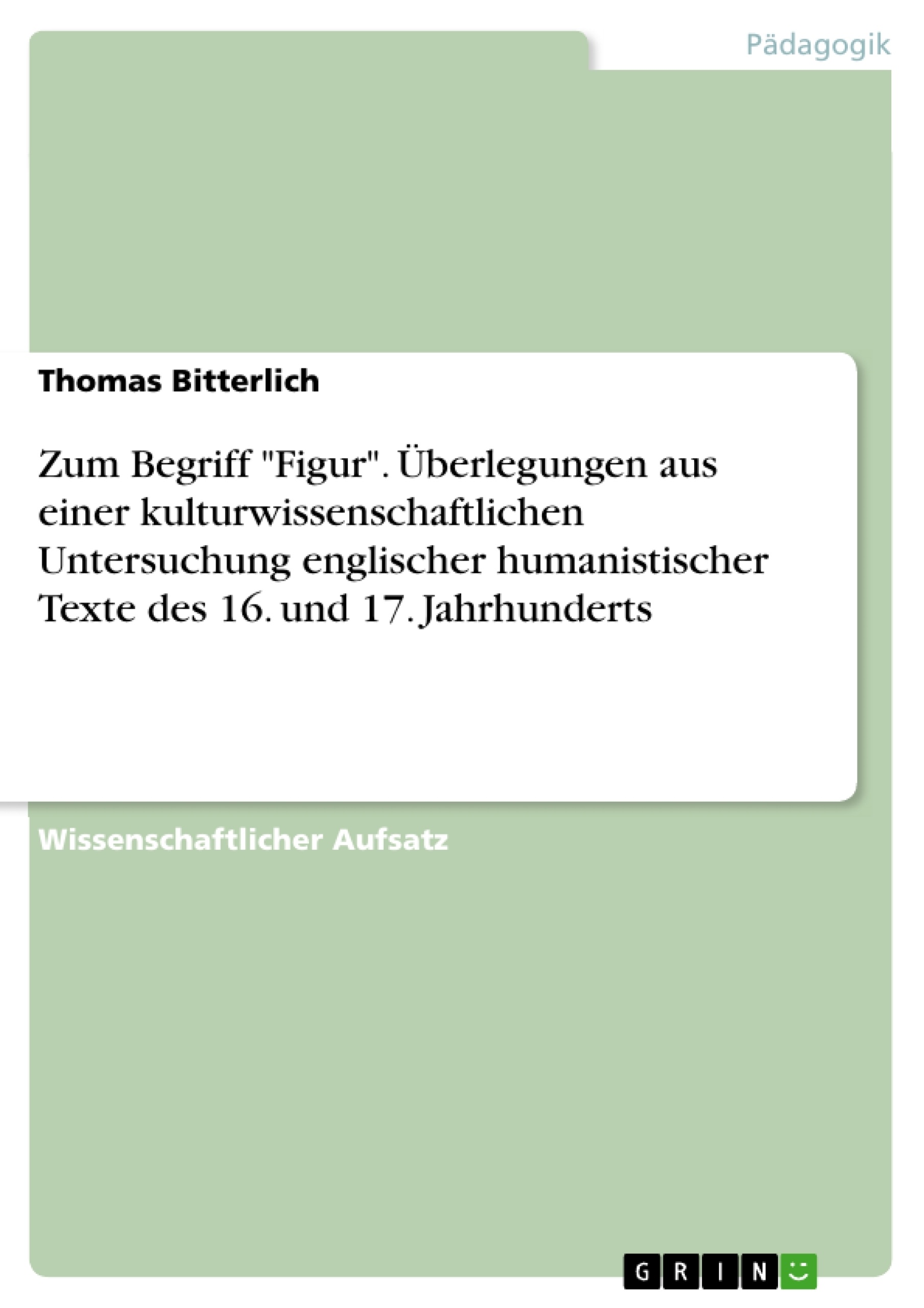Aus dramaturgischer Perspektive verstehe ich die Figur als ein Element eines Verfahrens, durch das Wissen in einem Text - so die vorläufige Definition - konstruiert, formuliert und manifestiert wird. Dessen Gestaltung ist als Repräsentation der Mimesis im antiken Sinne zu verstehen und dient der Vergegenwärtigung und Präsentation von Wissen. Dieser Vorgang ist als Wiederholung des Bestehenden und als erneute Schöpfung zu betrachten. Die Figur als ein spezifisches Wissen in Texten kann nur bedingt als Einheit und geschlossenes Ganzes verstanden werden. Meine Analyse zielt nicht auf die Beschreibung der Figur als äußere Gestalt, sondern auf ihre Konstruktion im Schnittpunkt verschiedener Diskurse.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff der Figur
- Theoretische Bestimmung des Begriffs „Figur“
- Der Begriff „Prosopopöie“
- „Prosopopöie“ als semiotischer Prozess
- Methodische Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff „Figur“ im Kontext englischer humanistischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts. Das Hauptziel besteht darin, den Begriff „Figur“ als Ansatz zu entwickeln, um die Manifestation von Wissen in einer „Gestalt“ zu begreifen, analysieren und darstellen zu können. Die Arbeit beleuchtet die Verwendung der Figur „WIT“ in Texten der englischen Renaissance.
- Theoretische Bestimmung des Begriffs „Figur“
- Der Begriff „Prosopopöie“ als differenzierte Antwort auf die Frage: Wer spricht?
- „Prosopopöie“ als Darstellungsverfahren: Wie wird gesprochen?
- „Figur“ als Nebeneinander verschiedener Wissensformen und als Verbindung von altem und neuem Wissen
- Methodische Konsequenzen für die Analyse von Figuren
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Begriff der Figur: Dieses Kapitel legt die Grundlage für die gesamte Arbeit, indem es den Begriff „Figur“ einführt und verschiedene Zugänge zu seiner Bestimmung diskutiert. Es werden historische und theoretische Perspektiven vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit miteinander verbunden werden. Der Autor betont die Bedeutung des Begriffs für die Manifestation von Wissen in Texten und grenzt seinen eigenen Ansatz von verbreiteten Auffassungen ab, die den Begriff stark an die Gestalt des menschlichen Körpers binden.
Theoretische Bestimmung des Begriffs „Figur“: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung des Figurenbegriffs. Ausgehend von einer dramaturgischen Perspektive wird die Figur als Element eines Verfahrens verstanden, durch das Wissen in Texten konstruiert und manifestiert wird. Die Gestaltung der Figur wird als Repräsentation oder Mimesis im antiken Sinne interpretiert. Der Autor betont, dass die Figur als spezifisches Wissen in Texten nur bedingt als Einheit und geschlossenes Ganzes verstanden werden kann und seine Analyse sich auf die Konstruktion der Figur im Schnittpunkt verschiedener Diskurse konzentriert.
Der Begriff „Prosopopöie“: Hier wird der Begriff „Prosopopöie“ als zentrale analytische Kategorie eingeführt. Der Autor diskutiert die Begriffsgeschichte und -bestimmung von „Prosopopöie“, um die verschiedenen Dimensionen des Verfahrens der Figuration zu veranschaulichen. Er unterscheidet seinen Gebrauch des Begriffs von der traditionellen Verwendung in der Rhetorik und betrachtet ihn als Tropus, als einen Modus der Darstellung und Rezeption, der die Wahrnehmung des gesamten Textes prägt. Anhand von Henry Peachams Definition wird das Bedeutungsspektrum des Begriffs bezüglich der Frage "Wer spricht?" dargestellt.
„Prosopopöie“ als semiotischer Prozess: In diesem Abschnitt wird „Prosopopöie“ als semiotischer Prozess verstanden, in dem ein Bezeichnetes mit einem Zeichen verknüpft wird, wobei das Ergebnis dieser Verknüpfung eine Figur ist. Der Autor stützt sich auf die Arbeit von James J. Paxon, der verschiedene Fälle der Figuration typologisiert, um das komplexe Verhältnis zwischen „personified“ und „personifier“ zu verdeutlichen. Die Analyse betont, dass eine Figur Wissen aus verschiedenen Diskursen zusammenführt und eine Einheit von Vielfalt darstellt.
Schlüsselwörter
Figur, Prosopopöie, Wissen, Repräsentation, Mimesis, Humanismus, englische Renaissance, Diskurs, Textanalyse, Semiotik, Figuration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Figurenbegriffs in englischen humanistischen Texten des 16. und 17. Jahrhunderts
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff „Figur“ in englischen humanistischen Texten des 16. und 17. Jahrhunderts. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines Ansatzes, um die Manifestation von Wissen in einer „Gestalt“ zu begreifen, analysieren und darstellen zu können. Ein besonderer Fokus liegt auf der Figur „WIT“ in Texten der englischen Renaissance.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene theoretische Konzepte, darunter die dramaturgische Perspektive auf die Figur als Element eines Verfahrens zur Wissenskonstruktion, die Interpretation der Figurengestaltung als Repräsentation oder Mimesis im antiken Sinne und die semiotische Betrachtung von „Prosopopöie“ als Prozess der Verknüpfung von Bezeichnetem und Zeichen. Der Ansatz geht über verbreitete Auffassungen hinaus, die den Figurenbegriff stark an den menschlichen Körper binden.
Welche Rolle spielt der Begriff „Prosopopöie“?
„Prosopopöie“ wird als zentrale analytische Kategorie eingeführt und als differenzierte Antwort auf die Frage „Wer spricht?“ verstanden. Die Arbeit beleuchtet die Begriffsgeschichte, unterscheidet den eigenen Gebrauch von der traditionellen rhetorischen Verwendung und betrachtet „Prosopopöie“ als Tropus, Darstellungs- und Rezeptionsmodus, der die Wahrnehmung des gesamten Textes prägt. Es wird untersucht, wie „Prosopopöie“ Wissen aus verschiedenen Diskursen zusammenführt und eine Einheit von Vielfalt darstellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit dem Begriff der Figur, seiner theoretischen Bestimmung, dem Begriff „Prosopopöie“, „Prosopopöie“ als semiotischem Prozess und den methodischen Konsequenzen befassen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Aspekt, wobei historische und theoretische Perspektiven verbunden werden. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die einzelnen Kapitel.
Welche methodischen Konsequenzen werden gezogen?
Die Arbeit entwickelt methodische Konsequenzen für die Analyse von Figuren, die sich aus der theoretischen Fundierung des Figurenbegriffs und der Betrachtung von „Prosopopöie“ als semiotischem Prozess ergeben. Diese Konsequenzen sind auf die Analyse der Konstruktion der Figur im Schnittpunkt verschiedener Diskurse ausgerichtet und berücksichtigen die komplexe Natur der Figur als Einheit von Vielfalt und spezifischem Wissen im Text.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Figur, Prosopopöie, Wissen, Repräsentation, Mimesis, Humanismus, englische Renaissance, Diskurs, Textanalyse, Semiotik, Figuration.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Literaturwissenschaft, insbesondere der englischen Literatur der Renaissance, sowie für alle, die sich mit Fragen der Textanalyse, der Semiotik und der Wissensrepräsentation beschäftigen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Text der Arbeit, der die detaillierten Analysen und Argumentationen enthält.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Thomas Bitterlich (Autor:in), 2011, Zum Begriff "Figur". Überlegungen aus einer kulturwissenschaftlichen Untersuchung englischer humanistischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/208770