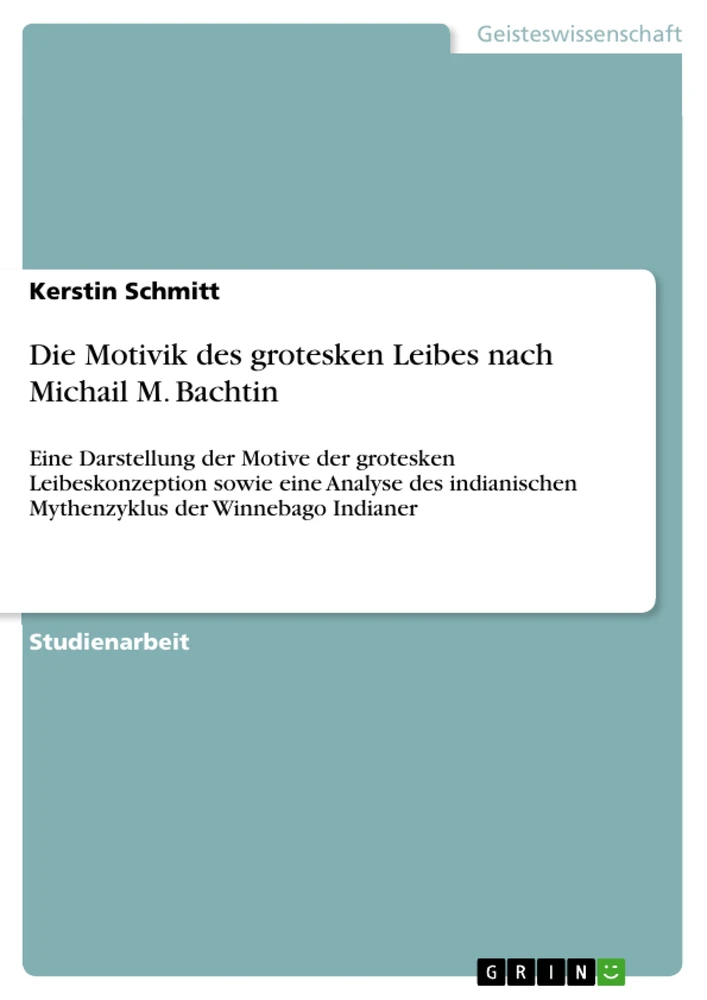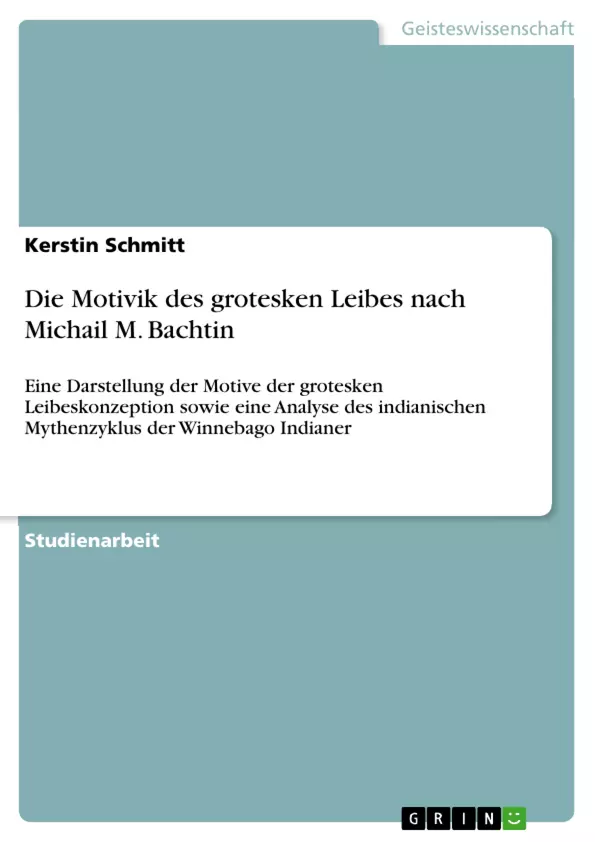Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Merkmalen und Motiven der grotesken Leibeskonzeption des russischen Literaturwissenschaftlers, Semiologen und Kulturtheoretikers Michail M. Bachtin. Zentral untersucht werden dabei die sechs Quellen des grotesken Leibes: die Riesenlegenden, die Wunder Indiens, die Mysterienspiele, der christliche Reliquienkult, die Marktplatzkomik sowie der Sprachgebrauch des Mittelalters und die hippokratische Schriftensammlung. Diese Quellen benutzt Bachtin in seiner Abhandlung Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur um an François Rabelais Roman Gargantua und Pantagruel die groteske Leibeskonzeption zu manifestieren. Innerhalb dieser Hausarbeit dienen die Rabelaisschen Quellen als Grundlage zur Hervorhebung, Verdeutlichung und Vorstellung von Motiven des grotesken Leibes wie exemplarisch Hyperbolisierung, Offenheit, Zweileibigkeit , Verspottung, Überindividualität bzw. Kollektivität, Mischkörperlichkeit, Anatomisierung, Zerstückelung, Reisen zwischen den Welten (Leben und Tod), Lazzi, Ausscheidungen und Ausdünstungen von Körpersäften und Weiteren mehr.
Im Verlauf dieser Hausarbeit soll nachgewiesen werden, dass die Leibeskonzeption mythischer Figuren, spezifischer gesagt die des Tricksters, eine groteske ist. Um diese These zu verifizieren, werden drei Episoden des indianischen Mythenzykluses der Winnebago Indianer mit der Gestalt des Wakdjũnkaga anhand der zuvor erarbeiteten Motiven der Rabelaisschen Quellen des grotesken Leibes hin analysiert. Die Untersuchung der Episoden des indianischen Mythenzyklus zeigt exemplarisch Motive des grotesken Leibes auf [...]. Diese Analyse soll die Funktion und das Verständnis des grotesken Leibes für Wakdjũnkaga als Trickster aufzeigen.
Abschließend resümiert der Ausblick die dargelegte Argumentation und skizziert daraus resultierend die Thematik des grotesken Leibes als Kunstmittel bzw. Zugang des Erzählers zu den mythischen Erzählstoffen. In jenem Kapitel liegt der Versuch einer Einordnung des grotesken Leibes als Zugang/ Kunstmittel/ Kunstgriff in die Erzählkunst der mythischen Figuren/ Trickster vor. Der groteske Leib wird anhand eines skizzierten Schemas – zur Vermittlung der Funktion der traditionellen Schauspielkunst – systematisiert. Dieses Schema soll die Beziehung des Akteurs, der Kunstfigur und der diversen Rollen verdeutlichen und eine Brücke schlagen in unsere Zeit. Ersichtlich werden dabei (Über-)Reste und Praktiken, welche bis heute überleben (können).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die groteske Leibeskonzeption nach Michail Bachtin – Eine Einführung
- Quelle 1: Die Riesenlegenden
- Quelle 2: Die Wunder Indiens
- Quelle 3: Mittelalterliche Mysterienspiele
- Quelle 4: Der (christliche) Reliquienkult
- Quelle 5: Marktplatzkomik und Sprachgebrauch des Mittelalters: Schwüre, Flüche, Schimpfworte
- Quelle 6: Die Hippokratische Schriftensammlung
- Der göttliche Schelm namens Wakdjunkaga – Eine Einführung
- Analyse der 14ten Episode: Der Schelm versengt sich den After und isst seine eigenen Eingeweide
- Analyse der 15ten Episode: Der Penis wird in einen Kasten verpackt
- Analyse der 23ten Episode: Die Abführzwiebel
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die groteske Leibeskonzeption nach Michail Bachtin und deren Anwendung auf den indianischen Mythenzyklus der Winnebago Indianer. Ziel ist es, die Motive des grotesken Leibes in Bachtins Quellen zu identifizieren und diese dann mit der Figur des Tricksters Wakdjunkaga zu vergleichen.
- Die groteske Leibeskonzeption nach Michail Bachtin
- Analyse der Rabelaisschen Quellen des grotesken Leibes
- Der groteske Leib als Merkmal mythischer Figuren (Trickster)
- Vergleichende Analyse von Episoden des Winnebago-Mythenzyklus
- Der groteske Leib als Kunstmittel in der Erzählkunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die groteske Leibeskonzeption Bachtins anhand von sechs Quellen und analysiert drei Episoden des Winnebago-Mythenzyklus um die These zu belegen, dass die Leibeskonzeption mythischer Figuren, insbesondere des Tricksters, grotesk ist. Der Ausblick soll die Argumentation zusammenfassen und den grotesken Leib als Kunstmittel in der Erzählkunst einordnen.
Die groteske Leibeskonzeption nach Michail Bachtin – Eine Einführung: Dieses Kapitel führt in Bachtins Konzept des grotesken Leibes ein, wobei der Unterschied zwischen „Leib“ und „Körper“ betont wird. Es werden die sechs Quellen Bachtins (Riesenlegenden, Wunder Indiens, Mysterienspiele, christlicher Reliquienkult, Marktplatzkomik und hippokratische Schriftensammlung) vorgestellt, die als Grundlage zur Illustration der Motive des grotesken Leibes dienen. Das Kapitel hebt die Bedeutung des Karnevals für Bachtins Theorie hervor und weist auf die literaturwissenschaftliche Perspektive Bachtins hin.
Der göttliche Schelm namens Wakdjunkaga – Eine Einführung: Dieses Kapitel analysiert drei Episoden aus dem Winnebago-Mythenzyklus, in denen der Trickster Wakdjunkaga auftritt. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie die in den vorherigen Kapiteln erarbeiteten Motive des grotesken Leibes (Offenheit des Leibes, Ablösung von Körperteilen, überdimensionales Genital etc.) in diesen Episoden zum Ausdruck kommen und welche Funktion der groteske Leib für Wakdjunkaga als Trickster hat. Die drei Episoden dienen als exemplarische Belege für die These der Arbeit.
Schlüsselwörter
Grotesker Leib, Michail Bachtin, Rabelais, Winnebago-Indianer, Wakdjunkaga, Trickster, Mythenzyklus, Volkskultur, Karneval, Körperkonzeption, Hyperbolisierung, Offenheit, Zweileibigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Groteske Leibeskonzeption und der Winnebago-Trickster Wakdjunkaga
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die groteske Leibeskonzeption nach Michail Bachtin und deren Anwendung auf den indianischen Mythenzyklus der Winnebago-Indianer. Im Fokus steht ein Vergleich der Motive des grotesken Leibes in Bachtins Quellen mit der Figur des Tricksters Wakdjunkaga.
Welche Quellen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert sechs Quellen, die Michail Bachtin für seine Theorie der grotesken Leibeskonzeption heranzieht: Riesenlegenden, Wunder Indiens, mittelalterliche Mysterienspiele, den christlichen Reliquienkult, die Marktplatzkomik und den Sprachgebrauch des Mittelalters (Schwüre, Flüche, Schimpfworte) sowie die hippokratische Schriftensammlung. Darüber hinaus werden drei Episoden aus dem Winnebago-Mythenzyklus um den Trickster Wakdjunkaga untersucht (Episode 14, 15 und 23).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Bachtins Konzept des grotesken Leibes, die Analyse der rabelaisischen Quellen des grotesken Leibes, der groteske Leib als Merkmal mythischer Figuren (insbesondere des Tricksters), ein vergleichende Analyse von Episoden des Winnebago-Mythenzyklus und der groteske Leib als Kunstmittel in der Erzählkunst.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur grotesken Leibeskonzeption nach Bachtin mit der Analyse seiner Quellen, ein Kapitel zur Analyse von drei Episoden des Winnebago-Mythenzyklus mit der Figur Wakdjunkaga und einen Ausblick. Die Einleitung gibt einen Überblick über die Zielsetzung und die These der Arbeit. Der Ausblick fasst die Argumentation zusammen und ordnet den grotesken Leib als Kunstmittel in der Erzählkunst ein.
Welche zentralen Motive des grotesken Leibes werden untersucht?
Die Arbeit untersucht zentrale Motive des grotesken Leibes nach Bachtin, wie die Offenheit des Leibes, die Ablösung von Körperteilen und ein überdimensionales Genital. Diese Motive werden sowohl in Bachtins Quellen als auch in den ausgewählten Episoden des Winnebago-Mythenzyklus analysiert.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die These, dass die Leibeskonzeption mythischer Figuren, insbesondere des Tricksters, grotesk ist. Dies wird anhand des Vergleichs von Bachtins Konzept des grotesken Leibes und der Figur des Wakdjunkaga im Winnebago-Mythenzyklus belegt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grotesker Leib, Michail Bachtin, Rabelais, Winnebago-Indianer, Wakdjunkaga, Trickster, Mythenzyklus, Volkskultur, Karneval, Körperkonzeption, Hyperbolisierung, Offenheit, Zweileibigkeit.
- Quote paper
- Kerstin Schmitt (Author), 2011, Die Motivik des grotesken Leibes nach Michail M. Bachtin , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/206751