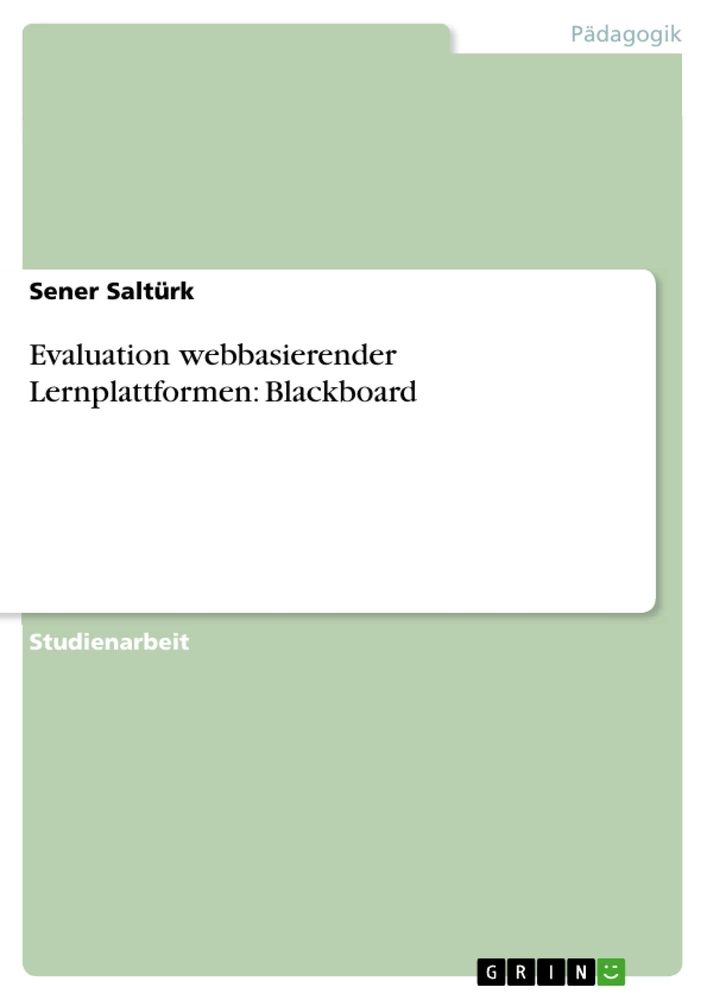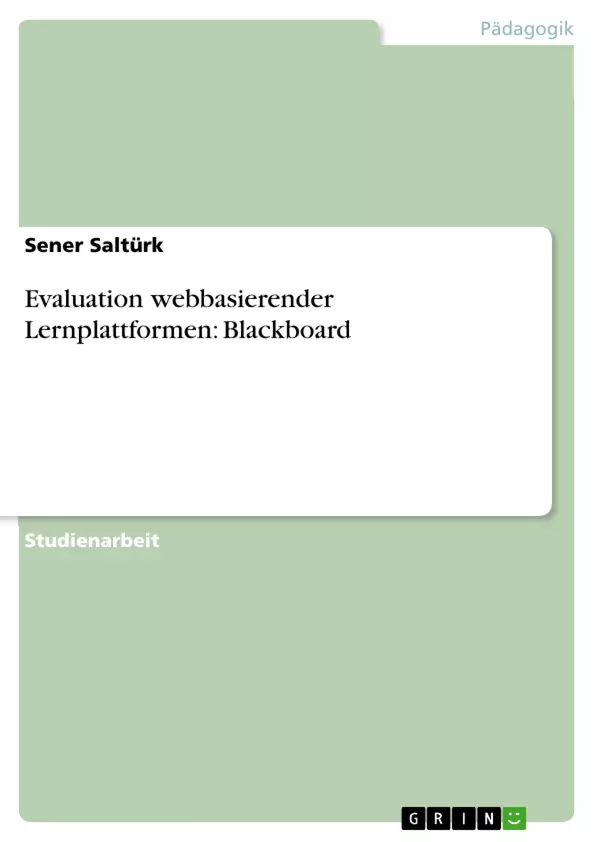Im Rahmen des eLearning spielen Plattformen eine zentrale Rolle. Sie sind es, die die
technischen Anforderungen des eLearning praktisch umsetzen müssen und zwar für
unterschiedliche Ziele und Zwecke, die jeweils abhängig sind von der jeweiligen konkreten
Anforderung. Hierbei variieren die Anforderungen je nach aktueller Ist-Situation. Auf der
Suche nach der einer „Lösung“ ist daher zunächst eine umfassende Bestandsaufnahme des
individuellen Ist-Zustandes vonnöten und abzuwägen, welche der bestehenden Lösungen am
ehesten den eigenen Anforderungen entsprechen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es
zahlreiche fertige Lösungen, die sich den webbasierenden Plattformen verschrieben haben.
Die „richtige“ auszuwählen und –soweit möglich- an die eigenen Anforderungen anzupassen,
setzt u.a. umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Kommunikation, Didaktik,
Administration und Technik der einzusetzenden Lösung voraus. Jedoch bleibt die Auswahl
der in Frage kommenden Plattform von entscheidender Bedeutung. So bemerkt Brunner:
„Noch gibt es keine Lernplattform die in zufriedenstellender Weise die Funktionen vereint,
die für Hochschulkurse als notwendig erachtet werden. [...] Viele Anbieter [haben] die
spezifischen Anforderungen von Hochschulen noch nicht begriffen und versuchen, die in der
Privatwirtschaft erfolgreichen Produkteportfolios und Marketingkonzepte unverändert auf
diese anzuwenden.“
Aus diesem Zitat geht hervor, dass insbesondere Institutionen, d.h. Universitäten und
Fachhochschulen im Rahmen einer eLeraning-Umgebung miteinander vernetzt werden. Im
konkreten Fall der Lernplattform Blackboard Learning Management System (s. 4. ff.)
kommen weitere Klienten wie Regierungseinrichtungen, aber auch führende kommerzielle
Unternehmen als Lizenznehmer in Frage.
Zwecks Evaluation von Lernplattformen wurde seitens des österreichischen
Bildungsministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Studie in Auftrag gegeben,
einen weltweiten Überblick über Evaluation, Auswahl und Praxis von Lernplattformen
(Learning Management Systemen) zu verschaffen, deren Ergebnisse im folgenden behandelt
werden sollen.
Im Anschluss daran soll die webbasierende Plattform „Blackboard“ LM vorgestellt werden.
INHALT
Einleitung
1. Definition Lernplattformen
2. Bewertungsverfahren für Lernplattformen
2.1 Kriterienkataloge
2.2 Rezensionen
2.3 Vergleichsgruppen
2.4 Expertinnenurteile
3. Praktische Umsetzung des Evaluationsprozesses
3.1 Numerische Gewichtungsprozeduren
3.2 Qualitative Gewichtungsprozeduren
4. Blackboard Learning Management System™
4.1 Allgemeines zu Blackboard
4.1.1 Blackboard Inc.
4.1.2 Klienten
4.2 Allgemeine Funktionen von Blackboard Learning System
4.3 Kommunikation, Kooperation und Kollaboration
4.3.1 Synchrone und asynchrone Kommunikation
4.3.2 Asynchrone Kommunikation
4.4 Didaktik
4.5 Administration
4.5.1 Personalisierung
4.6 Technik
4.6.1 Distributierbarkeit, Services und Dokumentation
- Quote paper
- StR Sener Saltürk (Author), 2004, Evaluation webbasierender Lernplattformen: Blackboard, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204006