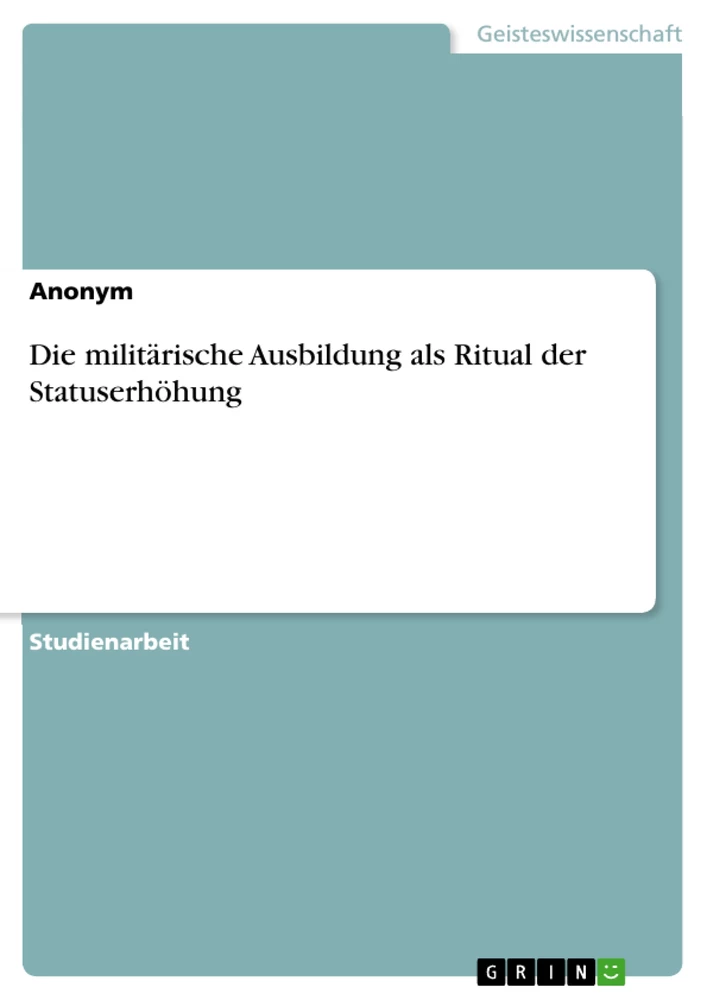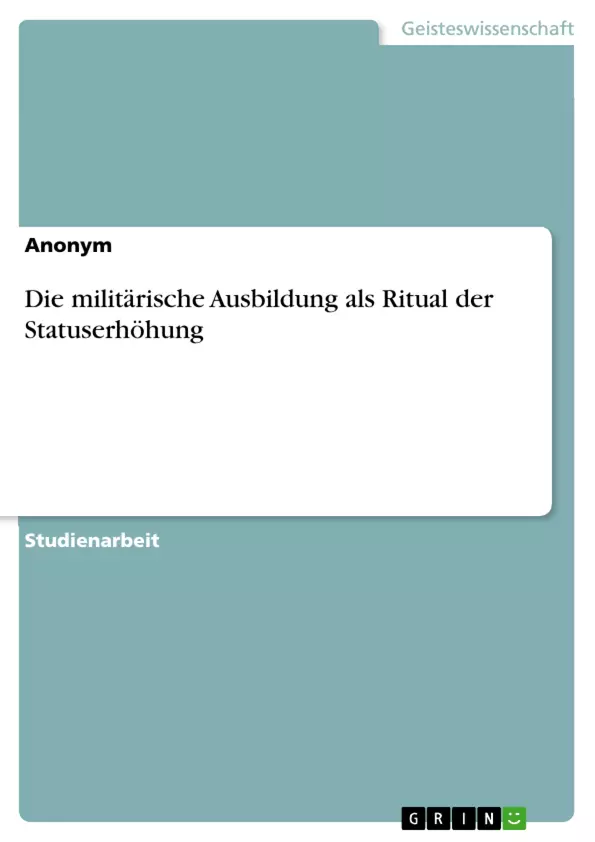„Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur“ (1969) von Victor Turner ist ein Klassiker der Anthropologie, der in keinem studentischen Bücherregal fehlen sollte. Das Buch setzt sich aus fünf Teilen zusammen. Drei Vorlesungen Turners bilden die ersten Kapitel. Das erste beschäftigt sich mit dem Isoma-Ritual der Ndembu und seinen Klassifikationsebenen. Im zweiten geht Turner auf die Paradoxie des Zwillingsphänomens im Ndembu-Ritual ein. Daran anschließend führt er die Begriffe „Liminalität“ sowie „Communitas“ ein. Dabei spannt er den Bogen von den afrikanischen Ritualen zur restlichen Welt. Im vierten Kapitel geht Turner näher auf sein „Konzept der Communitas“ ein und betont seine Vorstellung von der Gesellschaft als Prozess. Abschließend setzt er Communitas in Verbindung mit Außenseitertum sowie Unterlegenheit in der Sozialstruktur und erläutert die Bedeutung von Ritualen der Statuserhöhung/Statusumkehrung. Seine theoretischen Annahmen unterstreicht Turner mit Beispielen aus unterschiedlichen Gesellschaften.
Doch wer war Victor Turner eigentlich? Als Sohn eines Elektroingenieurs und einer Schauspielerin kam Victor Witter Turner am 28. Mai 1920 in Glasgow (Schottland) zur Welt. Der Dualismus zwischen Wissenschaft und Kunst sollte ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Im Department of Anthropology der Universität London studierte Turner Ethnologie. Nachdem er sein Studium mit dem B.A. abschloss, holte ihn Max Gluckman an sein Department in Manchester, wo sich später die „Manchester School“ als eigene Richtung der britischen Sozialanthropologie herausbildete. Im Auftrag des Rhodes Livingston Institutes in Lusaka führte Turner gemeinsam mit seiner Frau Edie zwischen den Jahren 1950 und 1954 Feldforschungen bei den Ndembu in Sambia durch, die ihm viel Anerkennung einbrachten. Später lehrte Victor Turner an verschiedenen Universitäten in den USA bis er am 18. Dezember 1983 an einem Herzinfarkt starb.
Im Folgenden werde ich auf der Basis des Buches „Das Ritual“ Turners Theoriekonzept vorstellen und die wichtigsten Begriffe genauer definieren. Daran anschließend widme ich mich der Kritik an Turners Werk. Im darauffolgenden Kapitel werde ich am Beispiel der Folterer- und Spezialsoldatenausbildung die Charakteristika von Liminalität nach Turner veranschaulichen, um schließlich die Frage zu erörtern, ob Victor Turner zur Idealisierung neigte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Turners Theoriekonzept
- Kritik an Turner
- Militärische Ausbildung als Ritual der Statuserhöhung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Werk „Das Ritual" von Victor Turner. Die Arbeit analysiert Turners Theoriekonzept und setzt sich kritisch mit seinen Annahmen auseinander. Im Fokus steht die Frage, ob Turners Konzept der Liminalität und Communitas auch auf komplexe Gesellschaften anwendbar ist und welche Folgen die militärische Ausbildung als Ritual der Statuserhöhung für die Individuen hat.
- Turners Theoriekonzept der Liminalität und Communitas
- Kritik an Turners Werk
- Militärische Ausbildung als Ritual der Statuserhöhung
- Die Auswirkungen der militärischen Ausbildung auf die Individuen
- Die Frage nach der Anwendbarkeit von Turners Theorie auf komplexe Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
-
Die Einleitung stellt das Buch „Das Ritual" von Victor Turner vor und gibt einen kurzen Überblick über dessen Inhalt. Es wird erläutert, dass das Buch aus fünf Teilen besteht, wobei die ersten drei Kapitel Vorlesungen Turners bilden, die sich mit dem Isoma-Ritual der Ndembu und seinen Klassifikationsebenen, der Paradoxie des Zwillingsphänomens im Ndembu-Ritual und den Begriffen „Liminalität" und „Communitas" befassen. Im vierten Kapitel geht Turner näher auf sein Konzept der „Communitas" ein und betont seine Vorstellung von der Gesellschaft als Prozess. Abschließend setzt er Communitas in Verbindung mit Außenseitertum sowie Unterlegenheit in der Sozialstruktur und erläutert die Bedeutung von Ritualen der Statuserhöhung. Seine theoretischen Annahmen unterstreicht Turner mit Beispielen aus unterschiedlichen Gesellschaften.
-
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Turners Theoriekonzept, das auf dem Konzept der Übergangsriten des französischen Ethnologen Arnold van Gennep basiert. Van Gennep bezeichnet Übergangsriten als Rituale, die einen Orts-, Zustands-, Positions- oder Altersgruppenwechsel begleiten. Sie weisen immer die folgenden drei Phasen auf: Trennungs-, Schwellen- und Angliederungsphase. Turner legt seinen Schwerpunkt auf die mittlere, die Schwellenphase, auch Liminalität genannt. Diese Phase stellt einen Bereich dar, der wenig oder gar nichts mit dem vergangenen oder zukünftigen Zustand gemeinsam hat. Personen, die sich im Schwellenzustand befinden, werden Schwellenwesen genannt und sind „betwixt and between". Sie sind gekennzeichnet durch Anonymität, Demut, Passivität, Geschlechtslosigkeit, sexuelle Enthaltsamkeit und Unbestimmtheit. Die Schwellenwesen sind oftmals körperlichen Torturen ausgesetzt und müssen strikten Gehorsam leisten. Außerdem besitzen sie nichts, was auf eine Rolle in der Sozialstruktur verweist. Aufgrund dieser Gleichstellung entwickelt sich unter den Schwellenwesen eine tiefe Verbundenheit. Turner identifiziert in seinem Buch die zwei wichtigsten Typen des Schwellendaseins: Rituale der Statuserhöhung sowie der Statusumkehrung. Bei Ritualen der Statuserhöhung wird das Ritualsubjekt irreversibel in eine höhere Position in der Sozialstruktur gehoben. Dies geschieht z.B. bei Riten der Lebenskrisen (Geburt, Pubertät, Heirat, Tod) oder Amtseinsetzungsritualen. Während diese Rituale meist nur Einzelpersonen betreffen, beziehen sich Rituale der Statusumkehrung immer auf große Gruppen. Dazu gehören u.a. jahreszeitliche bzw. kalendarische Rituale. Hierbei üben Personen, die in der Sozialstruktur normalerweise einen niederen Status innehaben, Autorität über ihre strukturell Überlegenen aus. Letztlich ändert aber keiner der Teilnehmenden seinen Status wirklich, sondern die Strukturordnung bleibt erhalten. Laut Turner entsteht unter den Schwellenwesen eine Gemeinschaftlichkeit, die er Communitas nennt. Darunter versteht er „Gesellschaft als unstrukturierte oder rudimentär strukturierte und relativ undifferenzierte Gemeinschaft". Communitas steht im Gegensatz zur Struktur, kann jedoch nicht über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben und bildet aus diesem Grund meist selbst eine Struktur. Communitas und Struktur stellen laut Turner die „zwei Haupt-»Modelle« menschlicher Sozialbeziehungen [dar], die nebeneinander bestehen und einander abwechseln.
-
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kritik an Turners Werk. Es wird darauf hingewiesen, dass „Das Ritual" von Victor Turner zwar zu den Klassikern der Anthropologie gehört, jedoch auch einige kritische Stimmen erntete. Paola Ivanov bezeichnet Turner als „spekulativen Philosophen", dessen Erörterungen weitläufig und unsystematisch seien. Seine Ergebnisse, die er durch Deduktion erzielt, seien zudem beliebig übertragbar. Victor Turners Versuch, seine Theorie auch auf komplexe Gesellschaften anzuwenden, ist ihm auf jeden Fall hoch anzurechnen. Jedoch kritisiert Ivanov, dass diese Bemühungen „unpräzise, unplausibel und immer weniger empirisch verankert" seien. Bei der Lektüre des Werkes fällt dem Leser des Weiteren Turners Vorliebe zur Idealisierung auf. Zum Beispiel ist es kein Muss, dass während der liminalen Phase Kreativität zum Ausdruck kommt. Weiterhin verharmlost er die Torturen, welche die Neophyten in Übergangsritualen erleiden müssen. Außerdem beachtet Turner nicht, „daß Gemeinschaftserleben sich auch in ein Massenverhalten wandeln kann: in dem das Fest zum Pogrom wird, und aus einem gemeinschaftlichen
Haß gegen erwachsen kann. -
Das vierte Kapitel befasst sich mit der militärischen Ausbildung als Ritual der Statuserhöhung. Es wird darauf hingewiesen, dass Victor Turner in seinen Ausführungen zur Statuserhöhung in westlichen Gesellschaften u.a. von Härtetests bei der Aufnahme in Militärakademien spricht. Dieser Punkt wird in diesem Kapitel aufgegriffen und weiter ausgeführt. Die militärische Ausbildung kann man als Ritual der Statuserhöhung ansehen. Dies kommt z.B. in der Erreichung eines bestimmten Dienstgrades zum Ausdruck. Besonders deutlich macht das ein Ausspruch bei den Marines: „Botschaft Nummer eins: Du bist nichts. Botschaft Nummer zwei: Wir machen etwas ganz Besonderes aus dir." In der vorliegenden Arbeit lege ich den Schwerpunkt auf die Ausbildung zu Folterern und Spezialsoldaten. Dabei beziehe ich mich auf den Text „Demütigung und Destruktivität. Folterer- und Spezialsoldatenausbildung in psychologischer Perspektive" von Peter Boppel. Die Auszubildenden sind in der Regel zwischen 14 und 25 Jahren alt und befinden sich somit in einer Übergangsphase - der Adoleszenz. Peter Boppel vergleicht die Ausbildung in seinem Artikel mit Initiationsriten. Die Loslösung von der Sozialstruktur erfolgt mit der Aufnahmezeremonie in der militärischen Einrichtung. Oftmals werden die Jugendlichen während der Ausbildungszeit völlig von ihrer gewohnten Umgebung isoliert. Das Leben wird in Kasemen neu organisiert und nur bestimmte Informationen werden übermittelt. Besonders extrem wird das in der Terroristenausbildung gehandhabt, wo die Rebellen z.T. neben Leichen eingegraben werden. Diese Tatsache entspricht der Aussage Turners, dass der Tod als eines von vielen Symbolen kennzeichnend für die Schwellenphase sein kann. Während dem Training sind die Soldaten starker physischer Gewalt sowie seelischen Demütigungen ausgesetzt. Die Sexualität der Auszubildenden wird streng kontrolliert. Das äußert sich auf der einen Seite in strikter Enthaltsamkeit. Andererseits kann es zu Gruppenvergewaltigungen kommen, was die Betroffenen zusätzlich demütigt. Die kollektive Bestrafung für das Vergehen eines Einzelnen erzeugt jedoch einen starken Gruppenzusammenhalt, der die Basis für langfristige Freundschaften bilden kann. Das Tragen von Uniformen und die einheitlichen Haarschnitte verstärken dieses Gemeinschaftsgefühl. Des Weiteren legen die Ausbilder Wert darauf, unter den zukünftigen Kriegerpersönlichkeiten das Bewusstsein zu schüren, einer Elite anzugehören. Der Körper soll gestählt, der Geist hingegen geschwächt werden, denn die Soldaten müssen letztlich „funktionieren". Eine abnehmende geistige Komplexität erleichtert es, ein gewünschtes Feindbild in den Köpfen der Kämpfer zu verankern, wie es z.B. die Juden im Dritten Reich darstellten. Hass und Aggression gegenüber potentiellen Feinden werden aufgebaut. Wobei sich in diesem Fall nicht das kreative Potenzial der Individuen entfaltet, sondern es zu einer Abstumpfung kommt. Problematisch erscheinen besonders die Folgen dieser Ausbildung: Den Soldaten droht ein Verlust des eigenen Ichs. Andererseits entwickeln sie Größenfantasien. Aufgrund ihrer Intensität scheint die Ausbildungsphase einem rauschähnlichen Zustand zu gleichen. Die angehenden Folterer und Spezialsoldaten befinden sich in einer liminalen Phase. Sie sind weder „normale" Jugendliche noch ausgebildete Krieger. Die Darstellung der militärischen Ausbildungszeit deckt sich weitgehend mit Turners Konzept der Liminalität: Isolation, Demütigungen, Tod als Schwellensymbol, Bestrafung, sexuelle Enthaltsamkeit, Gleichheit, Entwicklung intensiver Freundschaften unter den Schwellenwesen. Das letztendliche Ziel ist der Einsatz der Soldaten im Krieg oder in kriegsähnlichen Konflikten, welche wiederum selbst als Rituale verstanden werden können. Auch Turners „Communitas-Konzeption sei [nach eigenen Angaben] zurückzuführen auf das persönliche Erleben eines Gemeinschaftsgefühls im Zweiten Weltkrieg, in dem er einer Ziviltruppe von Bombensuchern angehörte. Doch auf das Thema „Krieg als Ritual" gehen weder Turner noch van Gennep (wie Justin Stagl bemerkt) ein. „Der Krieger, der Kopfjäger, der Totschläger befinden sich in einem sakralen Zustand, es bedarf komplizierter Rituale, um sie wieder in die Alltagsgesellschaft einzugliedern. Rein aus psychoanalytischer Sicht gestaltet sich die Wiedereingliederung sehr schwierig, da viele Rekruten nach ihren Einsätzen an seelischen Erkrankungen leiden. Turner schreibt im Zusammenhang mit Amtseinsetzungsritualen von prunkvollen Angliederungsriten. Im vorliegenden Fall folgt der Schwellenphase in vielen Fällen entweder die Psychiatrie oder das Grab.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die militärische Ausbildung, die Liminalität, die Communitas, die Statuserhöhung, die Folterer- und Spezialsoldatenausbildung, die Übergangsriten, die Demütigung, die Destruktivität, die Gewalt, die Isolation und die seelischen Folgen der Ausbildung. Der Text analysiert die militärische Ausbildung im Kontext der Theorie von Victor Turner und untersucht die Auswirkungen dieser Ausbildung auf die Individuen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Die militärische Ausbildung als Ritual der Statuserhöhung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/203937