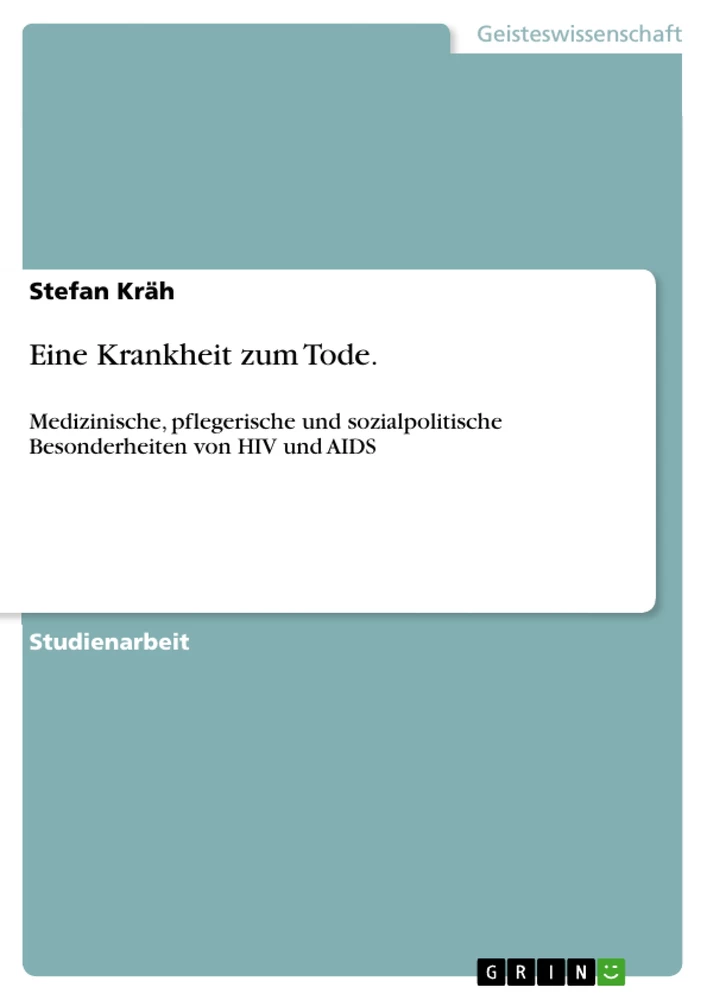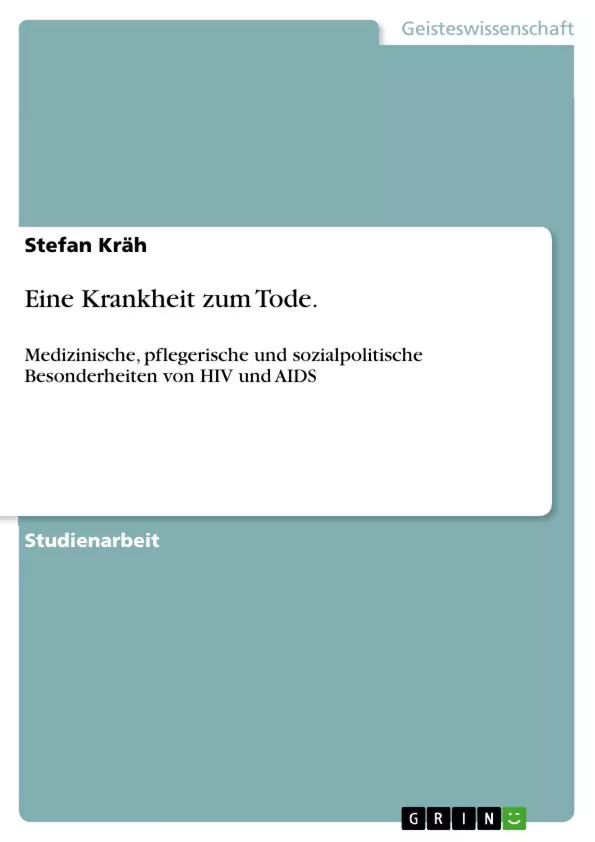Eine Ansteckung mit dem HI-Virus bedeutet nicht nur für den medizinischen Bereich sondern auch für Politik und Gesellschaft eine Herausforderung.
Bedürfen AIDS-Patienten trotz Chronifizierung und Normalisierung der Krankheit einer besonderen Betreuung?
Behandelt werden in dieser Arbeit:
- der Wandel, den die Krankheit durch die Präventionsarbeit und Medikalisierung von HIV und AIDS vollzogen hat
_ die Art und Weise, wie die Pflege von AIDS-Patienten verwirklicht werden kann
- das Verschwinden der Seuche aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit - das Verschwinden der Angst vor der eigenen Betroffenheit.
- Gründe für steigende Infektionsratenheute
- der Betreuungsbedarf auf den die Regelpflege nicht eingestellt ist
- Besonderheit der Prävalenzgruppen
- institutionalisierte Interventionen und der therapeutische Durchbruch
- Normalisierung im Sinne der Integration von HIV in die Gesellschaft
- „Chronifizierung“
- Vergleich zu Cholera und Pest
- Mechanismen, die bei der Bewältigung einer Epidemie greifen
- non-Adherence als Beispiel für lebensstilspezifische Problemlagen
- Einblick in die von AIDS-Hilfen durchgeführte Lebens- und Sterbebegleitung
- Besonderheiten und Problemlagen der AIDS-Krankenversorgung
- das Sterben
- Trauer
- AIDS ist trotz Normalisierung nicht „normal“
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Infektion und ihre Normalisierung
2.1 Infektionsverlauf
2.2 Normalisierung
2.3 Eine „normale“ Seuche
3 Non-Adherence als Beispiel für spezifische Problematiken der Prävalenzgruppe
4 Sterbebegleitung und Lebensbegleitung
4.1 AIDS-Hilfen
4.2 AIDS-Krankenversorgung
4.3 Sterben
5 Trauer
6 Fazit
7 Verwendete Literatur
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit beleuchtet einen Teilaspekt der Problematik mit der Immunschwächekrankheit AIDS. Eine Ansteckung mit dem HI-Virus gilt seit seinem ersten gehäuften Auftreten in den 1980er Jahren bis heute als unheilbar und bedeutet aufgrund der Besonderheiten der Übertragung und der Eigenschaften der hauptsächlich betroffenen Personen nicht nur für den medizinischen Bereich sondern auch für Politik und Gesellschaft eine Herausforderung.
Hauptaugenmerk liegt einerseits auf dem Wandel, den die Krankheit durch die Präventionsarbeit und Medikalisierung von HIV und AIDS vollzogen hat und andererseits auf der Art und Weise, wie die Pflege von AIDS-Patienten verwirklicht werden kann.
HIV und AIDS sind heute selbst für Angehörige der Hauptbetroffenengruppen kein großes Thema mehr. Die Zahl der Infizierten blieb in Deutschland lange Zeit bei etwa 70.000 Personen und die Zahl der AIDS-Toten erscheint verschwindend gering. Die krisenhafte Seuche der 1980er Jahre ist aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit verschwunden und mit ihr auch die Angst vor der eigenen Betroffenheit. Sinkende Verkaufszahlen von Kondomen und kurz darauf eine Häufung von Neuinfektionen bei jungen Schwulen, welche während der Epidemie noch Kinder oder nicht geboren waren und sich nicht an die Bilder von ausgezehrten AIDS-Kranken in den Medien erinnern können, zeigen, dass das Thema HIV und AIDS heute wieder neue Aktualität gewinnt und über den Umgang mit Betroffenen gesprochen werden muss. Sofern wir in Deutschland mit weiterhin steigenden HIV-Infektionsraten konfrontiert werden und sich damit einhergehend auch die Fallzahlen von AIDS-Erkrankungen erhöhen, entsteht ein Betreuungsbedarf auf den die Regelpflege nicht eingestellt ist. Aufgrund dieser Tatsache und der Besonderheit der Prävalenzgruppen lautet die Fragestellung der vorliegenden Hausarbeit:
Bedürfen AIDS-Patienten trotz Chronifizierung und Normalisierung der Krankheit einer besonderen Betreuung?
Kapitel 2 behandelt, nach einer kurzen Einführung in den Infektionsverlauf (Abschnitt 2.1), den gesellschaftlichen Wandel der 90er Jahre, in denen AIDS dank institutionalisierter Interventionen und den therapeutischen Durchbruch eine Normalisierung (Abschnitt 2.2) im Sinne der Integration von HIV in die Gesellschaft und „Chronifizierung“ (Schaeffer et al. 1999, S. 19) erfahren hat. Abschnitt 2.3 liefert einen Vergleich zu Cholera und Pest und vollzieht die Mechanismen nach, die bei der Bewältigung einer Epidemie greifen. Kapitel 3 weist am Beispiel der non-Adherence auf lebensstilspezifische Problemlagen hin, die trotz gesellschaftlicher Normalisierung von AIDS, individuell dramatisch auf den Patienten wirken.
Kapitel 4 gibt Einblick in die von AIDS-Hilfen durchgeführte Lebens- und Sterbebegleitung, welche das Angebot von Patientenverfügungen, Vorsorge-Vollmachten und Betreuungsverfügung mit einschließt (Abschnitt 4.1), während in Abschnitt 4.2 der Fokus auf die Besonderheiten und Problemlagen der AIDS-Krankenversorgung, die das Sterben (Abschnitt 4.3) mit einbezieht, liegt.
Kapitel 5 zeigt anhand des Themas „Trauer“, dass AIDS trotz Normalisierung, eben aufgrund der Charakteristik der Hauptbetroffenengruppen nicht „normal“ ist.
2 Die Infektion und ihre Normalisierung
„Die statistische Beruhigung leitete allmählich eine Entdramatisierung auf gesellschaftlicher Ebene ein, der zunehmend die Normalisierung des Phänomens AIDS folgte.“
(Aidshilfe Darmstadt 1999, S. 4)
Mit diesem Satz fasst die Autorin den aus den Erfolgen der antiretroviralen Kombinationstherapien resultierenden sozialmedizinischen Wandel zusammen, der die AIDS-Krise der 1980er Jahre in der alle betroffen zu sein schienen, zu einem handhabbaren Problem von Randgruppen macht.
Das 1981 erstmals durch Michael Gottlieb beschriebene HI-Virus (Human Immunodeficiency Virus) führte bislang nach einer Latenzzeit von zehn bis 14 Jahren zur einem Erworbenen Immundefektsyndrom, kurz: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), welches innerhalb von nur zwei bis vier Jahren zum Tod des Betroffenen führte (vgl. Edelkraut 2005, S. 17). Die Krankheit stellte durch die unklaren Übertragungswege, seinen seuchenartigen Charakter, den tödlichen Verlauf und die Hilflosigkeit bezüglich der Behandlung eine krisenhafte Bedrohung für die Allgemeinheit dar.
Ende der 90er Jahre wird vermehrt von einer Normalisierung gesprochen. War AIDS bisher von einem „leidvollen und hoffnungslosen Krankheitsbild“ (Wright 2000, S.270) gekennzeichnet, dem der Patient unweigerlich erlag, entwickelt es sich mit Stabilisierung der Neuinfektionen und verbesserter Therapie zu einer chronischen Krankheit.
2.1 Infektionsverlauf
Bevor eine wirksame Therapie gegen HIV gefunden wurde, führte eine Ansteckung innerhalb weniger Jahre zum Tod. Kurz nach der Infektion treten bei einigen Betroffenen „grippeartige Beschwerden“ (Deutsche AIDS-Hilfe 2011) wie Nachtschweiß, Fieber, Durchfall, geschwollene Lymphknoten und Hautausschlag auf, verschwinden jedoch nach der Bildung von körpereigenen Antikörpern wieder.
Bei Nichtbehandlung kommt es zu einer fortlaufenden Vermehrung des HI-Virus, welche zu einer Schwächung des Immunsystems und vermehrt zu Infektionskrankheiten führen kann. Auch Organe, insbesondere der Darm werden geschädigt. Der HIV-positive Mensch ist in hohem Maß von Beschwerden und Infektionskrankheiten betroffen. Treten bei fortschreitender Vermehrung der Viren und der damit einhergehenden Schwächung des Körpers Symptome wie Lungenentzündung, Hauterkrankungen, Pilzbefall in der Speiseröhre und/oder bestimmte Krebsformen, wie etwa Kaposi-Sarkome, auf, spricht man von einer AIDS-Erkrankung. Ebenso werden durch Toxoplasmose oder HIV-Enzephalopathie verursachte neurologische und psychische Störungen wie Lähmungen, Krämpfe, Sprachstörungen, Verhaltensänderungen, Manien und paranoide Psychosen beschrieben. (Vgl. Deutsche AIDS-Hilfe 2010; 2000, S. 110f)
Eine Infektion mit HIV bleibt auch heute, 30 Jahre nach der Erstbeschreibung des Virus, bei vielen Betroffenen zunächst unentdeckt. Ein sogenannter HIV-Test, also die Untersuchung des Blutes auf Antikörper liefert bereits wenige Wochen nach einer Infektion ein zuverlässiges Ergebnis, sodass sofort mit der Therapie begonnen werden kann.
2.2 Normalisierung
Gerade die hochaktive antiretrovirale Therapie (HAART) ist es, die AIDS seinen Schrecken genommen hat. Der sozialmedizinische Wandel der Epidemie lässt sich in den 1990er Jahren ausmachen, in denen die Aufklärungsarbeit der in größeren Städten gegründeten AIDS-Hilfen, die Bemühungen der Selbsthilfegruppen und allen voran die Forschung an HIV und seiner Behandlung erste Früchte trugen. Das Zusammenwirken von Nichtregierungsorganisationen, Regierungen und Gesundheitsberufen führte schnell zu einem hohen Informationsstand und öffentlichem Bewusstsein. Diese Konstellation brachte zunächst eine Schwächung der Akteure aus dem Medizinbereich mit sich (Wright, S.279). Deren „Handlungs- und Machtvakuum“ (Dannecker 2000, S. VI) wurde mit der Einführung der hochaktiven antiretroviralen Therapie im Jahr 1996 aufgehoben. Es gab weniger neue Ansteckungen, eine längere Latenzzeit bei Infizierten und damit weniger Erkrankte (vgl. Edelkraut 2005, S. 17).
Bis zu diesem Zeitpunkt war ein Leben mit HIV noch ein Leben mit einer Prognose über dessen Verlauf und gab Gewissheit über den Zeitpunkt des Sterbens. Wer sich zu seiner Infektion bekannte, bekannte sich gleichzeitig zu seinem baldigen Tod. Der HIV-positive Mensch wird laut Dannecker (1997, S.130) zum „Zeit-Wissenden“ und erlangt die Identität des „bald Sterbenden“ (ebd. S. 131). Dannecker (1998, S. 1) charakterisiert AIDS mit den Worten Hervé Guiberts[1]: „Eine Krankheit zum Tode“; konkretisiert sogar, dass es nur für den HIV-Positiven eine Krankheit zum Tode war, während es für an AIDS Erkrankte schlicht der Tod selbst war.
Mit Einführung der neuen Therapien konnten Infizierte und Erkrankte wieder Hoffnung schöpfen. AIDS und HIV bedeuteten nicht mehr sofortiges Sterben. In gewissem Sinne sogar das Gegenteil: Bereits Todgeweihte, die ihre verbleibende Zeit zu Sterbenszeit umgedacht hatten, wurden wieder zurück ins Leben geholt. Die Epidemie wurde einschätzbar und eindämmbar. Die Professionalisierung und Medikalisierung führten zur Normalisierung von AIDS. Wright definiert die Normalisierung als „Integration der Krankheit in die Gesellschaft“ (ebd. S. 281).
2.3 Eine „normale“ Seuche
AIDS erfüllt in seinem Verlauf alle Merkmale einer „normalen Epidemie“ (ebd. S. 271): Wie auch schon bei Pest und Cholera wurde bei HIV zunächst das Infektionsrisiko kollektiv verleugnet und die Gefahr bei bestimmten benachteiligten Gruppen verortet. Da Analverkehr und intravenöser Drogengebrauch die Hauptübertragungswege für HIV sind, bilden schwule Männer und intravenös Drogenabhängige neben Menschen aus Hochprävalenzländern in Deutschland die größten Betroffenengruppen.
Besonders in der Anfangszeit, aber auch noch heute findet eine, für „normale Epidemien“ typische, Schuldzuweisung an die „Risikogruppen“ statt. Die hauptsächlich Betroffenen sind also nicht nur einem Risiko ausgesetzt, sie bilden gleichsam ein Risiko für die Allgemeinheit. Unter Vernachlässigung epidemiologischer, biologischer und sozialer Faktoren lautet der Vorwurf, dass die Krankheit erst durch das Verhalten der betroffenen Menschen entsteht[2] (vgl. ebd. S. 272-275). Hatte AIDS in den 1980er Jahren seinen Ursprung in der gesellschaftlichen Mittelschicht, so entwickelte es sich mit der Verschiebung der Neuinfektionen allmählich zu einer Krankheit der Unterschicht (ebd. S.282). Sowohl innerhalb, als auch außerhalb der betroffenen Gruppen.
Mit dem Beginn des Massensterbens und der Ohnmacht der Medizin kam es vor allem vonseiten der AIDS-Hilfe-Bewegung in den 80er Jahren zu Zweifeln an den in der Kultur üblichen Heilverfahren und Erklärungsmustern, sodass die Forderungen nach neuen Techniken laut wurden. Stieg im 19. Jahrhundert die Nachfrage nach Naturheilmitteln zur Behandlung von Cholera, gab es in der AIDS-Krise Experimente mit Hausmitteln, Kräutern und Cannabis, aber auch mit Akupunktur und spirituellen Theorien (vgl. ebd. S. 275f). Aus der Skepsis gegenüber den bekannten Heilverfahren resultieren bei „normalen Epidemien“ Innovationen im medizinischen Bereich und staatliche Interventionen: Die verbesserte medizinische Versorgung und die bis heute bestehende staatliche Trinkwasserkontrolle beendete die Choleraseuche, während der AIDS-Epidemie durch Einführung wirksamer Therapiemethoden und gesetzliche wie auch strukturelle Anpassungen nur annähernd beigekommen werden konnte. AIDS verschwindet nicht und bleibt Teil der Gesellschaft. In Bezug auf die politische Intervention stellt Wright die Auseinandersetzung sogenannter Maximalisten und Minimalisten heraus, von denen sich die Minimalisten in Deutschland durchsetzten:
[...]
[1] H. Guibert (1955-1991) beschreibt, selbst bereits an AIDS erkrankt, in seinem Roman „Dem Freund der mir das Leben nicht gerettet hat“ den Umgang mit der Krankheit und den AIDS-Tod seines langjährigen Freundes Michel Foucault.
[2] Angesehene Personen die an Cholera starben, machten sich dadurch verdächtig. Den Toten wurde daraufhin oft ein exzessives und unmoralisches Privatleben nachgesagt. (Wright, S. 272)
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die „Normalisierung“ von HIV/AIDS?
Durch medizinische Fortschritte (HAART) hat sich AIDS von einer unmittelbar tödlichen Seuche zu einer behandelbaren, chronischen Krankheit gewandelt, die in die Gesellschaft integriert ist.
Benötigen AIDS-Patienten trotz Normalisierung eine besondere Betreuung?
Ja, aufgrund lebensstilspezifischer Problemlagen, psychischer Belastungen und der Besonderheiten der Prävalenzgruppen ist die Regelpflege oft nicht ausreichend vorbereitet.
Was ist „Non-Adherence“ und warum ist sie bei HIV gefährlich?
Non-Adherence bezeichnet das unregelmäßige Einnehmen der Medikamente. Dies kann zu Resistenzen des Virus führen und den therapeutischen Erfolg gefährden.
Welche Rolle spielen AIDS-Hilfen heute?
Sie bieten psychosoziale Unterstützung, Lebens- und Sterbebegleitung sowie Beratung zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten an.
Warum steigen die Infektionsraten bei jungen Menschen wieder an?
Da die Angst vor der Krankheit durch die gute Behandelbarkeit gesunken ist, nimmt die Präventionsmüdigkeit zu. Jüngere Generationen haben die tödliche Krise der 80er Jahre nicht miterlebt.
- Arbeit zitieren
- Stefan Kräh (Autor:in), 2011, Eine Krankheit zum Tode., München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202795