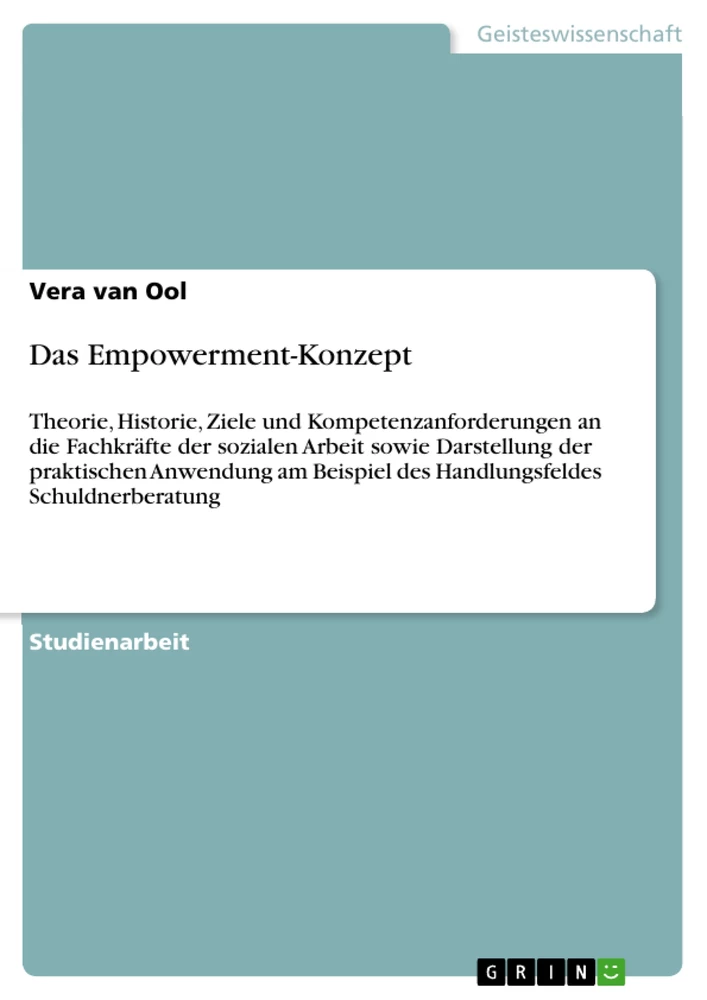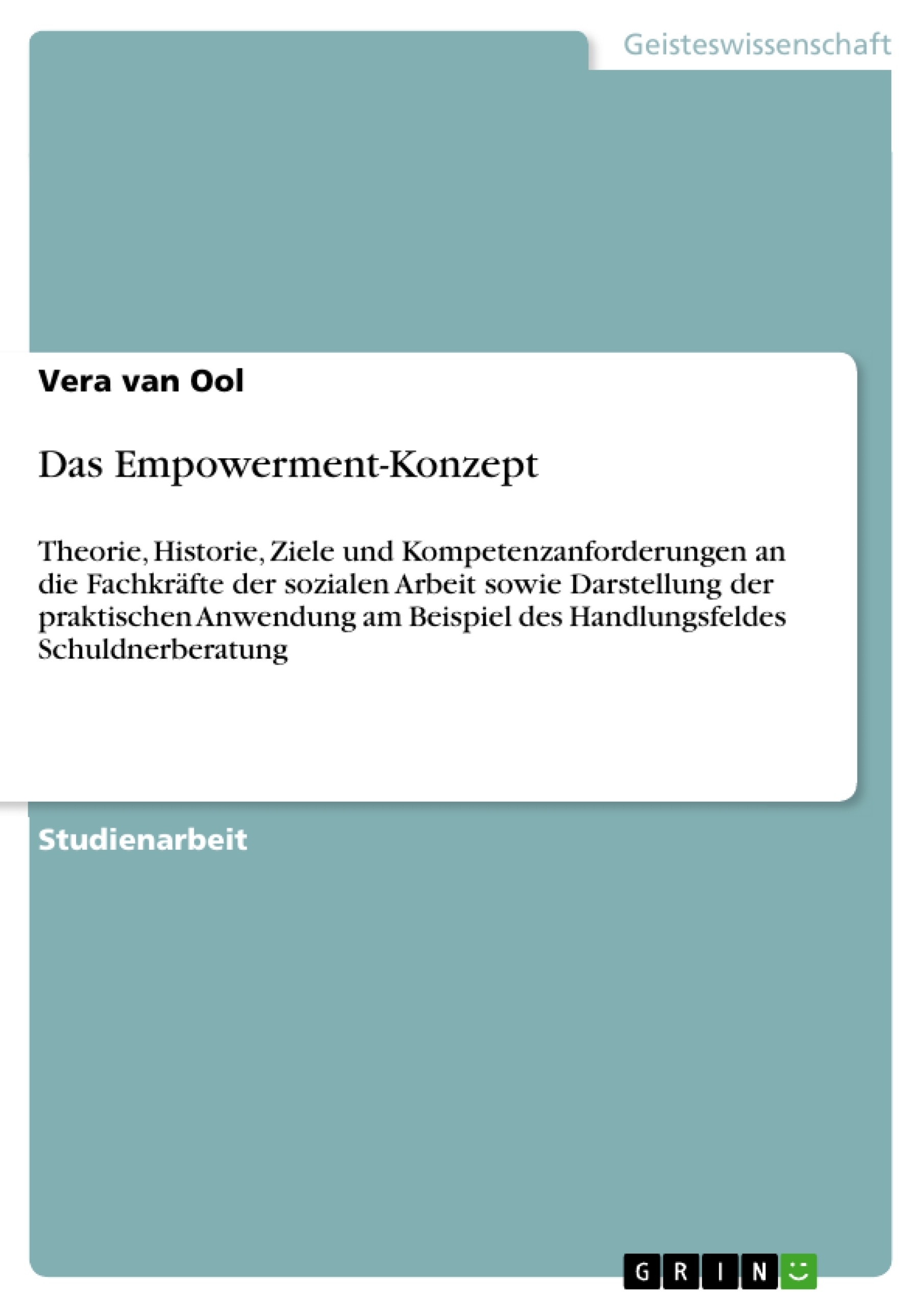In dieser Arbeit möchte ich mich mit dem Empowerment-Konzept beschäftigen, da die Vorstellung des Konzeptes in der Vorlesung sehr stark mein Interesse geweckt hat. Nach der Vorlesung habe ich mich gefragt, ob eine Eingliederung des Empowerment- Konzeptes in das von mir angestrebte Arbeitsfeld der Schuldnerberatung möglich wäre. In Gesprächen mit Sozialarbeitern in der Schuldnerberatung wurde mir klar, dass es eine schnelle und eindeutige Antwort auf diese Frage nicht gibt.
In dieser Arbeit möchte ich mich daher neben der Vorstellung des Konzeptes und der Erläuterung der Anforderungen an die Sozialarbeiter, die nach diesem Konzept arbeiten, mit der praktischen Umsetzung im Arbeitsfeld Schuldnerberatung befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer und historischer Hintergrund
- Theorie des Empowerment-Konzeptes
- Historischer Hintergrund
- Ziele von Empowerment
- Ziele auf Individualebene
- Ziele auf Ebene der sozialen Netzwerke
- Kompetenzanforderungen an die Fachkräfte der sozialen Arbeit in Bezug auf Empowerment
- Anforderungen auf intrapersoneller Ebene
- Anforderungen auf interpersoneller Ebene
- Anforderungen auf institutioneller Ebene
- Praktische Anwendung des Empowerment-Konzeptes am Beispiel der Schuldnerberatung des Kreises Heinsberg
- Gesetzliche und strukturelle Rahmenbedingungen der Schuldnerberatung
- Umsetzbarkeit des Empowerment-Konzeptes in der Schuldnerberatung
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Empowerment-Konzept in der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die historische Entwicklung und die Ziele des Konzeptes. Darüber hinaus werden die Kompetenzanforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Kontext von Empowerment erörtert. Die Arbeit untersucht die praktische Anwendung des Konzeptes am Beispiel der Schuldnerberatung des Kreises Heinsberg.
- Theoretische Grundlagen und historische Entwicklung des Empowerment-Konzeptes
- Ziele von Empowerment auf individueller, sozialer und institutioneller Ebene
- Kompetenzanforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Kontext von Empowerment
- Praktische Anwendung des Empowerment-Konzeptes in der Schuldnerberatung
- Herausforderungen und Möglichkeiten der Umsetzung von Empowerment in der Schuldnerberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor, die sich mit der Umsetzbarkeit des Empowerment-Konzeptes im Arbeitsfeld der Schuldnerberatung beschäftigt. Der theoretische und historische Hintergrund des Empowerment-Konzeptes wird im zweiten Kapitel beleuchtet. Es werden die verschiedenen Dimensionen von Empowerment, die politische und die professionelle, sowie die Entstehung des Konzeptes in den USA und in Deutschland dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich den Zielen von Empowerment. Es werden die Ziele auf individueller Ebene, wie die Stärkung der persönlichen Fähigkeiten und die Förderung von Selbstbestimmung, sowie die Ziele auf der Ebene der sozialen Netzwerke, wie der Aufbau von Selbsthilfeinitiativen und Solidargemeinschaften, beschrieben.
Im vierten Kapitel werden die Kompetenzanforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Kontext von Empowerment erörtert. Es werden die Anforderungen auf intrapersoneller Ebene, wie die Bereitschaft zur Selbstreflexion und die Sensibilität gegenüber den Fähigkeiten der Klienten, sowie die Anforderungen auf interpersoneller Ebene, wie die Fähigkeit zur gleichberechtigten Beziehungsgestaltung und die Frustrationstoleranz, beschrieben.
Das fünfte Kapitel widmet sich der praktischen Anwendung des Empowerment-Konzeptes am Beispiel der Schuldnerberatung des Kreises Heinsberg. Es werden die gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der Schuldnerberatung, wie die rechtlichen Vorgaben und die zeitlichen Einschränkungen, sowie die Umsetzbarkeit des Empowerment-Konzeptes in diesem Arbeitsfeld beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Empowerment-Konzept, die Soziale Arbeit, die Schuldnerberatung, die Selbstbestimmung, die Autonomie, die Kompetenzanforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die praktische Anwendung des Empowerment-Konzeptes im Arbeitsfeld der Schuldnerberatung.
- Quote paper
- Vera van Ool (Author), 2012, Das Empowerment-Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202698