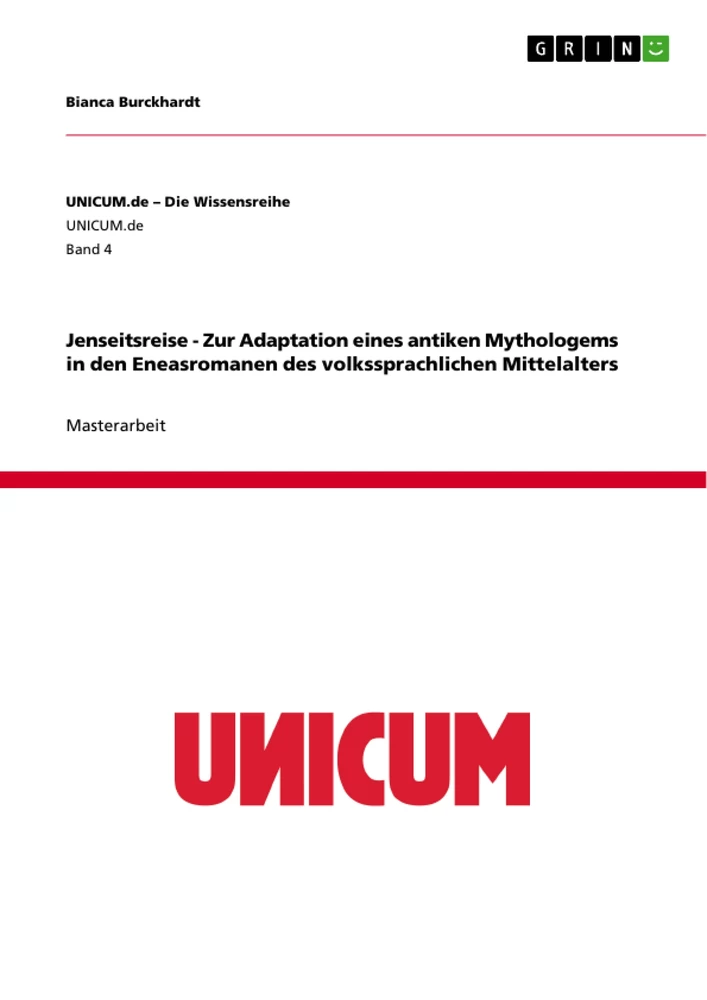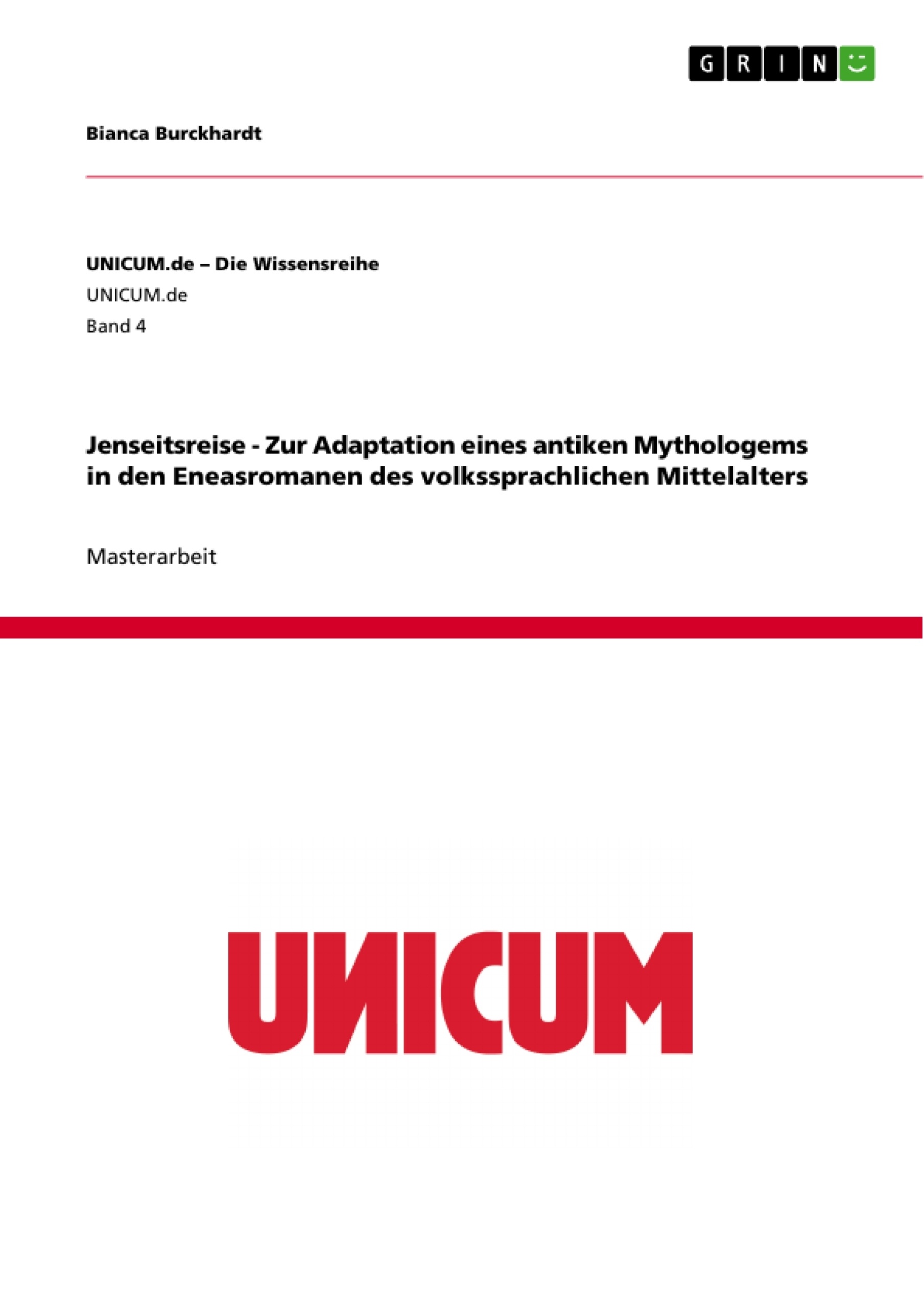INHALTSVERZEICHNIS
1. Einführung: Tod und Jenseits in den Kulturen 1
1.1 Jenseitsvorstellungen in der römischen Antike 4
1.2 Jenseitsvorstellungen im christlichen Mittelalter 8
1.2.1 Biblische und frühchristliche Texte 8
1.2.2 Visionsliteratur des Mittelalters 12
2. Vergil: Aeneis (um 29-19 v. Chr.) 15
2.1 Die Unterweltsfahrt 16
2.2 Bedeutung Vergils für das Mittelalter 20
3. Der Roman d’Eneas und Veldekes Eneit 21
3.1 Vorbemerkung: Der Antikenroman 23
3.2 Veränderungen der Unterweltsfahrt 24
3.2.1 Die Götter 25
3.2.1.1 Einfluss der olympischen Götter und des christlichen Gottes 26
3.2.1.2 Hades, Persephone und der Teufel 30
3.2.2 Sibylle, die Grenzgängerin 33
3.2.3 Kreaturen der Unterwelt 38
3.2.3.1 Personifikationen, Monster und andere Tiere 39
3.2.3.2 Charon, der Fährmann 44
3.2.3.3 Cerberus, der Höllenhund 46
3.2.3.4 Minos und Rhadamantus, Richter und Herrscher 49
3.2.4 Topographie der Unterwelt 51
3.2.4.1 Der Eingang zur Unterwelt 52
3.2.4.2 Am Ufer des Styx bzw. Phlegeton 54
3.2.4.3 Die Asphodelischen Felder und das Purgatorium 57
3.2.4.4 Tartarus und die eigentliche Hölle 61
3.2.4.5 Elysium und Paradies 65
3.2.5 Seele und Seelenwanderung 69
4. Fazit 75
5. Literaturverzeichnis 80
6. Abbildungsverzeichnis 85
7. Anhang 86
7.1 Bilder der Handschrift h (Heidelberger Papierhandschrift) – Cod.pal.germ. 403 86
7.2 Bilder der Handschrift B (Berliner Miniaturhandschrift) – Cod.germ.Fol. 282 88
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: Tod und Jenseits in den Kulturen
- 1.1 Jenseitsvorstellungen in der römischen Antike
- 1.2 Jenseitsvorstellungen im christlichen Mittelalter
- 1.2.1 Biblische und frühchristliche Texte
- 1.2.2 Visionsliteratur des Mittelalters
- 2. Vergil: Aeneis (um 29-19 v. Chr.)
- 2.1 Die Unterweltsfahrt
- 2.2 Bedeutung Vergils für das Mittelalter
- 3. Der Roman d'Eneas und Veldekes Eneit
- 3.1 Vorbemerkung: Der Antikenroman
- 3.2 Veränderungen der Unterweltsfahrt
- 3.2.1 Die Götter
- 3.2.1.1 Einfluss der olympischen Götter und des christlichen Gottes
- 3.2.1.2 Hades, Persephone und der Teufel
- 3.2.2 Sibylle, die Grenzgängerin
- 3.2.3 Kreaturen der Unterwelt
- 3.2.3.1 Personifikationen, Monster und andere Tiere
- 3.2.3.2 Charon, der Fährmann
- 3.2.3.3 Cerberus, der Höllenhund
- 3.2.3.4 Minos und Rhadamantus, Richter und Herrscher
- 3.2.4 Topographie der Unterwelt
- 3.2.4.1 Der Eingang zur Unterwelt
- 3.2.4.2 Am Ufer des Styx bzw. Phlegeton
- 3.2.4.3 Die Asphodelischen Felder und das Purgatorium
- 3.2.4.4 Tartarus und die eigentliche Hölle
- 3.2.4.5 Elysium und Paradies
- 3.2.5 Seele und Seelenwanderung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Adaption des antiken Mythologems der Unterweltsfahrt in mittelhochdeutschen Eneasromanen. Ziel ist es, die Veränderungen und Umdeutungen des antiken Stoffes im Kontext der christlichen Mittelalterlichen Weltanschauung zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Rezeption und Transformation von Motiven, Figuren und Topographie der Unterwelt.
- Vergleich der Jenseitsvorstellungen der römischen Antike und des christlichen Mittelalters
- Analyse der Adaption der Vergilschen Aeneis in den mittelhochdeutschen Eneasromanen
- Untersuchung der Veränderungen von Figuren (Götter, Sibylle, Unterweltwesen) und der Topographie der Unterwelt
- Die Rolle des christlichen Glaubens bei der Umdeutung antiker Motive
- Kulturtransfer zwischen römisch-heidnischer Antike und christlichem Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Tod und Jenseits in den Kulturen: Diese Einführung beleuchtet den Tod als universelle menschliche Erfahrung und das damit verbundene Geheimnis des Jenseits. Sie vergleicht die Jenseitsvorstellungen der römischen Antike, geprägt von Pessimismus und dem Glauben an diffuse Geister, mit den christlichen Vorstellungen des Mittelalters, die von der Hoffnung auf Belohnung oder Bestrafung im Jenseits nach den eigenen Taten geprägt sind. Der Fokus liegt auf dem Kontrast zwischen den eher düsteren antiken und den hoffnungsvolleren christlichen Weltbildern und der Bedeutung der Christianisierung für den Umgang mit dem Thema Tod und Jenseits. Die Integration antiker Elemente in die christliche Theologie wird als ein zentrales Thema hervorgehoben.
2. Vergil: Aeneis (um 29-19 v. Chr.): Dieses Kapitel widmet sich Vergils Aeneis und insbesondere der Unterweltsfahrt des Aeneas. Es beleuchtet die Bedeutung Vergils für das Mittelalter und die Rezeption seines Werkes durch spätere Autoren. Die Darstellung der Unterwelt in der Aeneis dient als Grundlage für den Vergleich mit den mittelhochdeutschen Adaptionen und zeigt die Ursprünge der Motive und Figuren, die später in den Eneasromanen eine veränderte Rolle spielen werden. Der Fokus liegt hier auf der ursprünglichen Darstellung der Unterwelt, die als Referenzpunkt für spätere Interpretationen dient.
3. Der Roman d'Eneas und Veldekes Eneit: Das Kernstück der Arbeit analysiert die mittelhochdeutschen Eneasromane, insbesondere den Roman d'Eneas und Veldekes Eneit. Es wird die Transformation der Vergilschen Unterweltsfahrt im Kontext des christlichen Mittelalters untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf die Veränderungen von Figuren wie den Göttern, der Sibylle und den Kreaturen der Unterwelt, sowie auf die Anpassung der Topographie. Die Einflüsse des christlichen Glaubens auf die Umdeutung heidnischer Elemente werden detailliert untersucht. Der Kapitel legt großen Wert auf die detaillierte vergleichende Analyse der beiden Romane.
Schlüsselwörter
Jenseitsvorstellungen, Antike, Mittelalter, Aeneis, Vergil, Roman d'Eneas, Veldekes Eneit, Unterweltsfahrt, christliche Theologie, heidnische Elemente, Kulturtransfer, Adaption, Transformation, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Adaption des antiken Mythologems der Unterweltsfahrt in mittelhochdeutschen Eneasromanen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie das antike Mythologem der Unterweltsfahrt in mittelhochdeutschen Eneasromanen adaptiert wurde. Es geht um die Analyse der Veränderungen und Umdeutungen des antiken Stoffes im Kontext der christlichen mittelalterlichen Weltanschauung.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf Vergil's Aeneis als Grundlage und vergleicht diese mit den mittelhochdeutschen Eneasromanen, insbesondere dem Roman d'Eneas und Veldekes Eneit. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Darstellung der Unterwelt in diesen Texten.
Welche Aspekte der Unterweltsfahrt werden analysiert?
Die Analyse umfasst Veränderungen und Umdeutungen von Motiven, Figuren (Götter, Sibylle, Unterweltwesen wie Charon, Cerberus, Minos und Rhadamantus) und der Topographie der Unterwelt (Eingang, Styx/Phlegeton, Asphodelische Felder, Purgatorium, Tartarus, Elysium). Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle des christlichen Glaubens bei der Umdeutung antiker Motive.
Wie werden die Jenseitsvorstellungen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Jenseitsvorstellungen der römischen Antike (pessimistisch, Glaube an diffuse Geister) mit den christlichen Vorstellungen des Mittelalters (Hoffnung auf Belohnung oder Bestrafung nach den eigenen Taten). Der Kontrast zwischen den Weltbildern und die Bedeutung der Christianisierung für den Umgang mit Tod und Jenseits werden untersucht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel ist es, die Rezeption und Transformation von Motiven, Figuren und Topographie der Unterwelt in den mittelhochdeutschen Eneasromanen im Kontext des christlichen Mittelalters zu analysieren und den Kulturtransfer zwischen römisch-heidnischer Antike und christlichem Mittelalter zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jenseitsvorstellungen, Antike, Mittelalter, Aeneis, Vergil, Roman d'Eneas, Veldekes Eneit, Unterweltsfahrt, christliche Theologie, heidnische Elemente, Kulturtransfer, Adaption, Transformation, Rezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel über Vergils Aeneis, ein Kapitel über die mittelhochdeutschen Eneasromane und ein Fazit. Die Einführung vergleicht die Jenseitsvorstellungen der Antike und des Mittelalters. Das Kapitel zu Vergil dient als Grundlage für den Vergleich mit den mittelhochdeutschen Adaptionen. Das Hauptkapitel analysiert detailliert die Veränderungen in den mittelhochdeutschen Eneasromanen.
Welche konkreten Veränderungen werden in den mittelhochdeutschen Eneasromanen untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert den Einfluss des christlichen Glaubens auf die Umdeutung heidnischer Elemente, Veränderungen bei den Göttern (Einfluss olympischer Götter und des christlichen Gottes, Hades, Persephone und der Teufel), der Sibylle als Grenzgängerin, den Kreaturen der Unterwelt und der Topographie der Unterwelt (Eingang, Ufer des Styx/Phlegeton, Asphodelische Felder/Purgatorium, Tartarus/Hölle, Elysium/Paradies).
- Arbeit zitieren
- Bianca Burckhardt (Autor:in), 2012, Jenseitsreise - Zur Adaptation eines antiken Mythologems in den Eneasromanen des volkssprachlichen Mittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202018