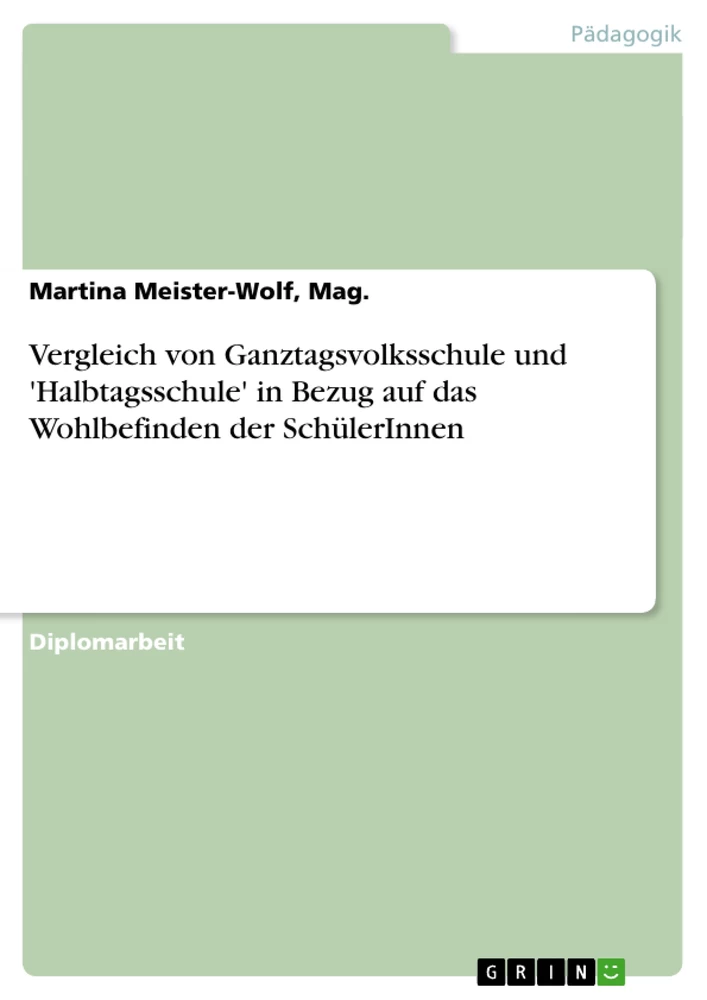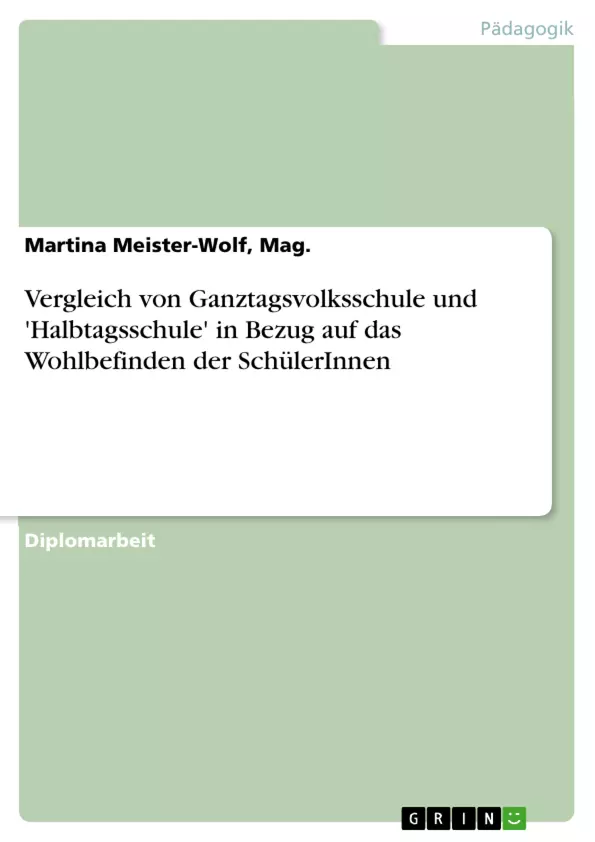Geänderte Familienformen, die Berufstätigkeit beider Elternteile und die finanzielle Situation machen das Angebot an ganztägigen Schulformen notwendig. In der Ganztagsschule verbringen die SchülerInnen täglich mindestens 8 Stunden.
Die vorliegende Untersuchung mittels Fragebogen soll einen Einblick bieten, wie es um das Wohlbefinden der Kinder bestellt ist. Das Ergebnis zeigt, dass die Streit- und Konfliktbereitschaft an Ganztagsschulen hoch ist. Dementsprechend ist auch das Sozialklima schlecht. In den anderen Bereichen, in denen signifikante Werte festgestellt wurden, weist die Ganztagsschule meistens deutlich bessere Werte auf. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bewältigung des Leistungsdrucks gut funktioniert, dass die aktive Beteiligung am Unterrichtsgeschehen relativ hoch ist und dass sich die SchülerInnen von den Lehrpersonen in Ganztagschulen gerechter behandelt fühlen. Auch bei Schulveranstaltungen schneiden die ProbandInnen aus der Ganztagsschule deutlich besser ab, als die Vergleichsgruppe an „Halbtagsschulen“. Die Ganztagsschule kann und will dennoch kein „Elternersatz“ sein.
Inhaltsverzeichnis
- A. THEORETISCHER TEIL - SCHULORGANISATIONSFORM
- 1 BEGRIFFSKLÄRUNG UND MODELLBESCHREIBUNG: GANZTÄGIGE SCHULEN
- 1.1 Ganztagsschule (GTS)
- 1.2 Offene Schule
- 1.3 Tagesheimschule (THS)
- 1.4 Pädagogische Ansätze
- 1.4.1 Additive Modelle
- 1.4.2 Integrierte Modelle
- 2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
- 3 ANLÄSSE FÜR NOTWENDIGKEIT GANZTÄGIGER SCHULFORMEN
- 3.1 Familiäre Situation
- 3.2 Veränderung im Erzieherverhalten
- 4 DIE GANZTAGSSCHULE
- 4.1 Basissätze der Ganztagsvolksschule
- 4.2 Funktionen und Aufgaben der Ganztagsschule
- 4.2.1 Qualifikationsfunktion
- 4.2.2 Motivationsfunktion
- 4.2.3 Sozialisationsfunktion
- 4.2.4 Kompensationsfunktion
- 4.2.5 Außerschulischer Bereich
- 4.3 Argumente für die Ganztagsschule
- 4.4 Argumente gegen die Ganztagsschule
- 4.5 Modell der Ganztagsvolksschule mit Parallellehrersystem
- 4.5.1 Förderstunden (FÖ)
- 4.5.2 Lernstunde (L)
- 4.5.3 Freizeitstunden (F)
- 4.5.4 Mittagspause - Mittagessen (M)
- 4.5.5 Frühdienst
- 4.5.6 Spätdienst
- 5 ANGEBOT AN GANZTÄGIG GEFÜHRTEN VOLKSSCHULEN IN ÖSTERREICH
- B. THEORETISCHER TEIL - WOHLBEFINDEN
- 6 ZUR BEGRIFFSKLÄRUNG DER BEFINDLICHKEIT
- 6.1 Begriffsbestimmung
- 6.1.1 Definitionen
- 6.1.2 Dimensionen der Befindlichkeit in der Schule
- 6.2 Subjektives Wohlbefinden
- 6.3 Unterscheidung zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden
- 6.3.1 Aktuelles Wohlbefinden (AW)
- 6.3.2 Habituelles Wohlbefinden (HW)
- 6.4 Einflussfaktoren der Befindlichkeit
- 6.4.1 Lebensereignisse
- 6.4.2 Schulische Belastungen
- 6.4.3 Soziale Faktoren
- 6.5 Auswirkungen der Befindlichkeit
- 6.6 Aspekte des Befindens in der Schule
- 6.6.1 Ökologisches Entwicklungsmodell nach Bronfenbrenner
- 6.6.2 Ordnungsmodell für Komponenten und Determinaten des Befindens in der Schule
- 7 BEGRIFFSKLÄRUNG - "KLIMA"
- 7.1 Schulklimatypen
- 7.1.1 Schulklimatypen nach Oswald
- 7.1.2 Klimatypen nach Eder
- 7.2 Klassenklima
- 7.3 Unterrichtsklima
- 7.4 Sozialklima
- C. EMPIRISCHER TEIL
- 8 UNTERSUCHUNG
- 8.1 Problemstellung
- 8.2 Formulierung der Hypothesen
- 8.2.1 Sozialklima (Lehrerlnr-Schülerln-Verhältnis)
- 8.2.2 Unterrichtsklima
- 8.2.3 Klassenklima
- 8.2.4 Schulklima
- 8.2.5 Elterninteresse
- 8.3 Vorbereitung der Fragebogenerhebung
- 8.3.1 Durchführung der Untersuchung
- 9 BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
- 9.1 Deskriptive Darstellung der Items des Fragebogens
- 9.1.1 Wesentliche statistische Kennwerte der Items
- 9.1.2 Itemschwierigkeiten (Schwierigkeitsindex)
- 9.2 Datenaufbereitung und Datenreduktion
- 9.2.1 Faktorenanalyse
- 9.3 Zusammenfassung
- 10 ÜBERPRÜFUNG DER ARBEITSHYPOTHESEN
- 10.1 Unterschiede zwischen Ganztags- und „Halbtagsschulen“
- 10.1.1 Lehrerpersönlichkeit
- 10.1.2 Mitbestimmung der SchülerInnen
- 10.1.3 Gefühl, gerecht behandelt zu werden
- 10.1.4 Vermittlungsqualität
- 10.1.5 Leistungsdruck
- 10.1.6 Aktive Mitbeteiligung am Unterrichtsgeschehen
- 10.1.7 Freizeitverhalten
- 10.1.8 Kontrolle durch die LehrerInnen
- 10.1.9 Sozialklima (Schülerln-SchülerIn-Verhältnis)
- 10.1.10 Streit- und Konfliktbereitschaft
- 10.1.11 Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz Schule
- Vergleich des Wohlbefindens von Schülerinnen an Ganztags- und Halbtagsschulen
- Analyse des Sozialklimas an beiden Schulformen
- Untersuchung des Einflusses der Schulform auf den Umgang mit Leistungsdruck
- Bewertung der aktiven Beteiligung am Unterricht
- Erfassung des Gerechtigkeitsempfindens der Schülerinnen im Lehrer-Schüler-Verhältnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Wohlbefinden von Schülerinnen an Ganztags- und Halbtagsschulen in Österreich. Ziel ist es, mithilfe eines Fragebogens Vergleiche in verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens anzustellen und Unterschiede zwischen den beiden Schulformen aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
A. THEORETISCHER TEIL - SCHULORGANISATIONSFORM: Dieser Teil der Arbeit legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Er definiert den Begriff der Ganztagsschule, differenziert zwischen verschiedenen Modellen (GTS, Offene Schule, THS) und beschreibt deren pädagogische Ansätze. Die historische Entwicklung ganztägiger Schulformen in Österreich wird ebenso beleuchtet wie die gesellschaftlichen und familiären Veränderungen, die zu ihrer Notwendigkeit geführt haben. Schließlich werden Argumente für und gegen die Ganztagsschule diskutiert, inklusive einer detaillierten Beschreibung des Modells der Ganztagsvolksschule mit Parallellehrersystem.
B. THEORETISCHER TEIL - WOHLBEFINDEN: Der zweite theoretische Teil befasst sich umfassend mit dem Begriff des Wohlbefindens, seiner Definition und den verschiedenen Dimensionen im schulischen Kontext. Es werden subjektives Wohlbefinden, aktuelle und habituelle Befindlichkeit unterschieden und wichtige Einflussfaktoren wie Lebensereignisse, schulische Belastungen und soziale Faktoren analysiert. Zusätzlich werden relevante Modelle wie das ökologische Entwicklungsmodell nach Bronfenbrenner und ein Ordnungsmodell für Komponenten und Determinanten des Wohlbefindens in der Schule vorgestellt. Schließlich wird der Begriff des „Klimas“ (Schulklima, Klassenklima, Unterrichtsklima, Sozialklima) eingegrenzt und definiert.
C. EMPIRISCHER TEIL: Der empirische Teil beschreibt die durchgeführte Untersuchung, beginnend mit der Problemstellung und der Formulierung von Hypothesen zu verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens und des Schulklimas. Die Methoden der Datenerhebung und -aufbereitung werden detailliert dargestellt, einschließlich der Beschreibung der Stichprobe und der angewandten statistischen Verfahren. Die Ergebnisse werden prägnant zusammengefasst, bevor der abschließende Teil die Überprüfung der Arbeitshypothesen im Detail darstellt.
Schlüsselwörter
Ganztagsschule, Halbtagsschule, Wohlbefinden, Schüler, Sozialklima, Leistungsdruck, Fragebogen, empirische Untersuchung, Österreich, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Schulklima.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Wohlbefinden von Schülerinnen an Ganztags- und Halbtagsschulen in Österreich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Wohlbefinden von Schülerinnen an Ganztags- und Halbtagsschulen in Österreich. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich verschiedener Aspekte des Wohlbefindens und der Aufdeckung von Unterschieden zwischen den beiden Schulformen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen theoretischen Teil zur Schulorganisationsform (Ganztagsschule) und zum Wohlbefinden sowie einen empirischen Teil mit einer eigenen Untersuchung. Der theoretische Teil definiert verschiedene Modelle der Ganztagsschule, beleuchtet deren historische Entwicklung in Österreich und diskutiert Argumente für und gegen diese Schulform. Der Wohlbefinden-Teil behandelt Definitionen, Dimensionen und Einflussfaktoren des Wohlbefindens im schulischen Kontext, inklusive verschiedener Klima-Aspekte (Schul-, Klassen-, Unterrichtsklima). Der empirische Teil beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Datenerhebung und -auswertung sowie die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht unter anderem den Vergleich des Wohlbefindens, die Analyse des Sozialklimas, den Einfluss der Schulform auf den Umgang mit Leistungsdruck, die aktive Beteiligung am Unterricht und das Gerechtigkeitsempfinden der Schülerinnen im Lehrer-Schüler-Verhältnis an Ganztags- und Halbtagsschulen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Im empirischen Teil wurde eine Fragebogenerhebung durchgeführt. Die Daten wurden mittels statistischer Verfahren (z.B. Faktorenanalyse) aufbereitet und ausgewertet. Die Arbeit beschreibt detailliert die Methoden der Datenerhebung, -aufbereitung und -reduktion.
Welche Arten von Ganztagsschulen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Modellen der Ganztagsschule, darunter die Ganztagsschule (GTS), die Offene Schule und die Tagesheimschule (THS). Es werden auch unterschiedliche pädagogische Ansätze (additive und integrierte Modelle) beschrieben.
Welche Aspekte des Wohlbefindens werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Dimensionen des Wohlbefindens, darunter subjektives Wohlbefinden, aktuelles und habituelles Wohlbefinden. Es werden auch Einflussfaktoren wie Lebensereignisse, schulische Belastungen und soziale Faktoren analysiert.
Welche Hypothesen wurden formuliert?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zu verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens und des Schulklimas (Sozialklima, Unterrichtsklima, Klassenklima, Schulklima, Elterninteresse) im Vergleich zwischen Ganztags- und Halbtagsschulen. Die Hypothesen beziehen sich auf Lehrer-Schüler-Verhältnis, Mitbestimmung der Schülerinnen, Gerechtigkeitsempfinden, Vermittlungsqualität, Leistungsdruck, aktive Unterrichtsbeteiligung, Freizeitverhalten, Kontrolle durch Lehrerinnen, Schüler-Schüler-Verhältnis, Streit- und Konfliktbereitschaft und Zufriedenheit mit der Schule.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil behandelt die Schulorganisationsform und das Wohlbefinden. Der empirische Teil beschreibt die Untersuchung, die Stichprobe, die Datenanalyse und die Überprüfung der Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ganztagsschule, Halbtagsschule, Wohlbefinden, Schüler, Sozialklima, Leistungsdruck, Fragebogen, empirische Untersuchung, Österreich, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Schulklima.
- Quote paper
- Martina Meister-Wolf, Mag. (Author), 2003, Vergleich von Ganztagsvolksschule und 'Halbtagsschule' in Bezug auf das Wohlbefinden der SchülerInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20110