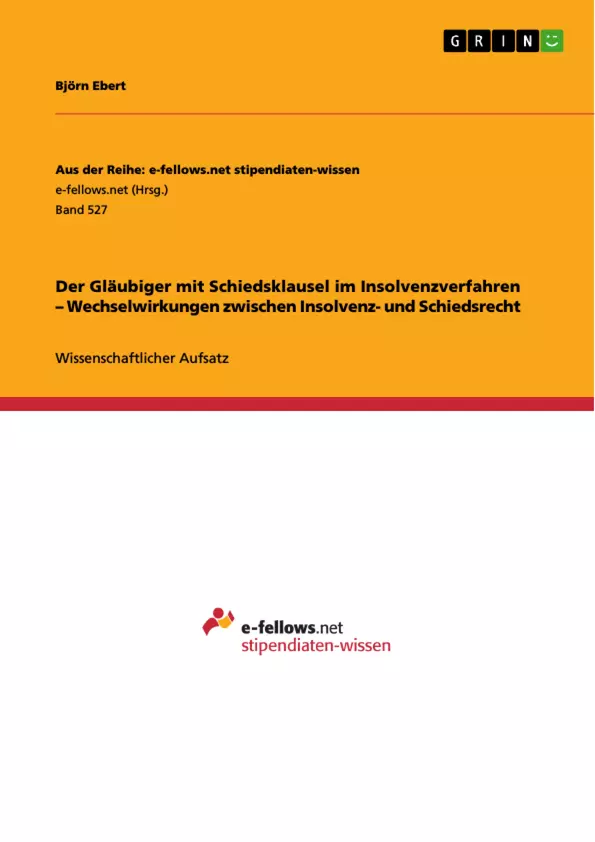Sowohl die Insolvenzordnung als auch die Schiedsgerichtsbarkeit stellen zwei Sonderrechte dar. In weiten Teilen unklar ist, welche Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Sonderrechten bestehen und ob und inwieweit das eine durch das jeweils andere begrenzt beziehungsweise ergänzt wird. So stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners auf eine streitige Forderung eines Gläubigers hat, wenn sich diese Forderung aus einem Vertrag ergibt, in dem eine Schiedsklausel enthalten ist. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Besonderheiten beider Rechte soll Ausgangspunkt der Überlegungen sein, ob der Gläubiger dieser Forderung am Insolvenzverfahren teilnehmen kann oder dies sogar muss, obwohl er sich im Rahmen seiner Privatautonomie bewusst der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen hat.
Der Gläubiger mit Schiedsklausel im Insolvenzverfahren - Wechselwirkungen zwischen Insolvenz- und Schiedsrecht*
Björn P. Ebert
Sowohl die Insolvenzordnung als auch die Schiedsgerichtsbarkeit stellen zwei Sonderrechte dar. In weiten Teilen unklar ist, welche Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Sonderrechten bestehen und ob und inwieweit das eine durch das jeweils andere begrenzt bzw. ergänzt wird. So stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners auf eine streitige Forderung eines Gläubigers hat, wenn sich diese Forderung aus einem Vertrag ergibt, in dem eine Schiedsklausel enthalten ist. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Besonderheiten beider Rechte, soll Ausgangspunkt der Überlegungen sein, ob der Gläubiger dieser Forderung, obwohl er sich im Rahmen seiner Privatautonomie bewusst der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen hat, trotzdem am Insolvenzverfahren teilnehmen kann oder dies sogar muss.
A. Einleitung
Gerade in Insolvenzverfahren großer Unternehmen kann es gelegentlich vorkommen, dass sich in Verträgen Schiedsklauseln befinden und sich so im Insolvenzfall Berührungspunkte zwischen Insolvenz- und Schiedsrecht ergeben. Hierbei lassen sich streitige Forderungen sowohl aus Sicht des insolventen Schuldners, als auch des Gläubigers betrachten. Stehen dem Schuldner Forderungen gegen einen Gläubiger zu, so kann der Insolvenzverwalter, soweit der Gläubiger nicht freiwillig leistet, die Masse durch Klageerhebung anreichern. Aufgrund des Schiedsvertrages sollte dies dann im Wege der Schiedsklage geschehen.1 Stehen dagegen dem Gläubiger Forderungen zu, sind zwei Situationen zu unterscheiden: Zum einen könnte die Schiedsklage noch nicht anhängig sein, zum anderen könnte deren Anhängigkeit bereits gegeben sein. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob ein Gläubiger seine streitige Forderung in diesen beiden Fällen zur Tabelle gem. §§ 87, 174 ff. InsO anmelden kann beziehungsweise muss, obwohl eine diese Forderung betreffende Schiedsklausel existiert. Also damit, ob eine solche Forderung insolvenztauglich ist. Dabei beschränkt sich die Darstellung auf innerdeutsche Schiedsverfahren und das deutsche Insolvenzrecht.
B. Wesen der Schiedsgerichtsbarkeit
Schiedsgerichte sind private Gerichte, die für den Einzelfall Rechtsprechungsfunktion ausüben (§ 1055 ZPO). Ihnen ist die Entscheidung über Rechtstreitigkeiten anstelle staatlicher Gerichte überlassen.2 Schiedsgerichtsbarkeit ist daher Ausfluss der Privatautonomie. Die Ausübung der Privatautonomie tritt dabei je nach Art des Schiedsgerichts (ad-hoc oder institutionelles Schiedsverfahren) stärker oder schwächer in den Vordergrund. Die Zulässigkeit solch einer privaten Streitbeilegung ergibt sich aus der zivilrechtlichen Dispositionsmaxime.3 Materiell können die Parteien auf Ansprüche verzichten, oder prozessual die Verfolgung ausschließen oder einschränken. Daher ist folgerichtig auch die private Streitbelegung in Form privater Spruchkörper zugelassen, §§ 1025 ff. ZPO. Da nun aber Schiedsgerichte Rechtsprechungsfunktion ausüben, bedarf es der Sicherstellung eines Verfahrens, das den, durch das Grundgesetz verbrieften, Rechtschutzgarantien genügt.4 Daher verbleiben bestimmte Funktionen bei den staatlichen Gerichten (z.B. §§ 1032 I, II, 1040 III, 1035 ff., 1060 f., 1033, 1050 ZOP).5 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schiedsgerichtsbarkeit Produkt der Privatautonomie ist, wobei die staatlichen Gerichte weitestgehend ausgeschlossen sind (Prorogations- und Derogationswirkung).
C. Wesen des Insolvenzrechts
Das Insolvenzrecht befasst sich mit der Situation des Schuldners, der seine (Zahlungs-) Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht (mehr) erfüllen kann. Dabei ist die Situation des Schuldners durch (drohende) Zahlungsunfähigkeit (§§ 17, 18 InsO) oder durch Überschuldung (§ 19 InsO) gekennzeichnet. Dabei verfolgt das „neue Insolvenzrecht“ vorrangig das Ziel der Fortführung des insolventen Unternehmens oder der Restschuldbefreiung bei natürlichen Personen, jedenfalls aber der Verwertung des Schuldnervermögens (§ 1 InsO).6 Um dieses Ziel zu erreichen, begründet die Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Sonderrechtsstellung zwischen dem Schuldner und den Gläubigern, die weitgehend ihren eignen Regeln folgt.7 Dabei obliegen dem Insolvenzverwalter verschiedene Kompetenzen um die Masse anzureichern und dadurch die Gläubiger nach dem Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung bestmöglich zu befriedigen. Dabei kann der Insolvenzverwalter nicht nur die Erfüllung bestehender Verträge verweigern (§ 113 InsO), sondern auch in der Vergangenheit längst vollzogene Rechtsgeschäfte rückgängig machen (§§ 129 ff. InsO). Daher gibt die Insolvenzordnung dem Insolvenzverwalter Kompetenzen, die denen staatlicher Gewaltausübung gleichstehen.8 Um aber die Ziele der Insolvenzordnung, die in § 1 InsO beschrieben sind, zu erreichen, existieren bei Unternehmensinsolvenzen Antragspflichten zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (§ 15a InsO, sowie in Spezialgesetzen GmbHG etc.).9 Durch all diese Reglungen des Insolvenzrechtes wird in erheblichem Maße in die Rechte des Schuldners, aber auch die der Gläubiger eingegriffen. Zusammenfassend stellt das Insolvenzrecht daher, gerade auch bei Unternehmensinsolvenzen, einen weitreichenden Eingriff in die Privatautonomie dar.
D. Wertung und Vorrang des Insolvenzrechtes.
Aufgrund der dargestellten Wesen der Schiedsgerichtsbarkeit und des Insolvenzrechts stellt sich die Frage, ob das Schieds- oder Insolvenzrecht vorrangig ist, falls der Gläubiger eine streitige
Forderung gegen den Schuldner hat. Denkbar ist allerdings auch, dass sich Insolvenz- und Schiedsrecht gegenseitig beeinflussen und so ergänzen. Dabei sollte Ausgangspunkt der Überlegungen sein, ob sich ein Gläubiger, der sich durch die Vereinbarung einer (wirksamen) Schiedsklausel der staatlichen Gewaltausübung, also der staatlichen Gerichte freiwillig entzogen hat, nun im Wege der Insolvenz des Schuldners (das heißt nach Wirksamkeit des Insolvenzeröffnungsbeschlusses) wieder unter den Schirm der staatlichen Gewalt in Form des Insolvenzverfahrens flüchten kann. Im Folgenden wird zwischen den beiden möglichen Situationen, nämlich der noch nicht anhängigen Schiedsklage (I) und der der bereits anhängigen Schiedsklage (II), unterschieden.
I. Bei noch nicht anhängiger Schiedsklage
Ist eine Schiedsklage nach Wirksamkeit des Eröffnungsbeschlusses des Insolvenzverfahrens noch nicht anhängig, stellt sich zunächst die Frage, was die Folge wäre, wenn der Gläubiger nicht wieder unter den Schirm der staatlichen Gewalt in Form des Insolvenzverfahrens flüchten könnte. Soweit die Schiedsklausel zwischen Gläubiger und Schuldner wirksam vereinbart wurde, wären beide an die Schiedsklausel gebunden. Folge hiervon wäre, dass der Gläubiger seine streitige Forderung im Wege eines Schiedsverfahrens verfolgen, d.h. auf Leistung vor einem Schiedsgericht klagen muss. Nach erfolgreichem Abschluss des Schiedsverfahrens erhielte der Gläubiger einen Schiedsspruch zu seinen Gunsten. Mangels Leistungsfähigkeit wird der Schuldner regelmäßig dem Schiedsspruch nicht freiwillig nachkommen. Der Schiedsspruch an sich stellt jedoch keinen vollstreckungsfähigen Titel dar. Deshalb müsste der Gläubiger bei inländischen Schiedssprüchen im Anschluss an das Schiedsverfahren das Vollstreckbarkeiterklärungsverfahren betreiben.10 Soweit Hinderungsgründe des § 1060 ZPO nicht vorliegen, wird das zuständige Oberlandesgericht den Schiedsspruch für vollstreckbar erklären. Wäre Folge der Vereinbarung einer wirksamen Schiedsklausel, dass der Gläubiger kein Insolvenzgläubiger im Sinne von § 38 InsO ist, könnte der Gläubiger nach Abschluss des Vollstreckbarkeiterklärungsverfahrens aufgrund der nun gemäß § 794 I Nr. 4a ZPO vollstreckungsfähigen Entscheidung ungehindert in das sonstige Vermögen des Schuldners vollstrecken. Dies würde im Zweifel einen geringeren Forderungsausfall des Gläubigers bedeuten, als wenn sich dieser am Insolvenzverfahren hätte beteiligen müssen. Denn dann hätte der Gläubiger möglicherweise lediglich eine geringe Quotenzahlung erhalten.
Demzufolge scheint die Ausgangsüberlegung fehl zu gehen und würde besser konträr formuliert sein, nämlich dahingehend, ob sich ein Gläubiger trotz wirksamer Schiedsklausel am Insolvenzverfahren des Schuldners beteiligen muss. Sollte er dies nämlich müssen, so erhielte er lediglich dieselbe Quotenzahlung wie alle sonstigen Gläubiger. Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung wären dann auch gemäß § 89 I InsO ausgeschlossen.
§ 87 InsO schreibt vor: „[d]ie Insolvenzgläubiger können ihre Forderungen nur nach den Vorschriften über das Insolvenzverfahren verfolgen.“ Hintergrund dieser Vorschrift ist der Schutz des Schuldners Dieser soll während eines Insolvenzverfahrens möglichst nur nach den Vorgaben der Insolvenzordnung in Anspruch genommen werden können.11 Damit wird gleichzeitig sichergestellt, dass keiner der Gläubiger des Schuldners im Vergleich zu anderen
Gläubigern des Schuldners benachteiligt wird.12 § 87 InsO legt folglich den die Insolvenzordnung durchziehenden Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung fest.13 Dadurch wird zwar die Privatautonomie zulasten eines Gläubigers eingeschränkt, zugleich aber auch ein gewisser Schutz weniger versierten Gläubigern erzielt.14 Dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger liegt auch das Prinzip der weitestgehenden15 Chancengleichheit im Wettstreit um das restliche Vermögen des Schuldners zugrunde.16 Damit dient der Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz auch der Sicherstellung eines geordneten Verfahrens und soll so effektiven Rechtsschutz aller Gläubiger im Sinne von Art. 19 III GG ermöglichen.17 Der Sinn und Zweck des § 87 InsO rechtfertigt also die Beschränkung der Privatautonomie, aus der sich unter anderem auch die Zulässigkeit der Schiedsgerichtsbarkeit ergibt. Der Gläubiger muss sich daher trotz wirksamer Schiedsklausel am Insolvenzverfahren beteiligen.
Auf der anderen Seite wiederum ist sowohl der Gläubiger als auch der Insolvenzverwalter an die zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbarte Schiedsklausel gebunden ist,18 soweit diese nicht nach §§ 129 ff. InsO anfechtbar ist.19 Ist die Forderung des Gläubigers also strittig, muss dieser seine Rechte im Schiedsverfahren verfolgen. Ein Verzicht zur Teilnahme am Insolvenzverfahren ist im Gegensatz zur Konkursordnung nicht mehr möglich, sondern bringt erhebliche Einschränkungen mit sich.20 Das heißt er muss den Insolvenzverwalter vor einem Schiedsgericht verklagen. Zu Klagen ist aber nicht auf Leistung, da der Gläubiger sich ansonsten an die Vorschriften der Insolvenzordnung halten muss. Ein Leistungsurteil des Schiedsgerichtes wäre für den Gläubiger sinnlos, da ihm die Einzelvollstreckung durch § 89 I InsO verwehrt bleibt. Er kann daher lediglich (zumindest teilweise) Befriedigung erlangen, wenn seine Forderung gemäß §§ 174 ff. InsO zur Tabelle festgestellt ist.21 Daher hat der Gläubiger seine strittige Forderung zunächst zur Tabelle anzumelden. Sollte diese durch den Insolvenzverwalter bestritten werden22, so muss der Gläubiger vor einem Schiedsgericht auf Feststellung seiner Forderung zur Tabelle klagen.23 Hierbei wiederum ist zu beachten, ob eine Feststellungsklage auf Grundlage einer Schiedsklausel überhaupt Gegenstand eines Schiedsverfahren sein kann, d.h. diese Klageart von der Schiedsklausel umfasst ist. Dies dürfte bei gängigen Schiedsklausel regelmäßig der Fall sein. Denn diese unterstellen alle Streitigkeiten, die sich aus dem betroffenen Vertrag ergeben der Schiedsgerichtsbarkeit. Also auch die Streitigkeit, ob eine Forderung besteht oder nicht.
II. Bei bereits anhängiger Schiedsklage
Anders stellt sich die Situation dar, wenn bei Wirksamkeit des Eröffnungsbeschlusses bereits eine Schiedsklage des Gläubigers gegen den Schuldner anhängig ist. Hier kann nicht Ausgangsüberlegung sein, ob der Gläubiger wieder unter den Schutz staatlicher Gewalt flüchten kann, sondern welche Auswirkungen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners auf das bereits laufende Schiedsverfahren hat. Also, ob der Gläubiger das Schiedsverfahren zu Ende führen kann, mit der Folge, dass der Gläubiger im Erfolgsfalle einen Schiedsspruch, in dem der Schuldner zur Leistung verurteilt wird, erhält und anschließend nach Vollstreckbarkeitserklärung aus diesem vollstrecken kann. Wäre dies der Fall, könnte der Gläubiger § 89 I InsO umgehen und eine Zwangsvollstreckung in das sonstige Vermögen des Schuldners betreiben.
Wie oben dargelegt, schränkt der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung die Privatautonomie auf zulässige Weise ein. Die Insolvenzordnung muss also zwangsläufig Auswirkungen auf das bereits laufende Schiedsverfahren haben.
Durch den Eintritt der Insolvenz des Schuldners werden Schiedsverfahren zwar nicht von gesetzeswegen (§ 240 ZPO) unterbrochen,24 trotzdem können die Schiedsrichter das Schiedsverfahren nach pflichtgemäßem Ermessen aussetzen.25 Nach einer neueren Entscheidung des BGH dürfen Schiedsverfahren nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht weiter betrieben werden, bis Gelegenheit bestand die Forderungen gem. §§ 87, 174 ff. InsO zur Tabelle anzumelden.26 Diese Rechtsprechung erinnert stark an eine analoge Anwendung des § 240 ZPO, auch wenn der BGH dies nicht ausspricht. Für diese analoge Anwendung in Ausprägung des oben genannten BGH-Beschlusses spricht, dass eine schnelle und kostengünstige Entscheidung durch Anerkennung, d.h. Feststellung der Forderung durch den Insolvenzverwalter erfolgen kann. Zudem begrenzt bzw. ergänzt das Insolvenzrecht durch seinen zwingenden Charakter aus § 87 InsO, das Schiedsverfahrensrecht dahingehend, dass der Gläubiger letztendlich Befriedigung nur nach den Vorschriften des Insolvenzrechtes erlangen kann. Dies hat zur Folge, dass die Forderung des Gläubigers auf jeden Fall angemeldet und zur Tabelle festgestellt werden muss. Um diese Möglichkeit einzuräumen, ist eine kurzfristige Unterbrechung des Schiedsverfahrens durch eine analoge Anwendung des § 240 ZPO sinnvoll.27
Erkennt der Insolvenzverwalter die Forderung des Gläubigers an, so stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf das Schiedsverfahren hat. In diesem Fall besteht zunächst die Möglichkeit, dass der Gläubiger seine Klage zurücknehmen muss. Dies hieße aber, dass der Gläubiger die Kosten des Verfahrens tragen müsste, obwohl die Schiedsklage in der Sache wohl begründet war. Andererseits könnte das Schiedsgericht der Klage als begründet unter Kostentragungspflicht des Schuldners stattgeben. Dann wiederum stellt sich die Frage, was mit eventuellen Sicherheitsleistungen des Schuldners zur Verfahrenskostendeckung passiert. Möglich wäre auch, dass das Schiedsgericht bei Fortsetzung des Schiedsverfahrens entgegen der Schlüssigkeitsprüfung des Insolvenzverfahrens28 zum Ergebnis gelangt, dass die Schiedsklage des Gläubigers unbegründet ist. Dies würde dann die Frage aufwerfen, welche Auswirkungen dies auf die bereits zur Tabelle festgestellte Forderung des Gläubigers hat. Auf all diese Fragen kann im Rahmen dieses Beitrages nicht eingegangen werden.29 Zu zeigen war lediglich, welche Auswirkungen das Insolvenzrechtes auf das Schiedsverfahren hat und ob, das Schiedsrecht durch das Insolvenzrecht begrenzt oder ergänzt wird.
Anders stellt sich die Situation dar, sollte der Insolvenzverwalter die angemeldete Forderung des Gläubigers nicht anerkennen. In diesem Fall kann das schiedsgerichtliche Verfahren mit der Maßgabe fortgesetzt werden, dass der Insolvenzverwalter als Partei im Schiedsverfahren tätig wird.30 Die bisherige Leistungsklage vor dem Schiedsgericht ist dann auf Feststellung der Forderung zur Tabelle umzustellen. Vertreten wird indes auch, dass ein in einem Schiedsverfahren ergangenes Leistungsurteil nach § 181 InsO als Verurteilung zur Feststellung zur Tabelle umgedeutet werden könne.31 Dies setzt aber voraus, dass die Forderung zuvor bereits zur Tabelle angemeldet wurde, da eine Feststellung nur insoweit begehrt werden kann, wie die Forderung in der Anmeldung bezeichnet wurde. Eine Umdeutung kommt also nur in Betracht, wenn die Forderung bereits mindestens in Höhe des Leistungsurteils angemeldet wurde. Ist dies der Fall, so steht einer Umdeutung des Urteils nichts im Wege, da der Schiedsspruch (rechtskräftig) festgestellt hat, dass die Forderung des Gläubigers berechtigt ist und somit besteht. Soweit man einer Umdeutung des Schiedsspruches kritisch gegenübersteht, kommt der Schiedsspruch als Dokument zur nachträglichen Substantiierung der vorläufig bestrittenen Forderung in Betracht, mit der Folge, dass die Forderung nun festgestellt werden kann.32
Zusammenfassend gilt, dass auch wenn eine Schiedsklage des Gläubigers bereits anhängig ist, hat die Insolvenzordnung Auswirkungen auf das Schiedsverfahren. Insbesondere kann auch hier nicht von einer Flucht des Gläubigers unter den Schutz staatlicher Gewalt gesprochen werden, da die Auswirkungen der Insolvenzordnung auf das Schiedsverfahren dazu führen, dass der Gläubiger seine Schiedsklage auf Feststellung zur Tabelle umstellen muss und so eine Vollstreckung aus dem Schiedsspruch in das sonstige Vermögen des Schuldners ausscheidet.
E. Fazit
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich beide Sonderrechte, das Insolvenz- und das Schiedsrecht, bei Berührungspunkten gegenseitig ergänzen. So hat der Gläubiger, dem gegen den Schuldner eine Forderung aus einem Vertrag zusteht, in dem eine Schiedsklausel enthalten ist, so diese Forderung dennoch gemäß § 174 InsO zur Tabelle anzumelden. Dies stellt kein Flüchten unter den Schirm der staatlichen Gewalt dar, vielmehr gebietet dies der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung. Andernfalls würde der Gläubiger bevorzugt, der aus einem Schiedsspruch vollstrecken könnte. Denn wenn die Schiedsklausel die Teilnahme am Insolvenzverfahren ausschließen würde, so würde folgerichtig auch das Vollstreckungsverbot in das sonstige Vermögen gemäß § 89 InsO nicht gelten. Sollte es aber zum Streit über die angemeldete Forderung kommen, so ist sowohl der Insolvenzverwalter als auch der Gläubiger an die Schiedsklausel gebunden. Eine Klärung der Streitigkeit kann daher nur im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit erfolgen.
[...]
1 Dies muss sogar im Wege der Schiedsklage geschehen, soweit der Gläubiger nicht freiwillig leistet, da der Insolvenzverwalter, wie noch zu zeigen sein wird, insoweit an die Schiedsklausel, die zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbart wurde, gebunden ist.
2 Für deutsches Schiedsrecht: Prütting in: Prütting/Gehrlein ZPO Kommentar, § 1025 Rn. 1; Vgl. für internationales Schiedsrecht: Redfern/Hunter Redfern and Hunter on International Arbitration, Rn. 1.02, 1.39.
3 Für deutsches Schiedsrecht: Prütting in: Prütting/Gehrlein ZPO Kommentar, § 1025 Rn. 2; Vgl. für internationales Schiedsrecht: Redfern/Hunter, Rn. 1.38, 2.01, 2.13.
4 Vgl. Schwab/Walter Schiedsgerichtsbarkeit Rn. 7.
5 Vgl. Prütting in: Prütting/Gehrlein ZPO Kommentar, § 1026 Rn. 1-3; Ahrendt Der Zuständigkeitsstreit im Schiedsverfahren, S. 1.
6 Bork Einführung in das Insolvenzrecht, Rn. 355.
7 Becker, Insolvenzrecht, § 1 Rn. 15, 20, 23-24.
8 Vgl. Becker Insolvenzrecht, § 7 Rn. 308-316.
9 Becker Insolvenzrecht, § 9 Rn. 438-441.
10 Ahrendt Der Zuständigkeitsstreit im Schiedsverfahren, S. 1.
11 Gerhardt in: Gottwald, Insolvenzrechtshandbuch, § 36 Rn. 46; Breuer in: MüKo, § 87 Rn. 2; Wittkowski in: Nerlich/Römermann Insolvenzordnung, § 87 Rn. 2.
12 Leithaus in: Andres/Leithaus Insolvenzordnung, § 89 Rn. 2; Uhlenbruck Insolvenzordnung, § 89 Rn. 1.
13 Breuer in: MüKo, § 87 Rn. 3 u. 4; Wittkowski in: Nerlich/Römermann Insolvenzordnung, § 87 Rn. 3.
14 Vgl. Pape in: Uhlenbruck Insolvenzordnung, § 1 Rn. 2 u. 3; Häsemeyer Insolvenzrecht, Rn. 2.02.
15 Das Prinzip der Chancengleichheit gilt nicht vollkommen. Vielmehr liegt der Insolvenzordnung ein Gleichbehandlungsgrundsatz in Form der Vergleichsordnung zugrunde. Eine unterschiedliche Behandlung der einzelnen Gläubigergruppen ist in der Insolvenzordnung durchaus gewollt; s. Brockdorff in: Huntemann/Brockdorff, Der Gläubiger im Insolvenzverfahren, 13. Kap. Rn. 38.
16 Becker Insolvenzrecht, § 1 Rn. 24.
17 Vgl. Pape in: Uhlenbruck Insolvenzordnung, § 1 Rn. 4; Uhlenbruck Das neue Insolvenzrecht S. 17 u. 47; Häsemeyer Insolvenzrecht, Rn. 2.03.
18 BGH ZInsO 2004, 88; BGH Z 24, 15, 18; Berger ZInsO 2009, 1033 ff.
19 Huber in: Gottwald, Insolvenzrechtshandbuch, § 36 Rn. 46.
20 Vgl. Pape/Uhlenbruck/Voigt-Salus Insolvenzrecht, 27. Kap. Rn. 21; Ehricke in: MüKo, § 38 Rn. 7-9.
21 Klopp/Kluth in Gottwald Insolvenzrechtshandbuch, § 19 Rn. 1; Specovius in: Braun Insolvenzordnung, § 174 Rn. 35, Becker Insolvenzrecht, § 29 Rn. 1271.
22 Die Beschränkung auf den Insolvenzverwalter ist bewusst erfolgt, da insoweit noch unklar ist, ob auch Dritte, d.h. andere Gläubiger an die Schiedsklausel gebunden sind; vgl. hierzu: Berger ZInsO 2009, 1033 ff.
23 Klopp/Kluth in Gottwald Insolvenzrechtshandbuch, § 22 Rn. 54.
24 Gerhardt in: Gottwald, Insolvenzrecht, § 32 Rn. 11; OLG Köln, SchiedsVZ 2008, 152, 154; BGH NZI 2009, 309, 311.
25 Vgl. Schumacher in MüKo, Vorbem. vor §§ 85 bis 87, Rn. 53.
26 BGHZ 179, 304, 312.
27 Vgl. Wagner KTS 2010, 39, der auch für eine analoge Anwendung des § 240 ZPO plädiert. Dies aber noch Erwägungen des Auslandskonkurses stützt.
28 Vgl. Klopp/Kluth in Gottwald Insolvenzrechtshandbuch, § 22 Rn. 54; Becker Insolvenzrecht, § 29 Rn. 1278.
29 Vgl. zur Vertiefung: BGHZ 145, 116; BGH SchiedsVZ 2008, 148; Wagner KTS 2010, 39; Schumacher in: MüKo Vorbem. vor §§ 85 bis 87 Rn. 53 - 55; BGHZ 24, 15, 18; Stein/Jonas/Schlosser § 1025 RdNr. 40; Berger ZInsO 2009, 1033 ff.
30 BGHZ 179, 308 f.; vgl. auch Becker Insolvenzrecht, § 29 Rn. 1272.31 BGH NZI 2009, 309.
32 Vgl. Becker Insolvenzrecht, § 29 Rn. 1284; Specovius in: Braun Insolvenzordnung, § 178 Rn. 11.
- Arbeit zitieren
- Björn Ebert (Autor:in), 2012, Der Gläubiger mit Schiedsklausel im Insolvenzverfahren – Wechselwirkungen zwischen Insolvenz- und Schiedsrecht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/200965