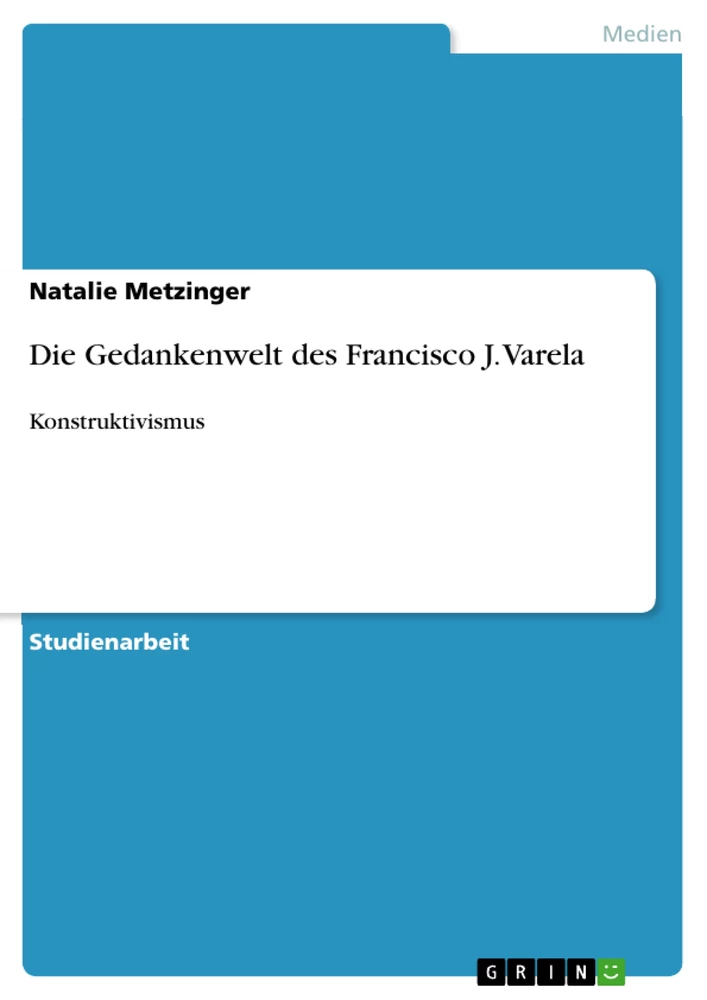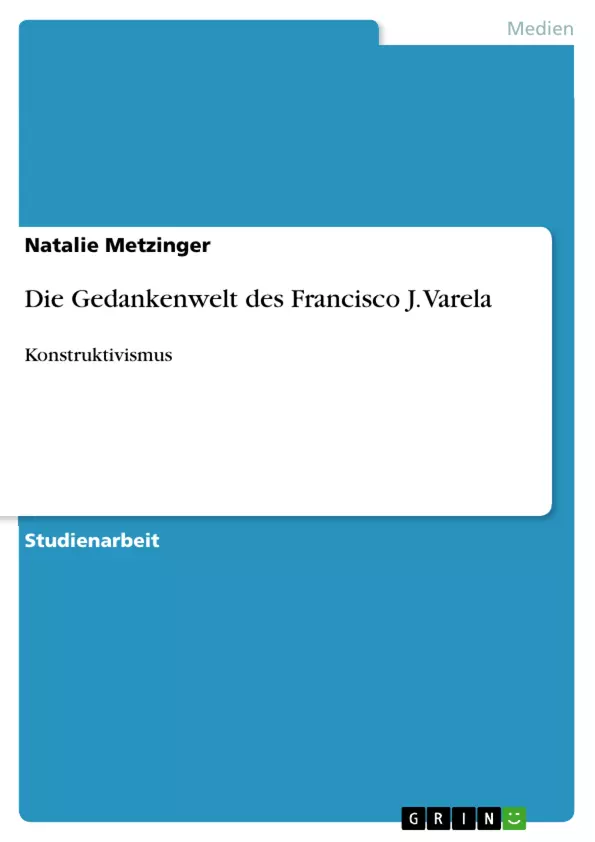1. Einleitung
„Wahr ist, was funktioniert“ (Pörksen & Varela, 2008, S. 112).
Dieser zunächst sehr banal und reduziert wirkende Satz des Chilenen Francisco J. Varela
wird den komplexen Theorien und der Gedankenwelt des Kognitionswissenschaftlers und
Neurobiologen wohl kaum gerecht. Doch vielleicht ist es gerade die Intention von
Bernhard Pörksen, der Varela ein Kapitel des Buches „Gewissheit der Ungewissheit –
Gespräche zum Konstruktivismus“ widmete und den Wissenschaftler persönlich zu seinen
Ansichten interviewte, diesen Satz als Aufhänger des Kapitels zu wählen, um die
entstehende Paradoxie zu unterstreichen. Eine Paradoxie von scheinbar herkömmlichen
und logischen Aussagen, hinter denen bei genauerer Betrachtung eine ganze Menge mehr
steckt und die den Leser zum Nachdenken anregen.
Denn Francisco J. Varela widerspricht einigen, bisher als erwiesen gegoltenen Theorien,
lehnt einige Theorien völlig ab, bedient sich dann doch an einzelnen Ansätzen, um sie dann
wieder miteinander zu vereinen. Da gibt es z.B. auf einmal keine Trennung mehr zwischen
Subjekt und Objekt, Wahrheit ist schlicht und einfach, wenn man einen Weg gefunden
hat, zu überleben, Kognitionswissenschaftler sollen die buddhistische Mediation in ihre
Erkenntnisse einfließen lassen und ein Realist ist naiv, da er die innere Welt bei der
Betrachtung der äußeren völlig ausblendet. Varela begründet seinen ständigen Drang nach
ungewöhnlichen Verbindungen und die Ablehnung der traditionellen wissenschaftlichen
Praxis mit seinem Gefühl der fehlenden Zugehörigkeit und Fremdheit – insbesondere
während der Ausbildung in einem fremden Land, die eine „Plattform für neue
Entdeckungen und für Wahrnehmungen [bietet], die zuerst fremdartig erscheinen mögen“
(Pörksen & Varela, 2008, S. 124). Ein weiterer Grund für die starke Interdisziplinarität
seiner Ansätze stellt jedoch sicherlich sein Interesse dar, als studierter Biologe über die
Fachgrenzen hinaus in den Bereichen der Philosophie und Kognitionswissenschaft zu
forschen.
Die zunächst bruchstückhaft erscheinenden Teile der Erkenntnis setzen sich im Laufe der
Zeit allerdings zu einem Ganzen zusammen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist, im ersten Teil
die zentralen Gedanken des Wissenschaftlers darzulegen sowie die Verbindung dieser
2
aufzuzeigen, ehe im zweiten Teil ein Transfer in den Bildungskontext erfolgt. Welche
Implikationen ergeben sich für die Lehr-/Lernumgebung in der Schule?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ein Einblick in die Gedankenwelt des Francisco J. Varela
- 2.1 Das Computermodell des Geistes – Erklärungsversuche für die menschliche Kognition
- 2.2 Das „Hervorbringen einer Welt“ – das Verschmelzen von Subjekt und Objekt
- 2.3 Das Verständnis von Wahrheit und Realität
- 2.4 Die Theorie der Emergenz: buddhistische Einflüsse
- 2.4.1 Der Gedanke der Ichlosigkeit im Buddhismus
- 2.4.2 Ethik in der Theorie der Emergenz
- 3. Bezug auf den Bildungskontext
- 3.1 Implikationen für die Gestaltung von Lehr-/Lernumgebungen
- 3.2 Lernen mit neuen Medien
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zentralen Gedanken des Kognitionswissenschaftlers Francisco J. Varela und deren Implikationen für den Bildungskontext. Sie beleuchtet Varelas Kritik am Computermodell des Geistes und seine alternative Perspektive, die Subjekt und Objekt verschmelzen lässt. Die Arbeit analysiert Varelas Verständnis von Wahrheit und Realität sowie den Einfluss buddhistischer Philosophie auf seine Theorie der Emergenz.
- Varelas Kritik am Computermodell des Geistes
- Das Konzept der Emergenz und Selbstorganisation
- Die Verschmelzung von Subjekt und Objekt in Varelas Philosophie
- Varelas Verständnis von Wahrheit und Realität
- Implikationen für Lehr-/Lernumgebungen und den Einsatz neuer Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den zentralen Satz „Wahr ist, was funktioniert“ von Francisco J. Varela als Ausgangspunkt, um die Komplexität seiner Gedankenwelt und die Paradoxie seiner scheinbar einfachen Aussagen zu beleuchten. Sie skizziert Varelas interdisziplinären Ansatz, der Biologie, Philosophie und Kognitionswissenschaft verbindet, und kündigt das Ziel der Arbeit an: die Darstellung von Varelas zentralen Gedanken und deren Übertragung in den Bildungskontext.
2. Ein Einblick in die Gedankenwelt des Francisco J. Varela: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Varelas philosophische und wissenschaftliche Positionen. Es beginnt mit einer Diskussion des Computermodells des Geistes und Varelas Kritik daran, die auf dessen Unfähigkeit hinweist, die Komplexität des menschlichen Geistes adäquat zu erfassen. Varela betont die Bedeutung innerer Faktoren und die Ablehnung einer rein objektiven Betrachtungsweise. Das Kapitel führt weiter Varelas Konzepte der Emergenz und Selbstorganisation ein und beleuchtet den Einfluss buddhistischer Gedanken auf seine Theorie, insbesondere den Gedanken der Ichlosigkeit und die ethischen Implikationen seiner Arbeit.
Schlüsselwörter
Francisco J. Varela, Kognitionswissenschaft, Computermodell des Geistes, Emergenz, Selbstorganisation, Buddhismus, Ichlosigkeit, Wahrheit, Realität, Bildungskontext, Lehr-/Lernumgebungen, neue Medien.
Häufig gestellte Fragen zu: Einblick in die Gedankenwelt von Francisco J. Varela und deren Implikationen für den Bildungskontext
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die zentralen Gedanken des Kognitionswissenschaftlers Francisco J. Varela und deren Relevanz für den Bildungskontext. Sie analysiert Varelas Kritik am Computermodell des Geistes, seine alternative Perspektive der Verschmelzung von Subjekt und Objekt, sein Verständnis von Wahrheit und Realität sowie den Einfluss buddhistischer Philosophie auf seine Theorie der Emergenz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Varelas Kritik am Computermodell des Geistes, das Konzept der Emergenz und Selbstorganisation, die Verschmelzung von Subjekt und Objekt in Varelas Philosophie, sein Verständnis von Wahrheit und Realität und schließlich die Implikationen für Lehr-/Lernumgebungen und den Einsatz neuer Medien im Bildungskontext.
Wie wird Varelas Kritik am Computermodell des Geistes dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet Varelas Kritik am Computermodell des Geistes, indem sie dessen Unfähigkeit aufzeigt, die Komplexität des menschlichen Geistes adäquat zu erfassen. Varela betont die Bedeutung innerer Faktoren und die Ablehnung einer rein objektiven Betrachtungsweise.
Welche Rolle spielt der Buddhismus in Varelas Theorie?
Die Arbeit analysiert den Einfluss buddhistischer Gedanken auf Varelas Theorie der Emergenz, insbesondere den Gedanken der Ichlosigkeit und die ethischen Implikationen seiner Arbeit.
Welche Implikationen hat Varelas Philosophie für den Bildungskontext?
Die Arbeit untersucht die Implikationen von Varelas Philosophie für die Gestaltung von Lehr-/Lernumgebungen und den Einsatz neuer Medien. Sie zeigt auf, wie Varelas Ideen in die Praxis des Lernens und Lehrens übertragen werden können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über Varelas Gedankenwelt (inkl. Computermodell des Geistes, Emergenz, Buddhismus, Wahrheit und Realität), ein Kapitel über den Bezug zum Bildungskontext (inkl. Implikationen für Lehr-/Lernumgebungen und neue Medien) und ein Fazit/Ausblick. Die Einleitung präsentiert den zentralen Satz "Wahr ist, was funktioniert" von Varela und skizziert seinen interdisziplinären Ansatz. Das Kapitel über Varelas Gedankenwelt bietet einen umfassenden Überblick über seine philosophischen und wissenschaftlichen Positionen. Das Kapitel zum Bildungskontext beleuchtet die Implikationen für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Francisco J. Varela, Kognitionswissenschaft, Computermodell des Geistes, Emergenz, Selbstorganisation, Buddhismus, Ichlosigkeit, Wahrheit, Realität, Bildungskontext, Lehr-/Lernumgebungen, neue Medien.
- Quote paper
- Natalie Metzinger (Author), 2011, Die Gedankenwelt des Francisco J. Varela, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/200954