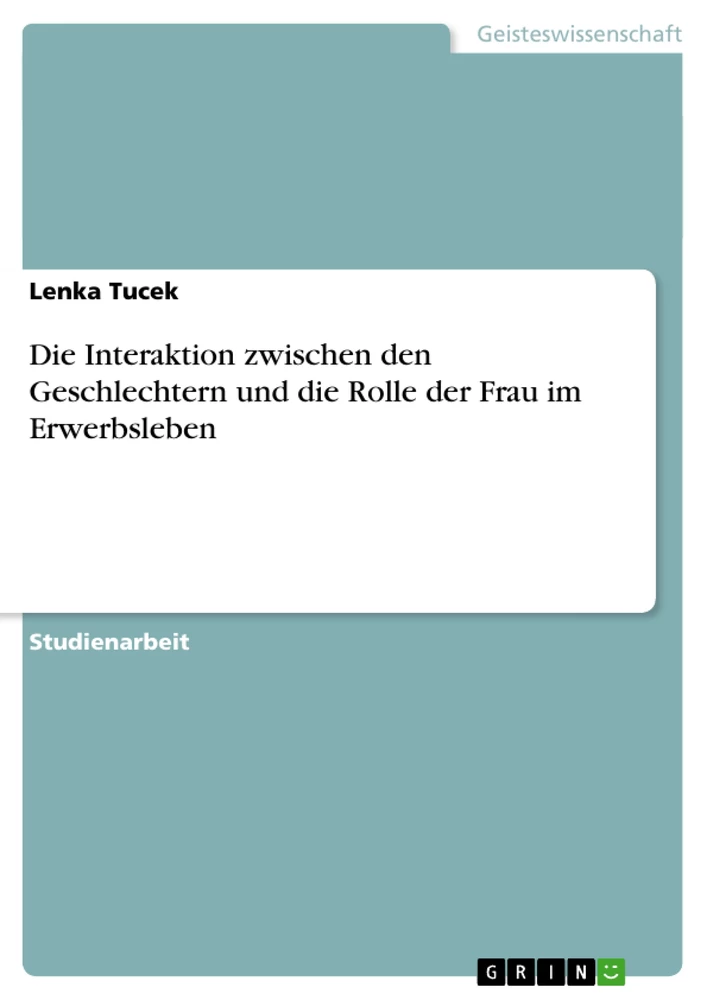Vorurteile, insbesondere Geschlechtervorurteile offen zu äußern, ist in der fortgeschrittenen modernen Gesellschaft moralisch, wie politisch fragwürdig geworden. Im Grundgesetz steht, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Gleichwohl zeigen aber sozialpsychologische, historische und sozialwissenschaftliche Forschungen die Omnipräsenz von Vorurteils – und Stereotypenbildungen in der Alltagswirklichkeit auf. Diese sind nicht leicht aufzudecken, und die machttheoretische Ebene bleibt meist unbeleuchtet. Gewohnte und tradierte Selbst – und Fremdbilder unterschiedlicher gesellschaftlicher Machtgruppen stellen sich gegenüber dem sozialen Wandel als äußerst zäh dar, da von ihren Trägern und Trägerinnen befürchtet wird, dass ihre Machtposition durch die erforderliche Anpassung ihres Selbstbildes an die gewünschte Veränderung gefährdet ist. Am Deutlichsten treten Geschlechtervorurteile und Stereotypisierungen in der Interaktion zwischen den Geschlechtern hervor. Ob bewusst oder unbewusst - Geschlechtsstereotypisierungen und die dadurch entstehenden Benachteiligungen sind Teil der Interaktion und beeinflussen das Handeln in bestimmten Situationen. Besonders im Erwerbsleben sind deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern und die Benachteiligung von Frauen bemerkbar. In dieser Arbeit soll untersucht werden, welchen Mechanismen die Interaktion zwischen den Geschlechtern unterliegt und welche Auswirkungen die geschlechtsspezifische Interaktion auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Berufsleben hat.
(Hierbei beziehe ich mich vorwiegend auf den folgenden Text: Ridgeway, Cecilia L. (1997): Interaction and the Conservation of Gender Inequality: Considering Employment. In: American Sociological Review 1997, Jg. 62, Heft April; S. 218 - 235. Stanford University.)
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Individuum und Gesellschaft
- III. Interaktion und Geschlecht
- 1. Geschlecht als prägender Faktor in der Interaktion
- a) Geschlecht als Kategorie
- b) Stereotypenbildung und Bewertung
- c) Statusglaube und Erwartungen
- 2. Geschlecht und Arbeit
- a) Statusglaube und Erwartungshaltungen im Arbeitskontext
- b) Vergleiche mit Anderen
- c) Trennung von Arbeitssphären
- d) Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung
- 1. Geschlecht als prägender Faktor in der Interaktion
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mechanismen der Interaktion zwischen den Geschlechtern und deren Auswirkungen auf das Verhältnis von Männern und Frauen im Berufsleben. Sie beleuchtet, wie geschlechtsspezifische Interaktionen und Stereotypen die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben beeinflussen.
- Die Rolle von Geschlechterstereotypen in der sozialen Interaktion
- Der Einfluss von Statusglauben und Erwartungen auf die Interaktion zwischen den Geschlechtern
- Die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Interaktion auf das Erwerbsleben
- Die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht und ihre Manifestation im Alltag
- Der Zusammenhang zwischen Individuum, Gesellschaft und Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt die Forschungsfrage nach den Mechanismen der Interaktion zwischen den Geschlechtern und deren Auswirkungen auf das Berufsleben von Frauen. Sie betont die moralische und politische Fragwürdigkeit offen geäußerter Geschlechtervorurteile trotz deren Omnipräsenz in der Gesellschaft. Die Autorin kündigt an, die geschlechtsspezifische Interaktion und deren Einfluss auf die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben zu untersuchen, wobei sie sich auf die Arbeit von Ridgeway (1997) bezieht.
II. Individuum und Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von individuellen und gesellschaftlichen Wahrnehmungen auf das Handeln. Es wird der Begriff der Alltagswelt nach Berger und Luckmann eingeführt, die diese als oberste Wirklichkeit beschreiben, die durch intersubjektive Verständigung und Typisierungen geprägt ist. Das Kapitel betont die Relevanz von Typisierungen für das Verständnis und die Gestaltung sozialer Interaktionen und deren Einfluss auf das Verhalten in verschiedenen Situationen. Es unterstreicht den dynamischen Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft, wobei Interaktionen als reproduktive Prozesse gesellschaftlicher Strukturen dargestellt werden.
III. Interaktion und Geschlecht: Dieses Kapitel analysiert die Interaktion zwischen den Geschlechtern, wobei Geschlecht als prägender Faktor in der Interaktion betrachtet wird. Es befasst sich mit der Kategorie Geschlecht, der Stereotypenbildung, Statusglauben und Erwartungen. Der zweite Teil konzentriert sich auf Geschlecht und Arbeit, untersucht Statusglauben und Erwartungshaltungen im Arbeitskontext, vergleicht die Situation von Frauen und Männern im Erwerbsleben und analysiert die Trennung von Arbeitssphären sowie Selbst- und Fremdzuschreibungen. Der Fokus liegt auf der Erläuterung, wie geschlechtsspezifische Interaktionen zu Benachteiligungen von Frauen führen.
Schlüsselwörter
Geschlechterinteraktion, Geschlechtervorurteile, Stereotypen, Statusglaube, Erwartungshaltungen, Erwerbsleben, Frauenbenachteiligung, Gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht, Alltagswelt, Interaktion, Typisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Mechanismen der Interaktion zwischen den Geschlechtern und deren Auswirkungen auf das Verhältnis von Männern und Frauen im Berufsleben. Der Fokus liegt auf dem Einfluss geschlechtsspezifischer Interaktionen und Stereotypen auf die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsleben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle von Geschlechterstereotypen in der sozialen Interaktion, den Einfluss von Statusglauben und Erwartungen auf die Interaktion zwischen den Geschlechtern, die Auswirkungen geschlechtsspezifischer Interaktion auf das Erwerbsleben, die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht und ihre Manifestation im Alltag sowie den Zusammenhang zwischen Individuum, Gesellschaft und Interaktion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Individuum und Gesellschaft, Interaktion und Geschlecht (unterteilt in Geschlecht als prägender Faktor in der Interaktion und Geschlecht und Arbeit) und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung führt in das Thema ein, benennt die Forschungsfrage und betont die moralische und politische Fragwürdigkeit von Geschlechtervorurteilen. Sie kündigt die Untersuchung der geschlechtsspezifischen Interaktion und deren Einfluss auf die Benachteiligung von Frauen an, wobei auf die Arbeit von Ridgeway (1997) Bezug genommen wird.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Individuum und Gesellschaft"?
Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss individueller und gesellschaftlicher Wahrnehmungen auf das Handeln. Es wird der Begriff der Alltagswelt nach Berger und Luckmann eingeführt und die Relevanz von Typisierungen für das Verständnis und die Gestaltung sozialer Interaktionen betont. Der dynamische Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft und Interaktionen als reproduktive Prozesse gesellschaftlicher Strukturen werden hervorgehoben.
Worum geht es im Kapitel "Interaktion und Geschlecht"?
Dieses Kapitel analysiert die Interaktion zwischen den Geschlechtern, wobei Geschlecht als prägender Faktor betrachtet wird. Es befasst sich mit der Kategorie Geschlecht, Stereotypenbildung, Statusglauben und Erwartungen. Der zweite Teil konzentriert sich auf Geschlecht und Arbeit, untersucht Statusglauben und Erwartungshaltungen im Arbeitskontext, vergleicht die Situation von Frauen und Männern und analysiert die Trennung von Arbeitssphären sowie Selbst- und Fremdzuschreibungen. Der Fokus liegt auf der Erläuterung, wie geschlechtsspezifische Interaktionen zu Benachteiligungen von Frauen führen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Geschlechterinteraktion, Geschlechtervorurteile, Stereotypen, Statusglaube, Erwartungshaltungen, Erwerbsleben, Frauenbenachteiligung, Gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht, Alltagswelt, Interaktion und Typisierung.
- Arbeit zitieren
- Lenka Tucek (Autor:in), 2003, Die Interaktion zwischen den Geschlechtern und die Rolle der Frau im Erwerbsleben, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20054