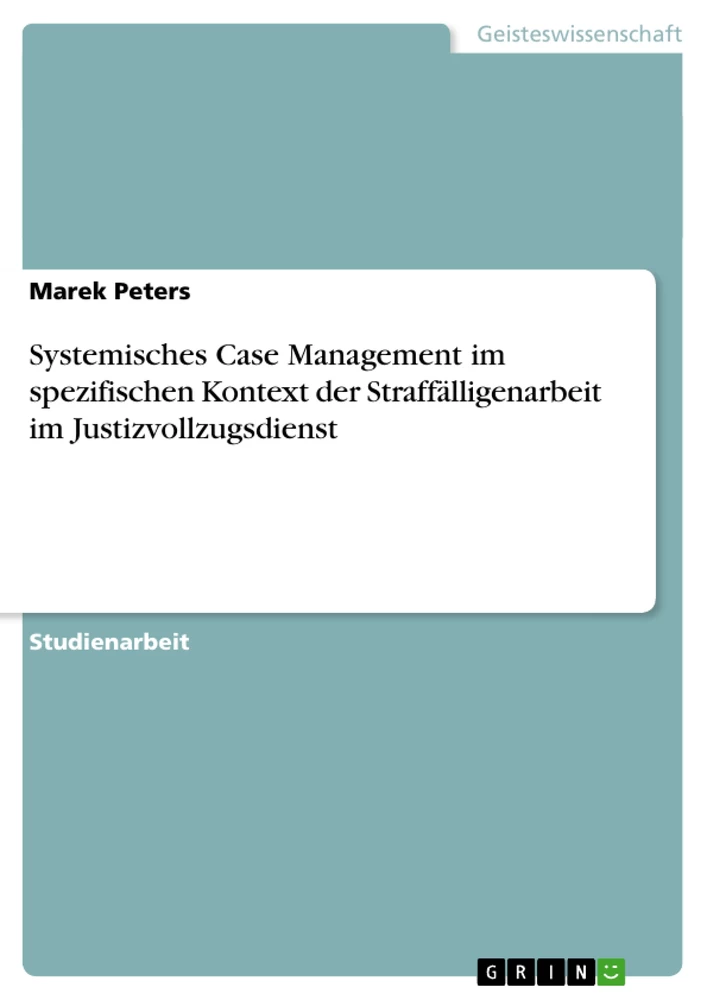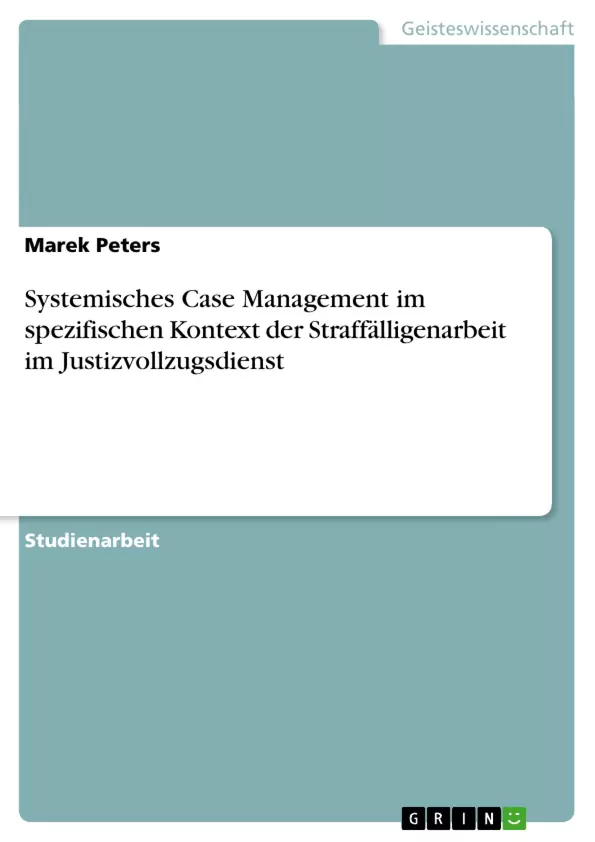Die moderne Gesellschaftsform und das gewandelte Verständnis von Hilfe, Ethik und Bedarfsdeckung innerhalb der Profession der Sozialen Arbeit haben neue Methoden hervorgebracht. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit von individuellen, kostentragenden und klientenzentrierten Maßnahmen kam es somit zu angemessenen Innovationsschritten bei der Gestaltungs- und Vorgehensweise unterstützender Maßnahmen. Neuerliche Maßstäbe wie Dynamik und Flexibilität wurden zu Messgrößen im Spektrum des tendenziell ökonomisierten (sozialen) Versorgungs- und Wettbewerbsmarkt. Diese Arbeit soll das in den 1970er Jahre entwickelte Modell des Case Management darstellen und die damit verbundenen einzelfallbezogenen Schritte sozialarbeiterischen Handelns, Steuerung und Hilfe beleuchten. Hierzu wird zunächst ein historischer Exkurs zur Darstellung der Entwicklung von den Ursprüngen sozialarbeiterischer Methoden hin zur Moderne vorgenommen, um anschließend in sequenzieller Abarbeitung unter Anwendung eines Fallbeispiels aus der Praxis die Komplexität der Einzelfallarbeit anhand des Systemischen Case Management darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historische Rahmung des Systemischen Case Managements
3. Kontextualisierung
4. Problembeschreibung und Ressourcenanalyse
5. Hypothesenbildung bezüglich der Problembedingungen
6. Ziel- und Handlungsplanung
7. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die moderne Gesellschaftsform und das gewandelte Verständnis von Hilfe, Ethik und Bedarfsdeckung innerhalb der Profession der Sozialen Arbeit haben neue Methoden hervorgebracht. Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit von individuellen, kostentragenden und klientenzentrierten Maßnahmen kam es somit zu angemessenen Innovationsschritten bei der Gestaltungs- und Vorgehensweise unterstützender Maßnahmen. Neuerliche Maßstäbe wie Dynamik und Flexibilität wurden zu Messgrößen im Spektrum des tendenziell ökonomisierten (sozialen) Versorgungs- und Wettbewerbsmarkt.
Diese Arbeit soll das in den 1970er Jahre entwickelte Modell des Case Management darstellen und die damit verbundenen einzelfallbezogenen Schritte sozialarbeiterischen Handelns, Steuerung und Hilfe beleuchten. Hierzu wird zunächst ein historischer Exkurs zur Darstellung der Entwicklung von den Ursprüngen sozialarbeiterischer Methoden hin zur Moderne vorgenommen, um anschließend in sequenzieller Abarbeitung unter Anwendung eines Fallbeispiels aus der Praxis die Komplexität der Einzelfallarbeit anhand des Systemischen Case Management darzustellen.
2. Historische Rahmung des Systemischen Case Managements
Soziale Arbeit unterliegt, wie alle lebensweltlichen Vorgänge, dem steten Wandel der Zeit, woraus sich ein Abgleich von Bedarfen und Leistungsspektren im (sozio-) ökonomischen Kontext ergibt. Demzufolge muss sich Soziale Arbeit neuerlich durch Effizienz und Effek- tivität messen lassen, um im modernen Wohlfahrtsstaat zielgerichtete und klientenorien- tierte Individualversorgung gewährleisten zu können und auf dem Versorgungsmarkt Be- stand zu haben (vgl. Kleve 2006a, S. 7). Ausgehend von Mary Richmonds basaler, sozial- arbeiterischen Methode des „Case Work“ und Alice Salomons Publikation „Soziale Diag- nose“, welche beide dem klassischen Dreischnitt (Anamnese, Diagnose, Behandlung) folg- ten, kam es seit den 1950er Jahren zur Weiterentwicklung der Grundtheorien und Metho- den, wie die Soziale Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit und Soziale Gemeinwesen- arbeit bildeten sich heraus. Des Weiteren führten die Methodenkritik (etwa 1968-1975) und die Ausdifferenzierung (ca. 1980er und 1990er Jahre) zur Ausprägung methodisch neuer Wege sozialarbeiterischen Handelns, welche angelehnt sind an den modernen psy- chotherapeutischen Methoden. So entwickelte sich u.a. die lebensweltorientierte Sozialar- beit, systemische Beratung, Case Management (fortlaufend abgekürzt: „C.M.“) (vgl. Kleve 2006b, S. 21-24). Das C.M. spielt hierbei im Rahmen der Ökonomisierung der Sozialarbeit eine prägende Rolle, da Kleve zu Folge eine Verbindung von lebensweltorientierter Betrachtung und betriebswirtschaftlicher Konzepte stattfindet. Er sagt hierzu, dass C.M.
„diese beiden widersprüchlichen, aber m.E. gleichermaßen wichtigen Perspektiven zu ver einen erlaubt“ (Kleve 2006c, S. 44). Somit wird C.M. ein interdisziplinärer Lösungsansatz bei der Beseitigung der oftmals vielfältigen Versorgungs- und Steuerprobleme, aufgrund eines ineffizienten Sozial- und Gesundheitssystems (vgl. Ewers zit. nach Erath 2006, S. 156f). Kernaufgabe sind dabei die Ermittlung, Konstruktion und Überwachung der informellen sozialräumlichen Ressourcen und formellen Angebote des Dienstleistungssektors (vgl. Galuske 1998, S. 184f). Die anwaltschaftliche Funktion (advocacy), vermittelnde Funktion (broker) und selektierende Funktion (gate keeper) sind grundstrukturelle Faktoren des „klassischen C.M.“ und wurden in verschiedenen Modellen hinsichtlich der Gliederung und Bezeichnung abgewandelt. Dennoch stellt die 5-teilige Kernmethode, z.B. von Galuske (vgl. 1998, S. 186f), Wendt (vgl. 1991, S. 25f) u.a. die Ausgangsbasis für weitere Differenzierungen dar (vgl. Müller 2006, S. 64).
Fortlaufend wird das 6-stufige Modell vom „Systemischen Case Management“ nach Haye/Kleve (2006) exemplarisch als differenzierte Form des C.M. sukzessiv in Theorie und fallpraktischer Anwendung dargestellt. Hierzu wird zunächst im folgenden Abschnitt auf die Phase der Kontextualisierung eingegangen, bei der eine globale Betrachtung der situativen, lebensweltlichen und Hilfsbedürftigkeit verursachenden Umstände der Initialphase zwischen HelferInnen und KlientInnen prioritär ist.
3. Kontextualisierung
Kontexte sind notwendige Bezugsrahmen, um der systemischen Theorie Luhmanns fol- gend den (non-)verbalen Informationen einen kongruenten Sinn im soziokommunikativen Verhalten zu geben (vgl. Simon/Stierlin zit. nach Kleve 2006d, S. 93). Laut Keve soll im Rahmen der systemischen Kontextklärung u.a. die Erwartungen der Kli- entInnen mit der sozialen Realität abgeglichen werden (vgl. ebd. S. 95), die Bedeutung anderer HelferInnen erkundet werden, etwaige Vorerfahrungen reflektiert und der Hilfe- zeitrahmen incl. einer Zielvorstellung definiert werden (vgl. ebd., S. 95-101). Die Kontextualisierung im Rahmen des „Sechs-Phasenmodell für die Falleinschätzung und Hilfeplanung“ nach Haye/Kleve bezieht sich dabei auf den lebensweltlich-familiären Kon- text und den Kontext der Hilfesysteme.
Im lebensweltlich-familiären Kontext werden zunächst das Wohnumfeld und der soziale Nahraum der KlientInnen einer Analyse unterzogen, um so Probleme und Ressourcen zu erkennen. Ein bewährtes Hilfsmittel sind hierbei Genogramme, um aus sozialer, sachlicher und zeitlicher Perspektive des Klienten eine Visualisierung der Aktionsräume, Ressourcen und Hilfepotentiale zu erstellen. Die kontextuelle Betrachtung der Hilfesysteme ist nach Haye/Kleve ebenfalls wichtig, da KlientInnen möglicherweise bereits eine Hilfemaßnahme in Anspruch nahmen bzw. noch nehmen und somit eventuelle Anknüpfpunkte bzw. Probleme bestehen. Auch hier bieten sich Illustrationen an, um die Komplexität der Einbindung in Hilfenetzwerke aufzuzeigen (vgl. Haye/Kleve 2006, S. 106f). Standardisierte Netzwerkkartenerstellung sind u.a. ego-zentrierte, sternförmige Soziogramme oder 6-Feld-Karten (vgl. Müller 2006, S. 70ff).
Fallbeispiel zur Kontextualisierung:
Der 25jährige, arbeitslose Herr G. verb üß t derzeit eine Gesamtfreiheitsstrafe wg. Raub, Körperverletzung und Trunkenheit im Stra ß enverkehr von 1 Jahr und 10 Monaten. Er steht in Kontakt zur Schuldnerberatungs- stelle der AWO (Schuldenregulierung), zur Suchtberatungsstelle der Caritas (Bewältigung der Alkoholprob- lematik und zu den Sozialen Diensten der Justiz (Koordinierung der Bewährungsauflagen aus Vorverurtei- lung). Er lebt mit seiner Lebenspartnerin, deren zwei in die Beziehung eingebrachten und drei gemeinsamen Kindern in einer Mietwohnung. Seine Lebenspartnerin steht in Kontakt mit dem Jugendamt und hat einen Betreuer nach § 1896f BGB aufgrund ihrer geistigen Reifedefizite, au ß erdem ist eine Sozialpädagogische Familienhelferin (SPFH) nach § 31 SGB VIII aktiv tätig. Herr G. ‘ s Mutter hält engen Kontakt zu ihm durch Besuche und unterstützt ihn materiell und emotional. Eher negativ wirkt der Kontakt des Ex-Mannes seiner Lebenspartnerin auf die Beziehung ein, sowie delinquenzfördernde Einflüsse seiner hafterfahrenen Freunde im sozialen Nahraum.
In der nun folgenden Phase kommt es zur Herausarbeitung der spezifischen, defizitären Situationsmerkmale der KlientInnen. Hierbei wird die Betrachtung auf die Probleme fokussiert und eine lösungsorientierte Ressourcenbetrachtung vorgenommen.
4. Problembeschreibung und Ressourcenanalyse
Bei systemischer Betrachtungsweise sind Probleme sozial konstruierte Phänomene, die aufgrund einer intersubjektiven Norm-Abweichungs-Differenz-Zuschreibung vorgenom- men werden. Die Soziale Arbeit operiert bei der Problembetrachtung aufgrund ihres spezi- alisierten Generalismus auf bio-psycho-sozialer Ebene und ist zeitgleich gefangen in der Hilfesystem-Umwelt-Differenz. Demnach müssen erst defizitäre Schieflagen definiert werden, welche von Rechts- oder Leistungsträgern ratifiziert sein müssen, um rechtlich zugesicherte Hilfen abrufen zu können und eine Sinn-Kontext-Adäquanz zu begründen. Haye/Kleve sagen, dass es unabkömmlich ist „die sozialsystemischen Bedingungen der Probleme und die Ressourcen“ einzublenden, da die systemisch-lösungsorientierte Sicht den Aspekt der Ressourcen bei der Problembeschreibung einzubeziehen.
[...]
- Arbeit zitieren
- B.A. Marek Peters (Autor:in), 2010, Systemisches Case Management im spezifischen Kontext der Straffälligenarbeit im Justizvollzugsdienst, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/200132