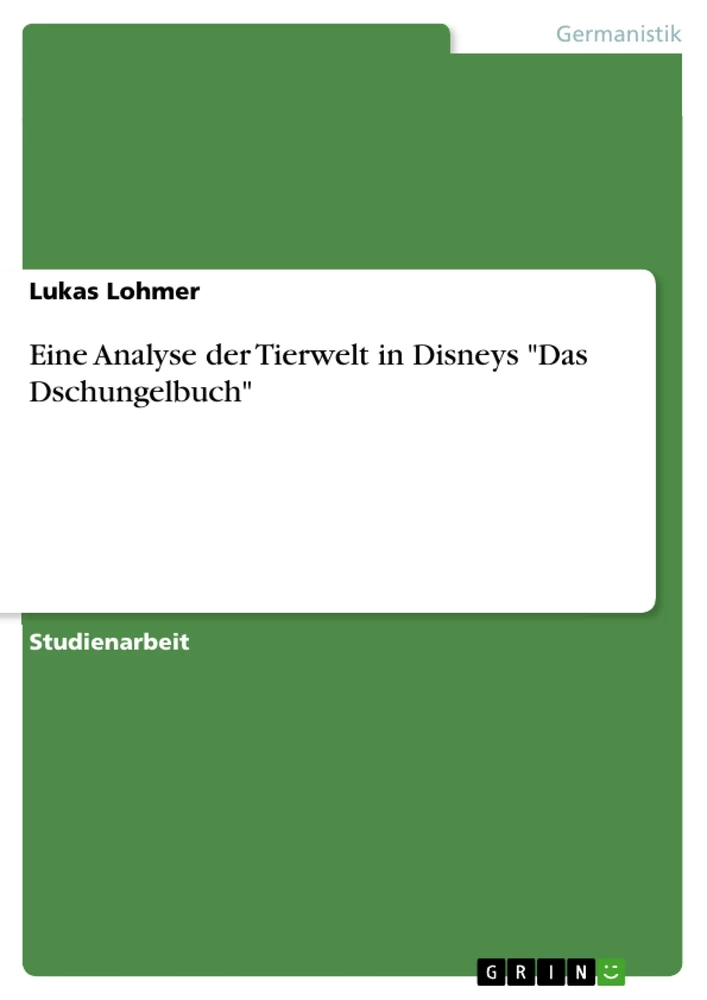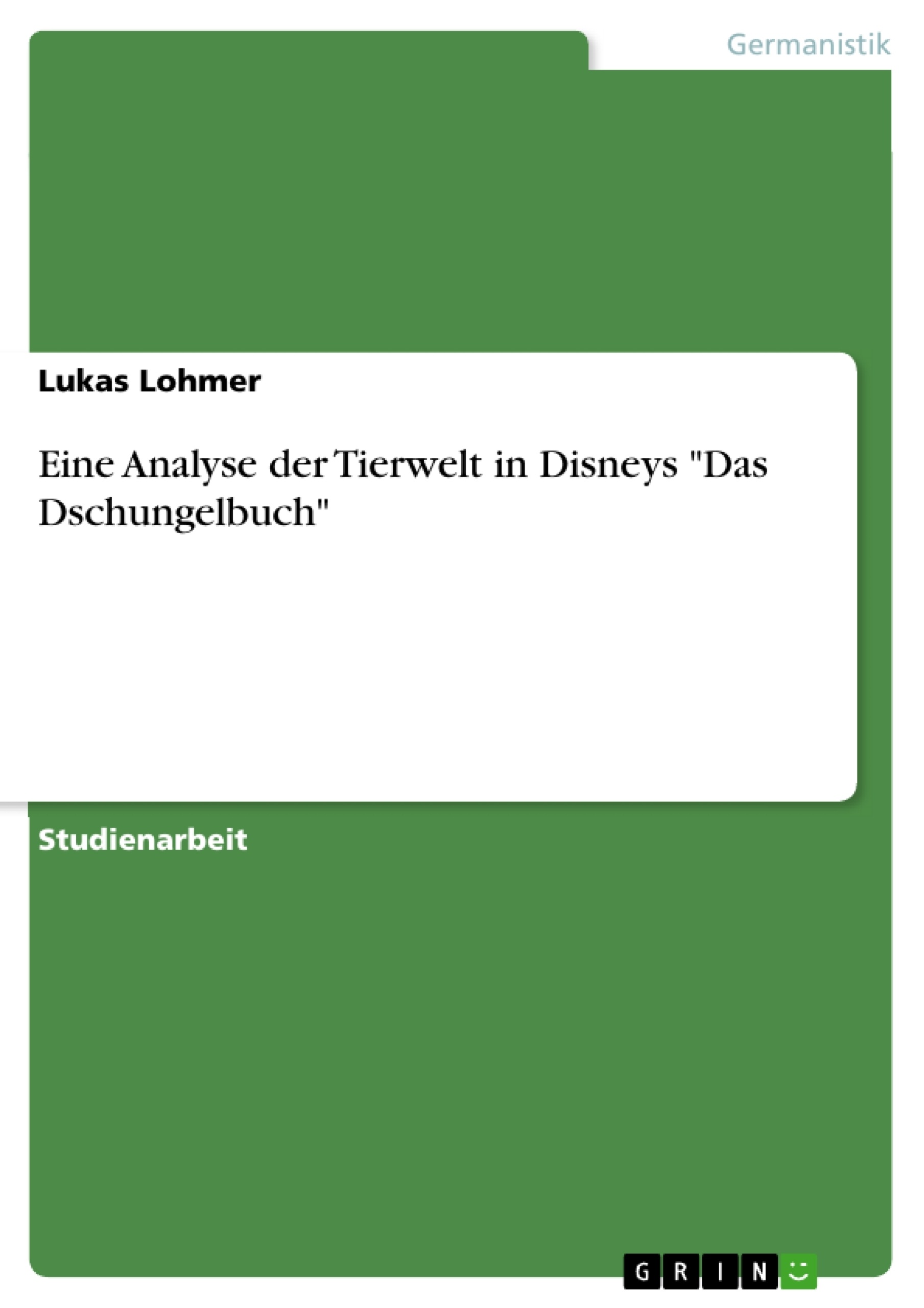„Das Dschungelbuch“ ist in mehrerer Hinsicht ein Klassiker. Einerseits gelang Rudyard Kipling mit seinem gleichnamigen Erzählband ein viel beachteter, positiv rezipierter Erfolg, andererseits gehört auch die gleichnamige Zeichentrickverfilmung aus dem Hause Walt Disney zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt. Aber nicht nur aus kommerziellen Gründen ist „Das Dschungelbuch“ interessant. Durch die anthropomorphe Gestaltungsweisen der Tiere, ihren scheinbar fabelartigen Charakter und das dargestellte Verhältnis zwischen Mensch und Tier, bieten sowohl das Buch als auch der Film, eine hervorragende Grundlage, um sich mit den verschiedenen, darin enthaltenen Motiven, Symbolen und Figuren zu beschäftigen.
In der vorliegenden Seminararbeit soll es dabei aber weniger um Kiplings „Das Dschungelbuch“ gehen. Abgesehen von einer historischen Einordnung und einer kurzen Zusammenfassung, sowie Differenzierung zur Disney-Verfilmung, soll der Fokus auf eben dieser, 1967 erschienenen, Zeichentrickversion liegen. Während über die Buchvorlage es schon zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten gibt, ist das Genre des Zeichentrickfilms jahrelang aufgrund seiner angeblichen Zugehörigkeit zur Trivialkunst, von wissenschaftlicher Seite kaum beachtet worden. Um zu zeigen, dass auch Untersuchungen der in Zeichentrickfilmen dargestellten Themen, sehr ergiebig und aufschlussreich sein können, habe ich mich dazu entschlossen, das Hauptaugenmerk auf die Version von Disney zu legen.
Dabei werde ich, nachdem ich einführend auf Kiplings „Das Dschungelbuch“, sowie eine genredefinierenden Überblick über „Tier-Bilder in der Literatur“ gegeben habe, erst die Handlung des Films skizzieren, um danach, einerseits grundlegend, andererseits im Bezug auf den Film, auf das Stilmittel der Anthropomorphisierung einzugehen. Im Fokus dieser Arbeit steht dann das explizit dargestellte, sowie implizierte Verhältnis zwischen Tier und Mensch in Disneys „Das Dschungelbuch“, das ich zu analysieren versuche werde. Abschließend werde ich ausgewählten tierischen Figuren einer Figurenanalyse unterziehen. Sowohl im Vergleich zu gängigen Tier-Bildern, als auch im Hinblick der Figuren auf ihre Funktion als „fiktives Wesen“ und „Symbol“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Tier-Bilder in der Literatur - eine Genreeinordnung
- Rudyard Kiplings „Das Dschungelbuch“
- Walt Disneys „Das Dschungelbuch“
- Handlung
- Unterschiede zur Buchvorlage
- Anthropomorphisierung im Hinblick auf „Das Dschungelbuch“
- Das Verhältnis von Tier zu Mensch
- Figurenanalyse der Tier-Typen
- Baghira - die Stimme der Vernunft
- Balu - der optimistische Faulpelz
- King Louie - der nach mehr strebende König
- Schir Khan - der verängstigte Bösewicht
- Kaa - die triebgesteuerte Heuchlerin
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Walt Disneys Verfilmung von „Das Dschungelbuch“ von 1967. Im Fokus steht die Darstellung des Verhältnisses zwischen Mensch und Tier sowie die Anthropomorphisierung der tierischen Figuren. Die Arbeit ordnet den Film auch genre-theoretisch ein und vergleicht ihn kurz mit Kiplings literarischer Vorlage.
- Genre-Einordnung von Tiergeschichten in der Literatur
- Vergleich zwischen der Buch- und Filmversion von „Das Dschungelbuch“
- Analyse der Anthropomorphisierung der Tiere
- Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier im Film
- Figurenanalyse ausgewählter Tiere
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Fokussierung auf Disneys „Das Dschungelbuch“ im Vergleich zu Kiplings literarischer Vorlage. Sie hebt die kommerzielle und wissenschaftliche Relevanz des Films hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Handlung, die Anthropomorphisierung, das Mensch-Tier-Verhältnis und eine Figurenanalyse konzentriert. Der Mangel an wissenschaftlicher Beachtung von Zeichentrickfilmen wird als Forschungslücke benannt, die diese Arbeit zu schließen versucht.
Tier-Bilder in der Literatur – eine Genreeinordnung: Dieses Kapitel untersucht die Genreeinordnung von „Das Dschungelbuch“, insbesondere die Unterscheidung zwischen Fabel und Tierepos. Es beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung von Tiergeschichten im 19. Jahrhundert, beeinflusst durch den wachsenden Exotismus und Darwins Evolutionstheorie. Das Kapitel analysiert die Merkmale von Fabeln und Tieren und diskutiert, inwieweit Kiplings Werk diesen Genreeigenschaften entspricht. Die Ambivalenz der Einordnung wird betont, da „Das Dschungelbuch“ Elemente beider Genres aufweist.
Rudyard Kiplings „Das Dschungelbuch“: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Kiplings literarische Vorlage. Es beschreibt die einzelnen Geschichten im Buch, die moralische Lehre ("die Regeln des Dschungels") und den Charakter der anthropomorphen Tiere. Besonderes Augenmerk liegt auf den Geschichten um Mowgli, dem menschlichen Protagonisten, der auch im Disney-Film eine zentrale Rolle spielt. Der Fokus liegt darauf, die Handlung und die Thematik des Originals kurz zu skizzieren, um den späteren Vergleich mit der Disney-Version vorzubereiten.
Schlüsselwörter
Das Dschungelbuch, Walt Disney, Rudyard Kipling, Anthropomorphisierung, Mensch-Tier-Verhältnis, Fabel, Tierepos, Figurenanalyse, Zeichentrickfilm, Genreeinordnung, Moral, Regeln des Dschungels.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Walt Disneys "Das Dschungelbuch"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Walt Disneys Verfilmung von Rudyard Kiplings "Das Dschungelbuch" aus dem Jahr 1967. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier, der Anthropomorphisierung der Tierfiguren und einer genre-theoretischen Einordnung des Films im Vergleich zu Kiplings literarischer Vorlage.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Genre-Einordnung von Tiergeschichten, Vergleich zwischen Buch und Film, Analyse der Anthropomorphisierung, das Mensch-Tier-Verhältnis im Film und eine Figurenanalyse ausgewählter Tiere (Baghira, Balu, King Louie, Schir Khan, Kaa).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Genreeinordnung von Tiergeschichten, ein Kapitel zu Kiplings "Das Dschungelbuch", ein Kapitel zu Disneys "Das Dschungelbuch" (inkl. Handlung, Vergleich zur Buchvorlage, Anthropomorphisierung, Mensch-Tier-Verhältnis und Figurenanalyse) und ein Fazit.
Welche Forschungslücke wird geschlossen?
Die Arbeit adressiert den Mangel an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit Zeichentrickfilmen und versucht, diese Forschungslücke zu schließen, indem sie einen bekannten Zeichentrickfilm detailliert analysiert.
Wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Tier analysiert?
Die Analyse des Mensch-Tier-Verhältnisses erfolgt im Kontext der Disney-Verfilmung, indem die Interaktionen zwischen Mowgli und den Tieren sowie die Darstellung der verschiedenen Tiercharaktere untersucht werden. Die Anthropomorphisierung der Tiere spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Figuren werden im Detail analysiert?
Die Figurenanalyse konzentriert sich auf fünf Hauptfiguren: Baghira (die Stimme der Vernunft), Balu (der optimistische Faulpelz), King Louie (der nach mehr strebende König), Schir Khan (der verängstigte Bösewicht) und Kaa (die triebgesteuerte Heuchlerin).
Wie wird der Film genre-theoretisch eingeordnet?
Der Film wird genre-theoretisch im Kontext von Tiergeschichten eingeordnet, wobei die Unterscheidung zwischen Fabel und Tierepos im Hinblick auf Kiplings Werk und dessen Adaption durch Disney untersucht wird. Die Ambivalenz der Einordnung wird betont, da "Das Dschungelbuch" Elemente beider Genres aufweist.
Wie wird Kiplings "Das Dschungelbuch" behandelt?
Kiplings literarische Vorlage wird kurz zusammengefasst, wobei die Handlung, die moralische Lehre ("die Regeln des Dschungels") und die Charaktere der anthropomorphen Tiere beschrieben werden. Der Fokus liegt auf den Geschichten um Mowgli und dient als Grundlage für den Vergleich mit der Disney-Version.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Das Dschungelbuch, Walt Disney, Rudyard Kipling, Anthropomorphisierung, Mensch-Tier-Verhältnis, Fabel, Tierepos, Figurenanalyse, Zeichentrickfilm, Genreeinordnung, Moral, Regeln des Dschungels.
- Quote paper
- Lukas Lohmer (Author), 2012, Eine Analyse der Tierwelt in Disneys "Das Dschungelbuch", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199596