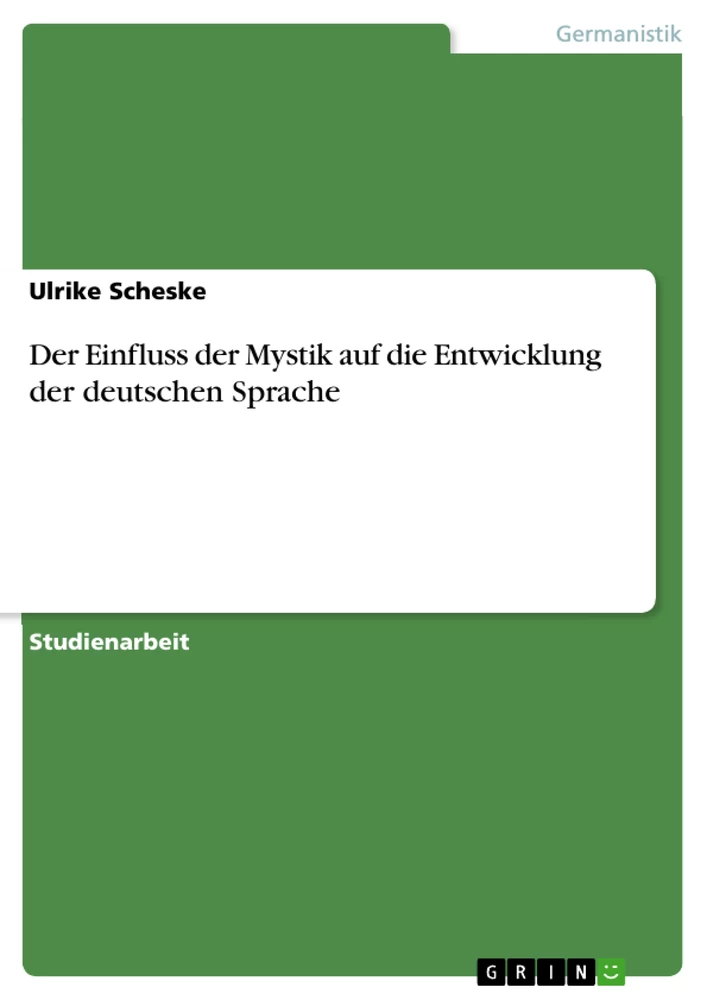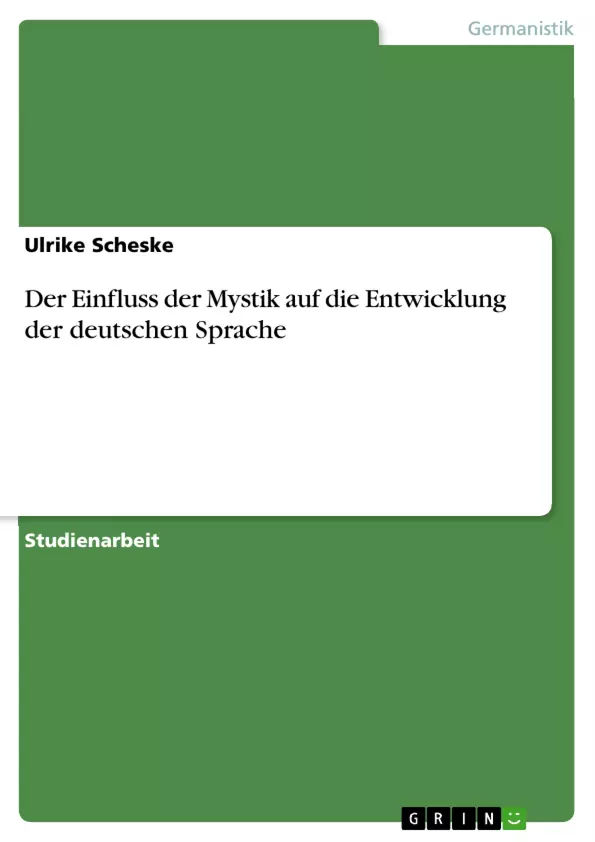Die deutsche Mystik und mit ihr die mystische Literatur begann sich ab der Mitte des 13. Jahrhunderts zu entfalten. Die Bewegung lief neben der offiziellen Kirche her und wirkte unmittelbar auf Nonnen und geistliche Frauen sowie auf andere geistliche Kreise. Bekannte Mystiker waren zum Beispiel Meister Eckehart, Mechthild von Magdeburg und David von Augsburg. Sie lebten vorwiegend im ostmitteldeutschen Sprachraum.
Die Mystiker versenkten sich meditativ in die religiösen Gehalte des Christentums. Ihr Streben war dabei auf eine gefühlsmäßige oder geistige Vereinigung ihrer Seele mit Gott ausgerichtet, der unio mystica. Das Einssein mit Gott konnte sich zwar nur auf außersprachlicher Ebene vollziehen, doch das Wort musste als Medium dienen, um die mystische Erfahrung mitzuteilen und glaubhaft zu machen.
Bei der Versprachlichung religiöser Erlebnisse stießen die Mystiker immer wieder auf das Problem, dass der deutschen Sprache entsprechende Mittel fehlten, um das tiefe Erleben der unio mystica darzustellen. Der Wortschatz erschien unzureichend, um das Verhältnis der eigenen Seele zu Gott zu beschreiben. Sie brauchten neue, nicht vorbelastete Ausdrucksmittel, um ihre Visionen zum Ausdruck zu bringen. Schwierigere Inhalte, die bisher nur durch das Latein wiedergegeben wurden, sollten durch sprachliche Neuerungen angemessener ausgedrückt werden.
Eggers spricht von einer Notwendigkeit der Sprachneuschaffung: „Mystik ist eine so großartige, so umstürzende Bewegung des menschlichen Geistes, daß sie notwendigerweise ihre eigene, unverwechselbare Sprache schaffen muss.“ (Eggers 1991, 69). Diese „höchst sublime und esoterische Sondersprache“ (Tschirch 1989, 78) werde ich im Folgenden eingehender betrachten. Nach einer kurzen Vorstellung der deutschen Mystik und ihrer Träger erfolgt die Darstellung der sprachlichen und stilistischen Besonderheiten der mystischen Texte. Anschließend werden diese Charakteristika an einem Text von Mechthild von Magdeburg belegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die deutsche Mystik
- 1.1. Die mittelalterliche Frauenmystik
- 1.2. Erkenntnismystik und Gefühlsmystik
- 2. Charakteristika der Sprache der deutschen Mystik
- 2.1. Neubildung von Nomina durch Ableitungssuffixe
- 2.2. Wortneubildungen mit Präpositionen und Präfixen
- 2.3. Negativbildungen
- 2.4. Substantivierungen
- 2.5. Lehnübersetzungen
- 2.6. Metaphorik
- 3. Textanalyse: Mechthild von Magdeburg „Von der minne weg an sieben dingen, von drin kleiden der brute und von tantzen“
- 3.1. Einordnung in das Gesamtwerk
- 3.2. Inhalt und Metaphorik
- 3.3. Sprachliche Charakteristika
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Mystik auf die Entwicklung der deutschen Sprache. Sie analysiert die spezifischen sprachlichen und stilistischen Besonderheiten der mystischen Literatur im Mittelalter und untersucht, wie diese Besonderheiten Ausdruck der religiösen und geistigen Erfahrungen der Mystiker waren.
- Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Mystik im 13. Jahrhundert
- Die Rolle der mittelalterlichen Frauenmystik und ihre Auswirkung auf die deutsche Sprache
- Die sprachlichen Charakteristika der mystischen Literatur, insbesondere die Verwendung von Metaphern und Bildsprache
- Die Bedeutung der unio mystica und ihre Darstellung in der Sprache der Mystiker
- Die Analyse eines Textes von Mechthild von Magdeburg als Beispiel für die sprachlichen Besonderheiten der deutschen Mystik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der deutschen Mystik im 13. Jahrhundert vor und erläutert die Entstehung der Bewegung sowie die Rolle der Mystiker und ihrer Schriften. Kapitel 1 behandelt die mittelalterliche Frauenmystik und ihre Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Sprache. Es werden die verschiedenen Visionärinnen, ihre Lebenswege und ihre Schriften vorgestellt.
Kapitel 2 befasst sich mit den sprachlichen Besonderheiten der deutschen Mystik, darunter Wortneubildungen, Negativbildungen, Substantivierungen, Lehnübersetzungen und Metaphern. Es wird gezeigt, wie die Mystiker durch die Verwendung dieser sprachlichen Mittel ihre religiösen Erfahrungen und ihre Vereinigung mit Gott auszudrücken versuchten.
Kapitel 3 analysiert einen Text von Mechthild von Magdeburg, um die sprachlichen Besonderheiten der deutschen Mystik anhand eines konkreten Beispiels zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Deutsche Mystik, Mittelalter, Frauenmystik, Sprachentwicklung, Wortneubildungen, Metaphern, Bildsprache, unio mystica, Mechthild von Magdeburg, Visionsliteratur, religiöse Erfahrung, Gott.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Scheske (Autor:in), 2011, Der Einfluss der Mystik auf die Entwicklung der deutschen Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199559