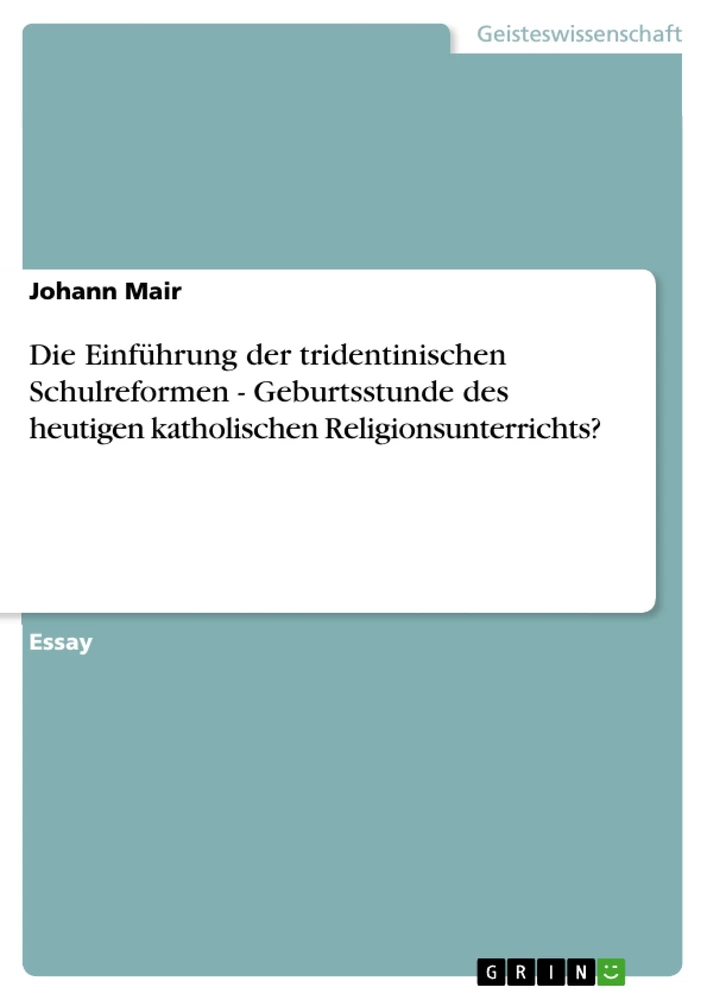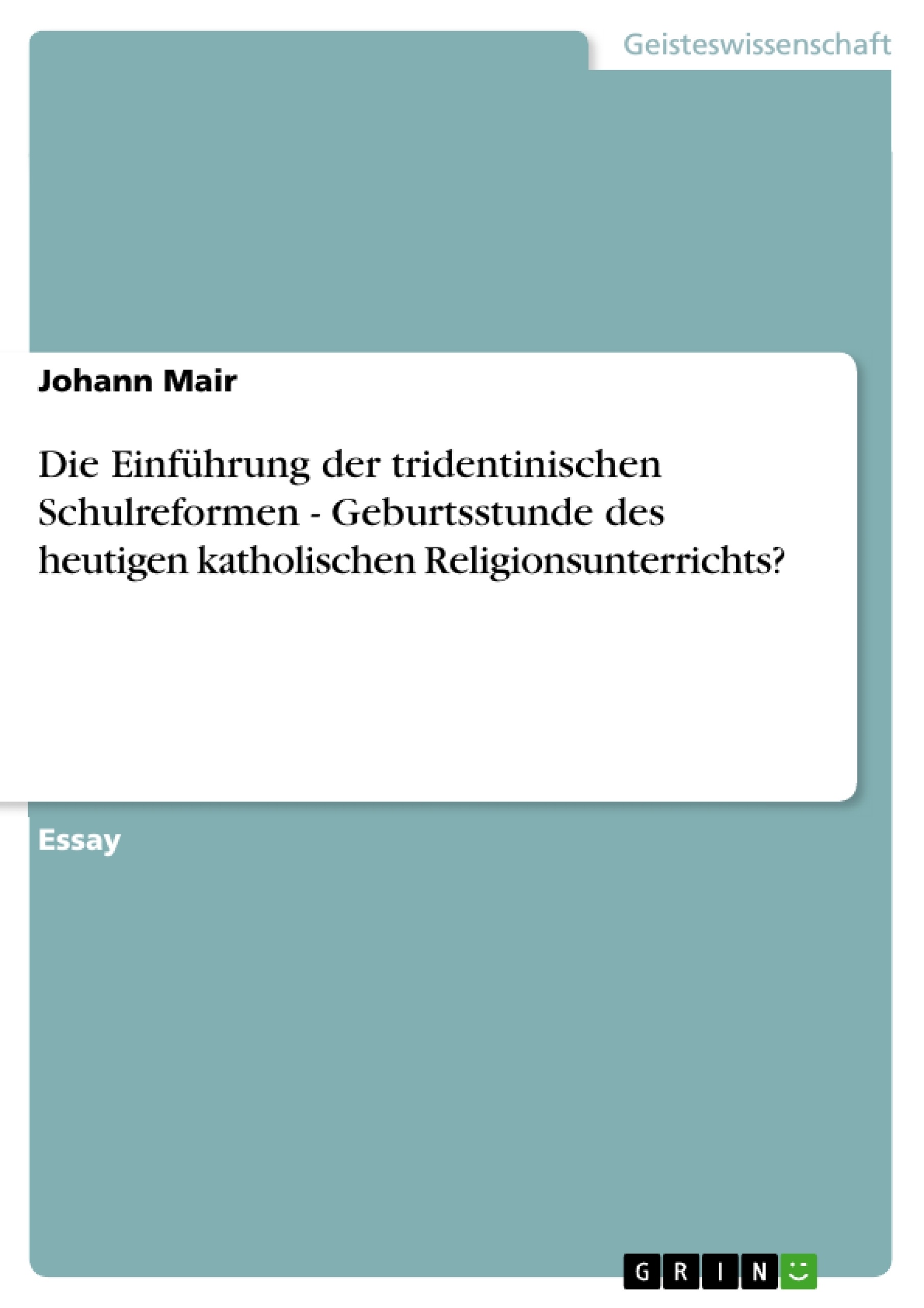Vor fast 30 Jahren bezeichnete Hans-Jochen Gamm in seiner Einführung zum Judentum den Religionsunterricht als das „älteste Schulfach im abendländischen Bildungskanon.“ Hält man sich diese lange Geschichte der religiösen Unterweisung vor Augen, stellt sich die Frage wann und wie diese zu dem wurde, was wir heute als unseren heutigen Religionsunterricht kennen. Gibt es markante historische Einschnitte, die womöglich als „Geburtsstunde“ des modernen Religionsunterrichts angesehen werden können? Einen Einschnitt in der Entwicklung des katholischen religiösen Lehrens stellt mit Sicherheit das Trienter Konzil von 1545 bis 1563 dar, nicht zuletzt weil es eine entscheidende Zäsur für die Geschichte der katholischen Kirche überhaupt war. Die vorliegende Ausführung behandelt daher die Frage, inwiefern das Tridentinum als „Geburtsstunde“ des modernen katholischen Religionsunterrichts angesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entwicklung religiösen Lehrens bis zum Konzil von Trient
3. Das Konzil von Trient, seine Ursachen und sein Vorspiel vor dem Hintergrund religiöser Unterweisung
4. (Nach-)Tridentinische Reformen und religiöse Unterweisung
5. Fazit
6. Quellenverzeichnis
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Vor fast 30 Jahren bezeichnete Hans-Jochen Gamm in seiner Einführung zum Judentum den Religionsunterricht als das „älteste Schulfach im abendländischen Bildungskanon.“[1] Hält man sich diese lange Geschichte der religiösen Unterweisung vor Augen, stellt sich die Frage wann und wie diese zu dem wurde, was wir heute als unseren heutigen Religionsunterricht kennen. Gibt es markante historische Einschnitte, die womöglich als „Geburtsstunde“ des modernen Religionsunterrichts angesehen werden können? Einen Einschnitt in der Entwicklung des katholischen religiösen Lehrens stellt mit Sicherheit das Trienter Konzil von 1545 bis 1563 dar, nicht zuletzt weil es eine entscheidende Zäsur für die Geschichte der katholischen Kirche überhaupt war. Die vorliegende Ausführung behandelt daher die Frage, inwiefern das Tridentinum als „Geburtsstunde“ des modernen katholischen Religionsunterrichts angesehen werden kann.
Zwei Merkmale sind laut Nastainczyk für den heutigen Religionsunterricht konstitutiv. Zum einen ist er an die Schule und ihren Bedingungen gebunden. Zum anderen ist Religionsunterricht nicht nur eine Angelegenheit der Kirche, sondern eine „res mixta“ zwischen ihr und dem Staat.[2] Als weitere Merkmale gelten gemeinhin das Vorhandensein eines pädagogisch gebildeten und kirchlich bevollmächtigten Personals für den Unterricht und die Stellung als ordentliches Lehrfach an Schulen.[3] Letztes wird in Deutschland durch Art. 7 Abs. 2 GG garantiert und sichert hierdurch eine flächendeckende religiöse Unterrichtung.[4]
2. Entwicklung religiösen Lehrens bis zum Konzil von Trient
Gemäß jüdischer Tradition fand religiöse Unterrichtung für Kinder und Jugendliche ausschließlich in elterlicher Verantwortung und im familiären Raum statt.[5] Auch in den Schriften des Paulinismus findet sich die Mahnung, welche das Familienoberhaupt in die Pflicht nimmt, Kinder religiös zu erziehen (Eph 6,4). Dazu zählt auch die Vermittlung der heiligen Schrift: „denn Du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit Du durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst“ (2 Tim 3,15). Hierin erschöpft sich der biblische Auftrag zur religiösen Unterrichtung von Kindern, die auch in der Kirche des Altertums keine Institutionalisierung außerhalb der Familie fand, sieht man von der Erstarkung der Funktion des Paten als religiösen Erzieher ab.[6] Im Altertum befand sich das Christentum zunächst in einer Minderheiten- und Verfolgungssituation, „so dass ein in Schulen institutionalisierter Religionsunterricht sowohl von den politischen und sozialen Voraussetzungen im römischen Reich (Verschmelzung von religiösem Kult und politischer Herrschaft!) wie von den Bedürfnissen der Gemeinde her ausgeschlossen war.“[7] Um die Wende des 3. Jh. setzte eine verstärkte Katechismusbewegung ein, die sich zwar nur auf die Erwachsenen bezog, jedoch bereits Lehrvorträge und Prüfungen kannte.[8] Mit der kurz darauf einsetzenden konstantinischen Wende und der damit begonnenen Entwicklung der Kirche zur Volkskirche wurde dieses Katechumenat hinfällig, da bis zum 5. Jh. die Kinds- die Erwachsenentaufe ablöste.[9]
Eine eigenständige Kinderkatechese war auch dem Mittelalter unbekannt.[10] Zwar entstand im Frühmittelalter ein geistliches und im Hochmittelalter ein städtisch-weltliches Schulwesen unter kirchlicher Aufsicht.[11] „Die religiöse Sozialisation der Massen allerdings war bar jeglicher systematischer Unterweisung; sie vollzog sich im Familienverband und im Medium von Liturgie, Predigt, Mysterien-, Krippen- und Passionsspielen, im Leben und Erleben einer christlich geprägten und interpretierten Umwelt.“ [12]
3. Das Konzil von Trient, seine Ursachen und sein Vorspiel vor dem Hintergrund religiöser Unterweisung
Die alte Kirche befand sich über Jahrhunderte hinweg in einer unangefochtenen Position, wurde von außen nie herausgefordert, musste sich nie verteidigen und hierzu ihr eigenes Handeln reflektieren. Demgemäß konnten ihre „Waffen aus der Rüstkammer der Scholastik“ nicht verhindern, dass innerhalb weniger, aber entscheidender Jahre halb Europa sich vom Papst abwandte.[13] Vor diesem Hintergrund tagte von 1545 bis 1563 das Konzil von Trient, welches die katholische Antwort auf die Herausforderung der Reformation darstellte. Es sollte keine Restauration des vorreformatorischen Katholizismus bewirken, sondern vielmehr eine neue Kirchenverfassung mit zentralistischer Tendenz schaffen.[14]
Auch im Zusammenhang mit der religiösen Unterweisung stellte die Reformation eine Herausforderung für die Kirche dar. Die Konfessionelle Konkurrenz wird sogar als Triebkraft der Etablierung einer eigenen Kinderkatechese angesehen. Im Sinne eines „Priestertums des Gläubigen“ legten die Protestanten großen Wert auf die universelle Kenntnis des Lesens, um die Evangelien verstehen zu können.[15] Durch eine derartige Bildung erhoffte man sich ein Ende durch die Bevormundung des Klerus.[16] Entsprechend stellten Luthers Schriften, besonders sein Schreiben „An die Rasherren“, einen Aufruf zu Reformen der (religiösen) Unterrichtung von Kindern dar.[17] Um gegen schwärmerische Auswüchse aus den eigenen Reihen gewappnet zu sein, die auf das unmittelbare Wirken des heiligen Geistes setzten, sah Luther eine Stärkung der Bildung durch die weltliche Macht vor .[18]
Auch für die katholische Seite ist festzuhalten, „dass die Bemühungen um Schulbildung einhergingen mit dem wachsenden Misstrauen gegen die (bisher herrschende) mündlich geprägte Bildung: Diese trägt offenbar nicht mehr, ist schwer kontrollierbar und potentieller Nährboden für häretische (oder gar unchristliche) Anschauungen und Haltungen.“[19]
Als Antwort auf die neue Bedrohung beschlossen die Konzilsteilnehmer des Tridentinums 1563: „Die Bischöfe sorgen dafür, dass wenigstens an Sonn- und Feiertagen in den einzelnen Pfarreien die Kinder von den zuständigen Personen in den Grundelementen des Glaubens und des Gehorsams gegen Gott und die Eltern gewissenhaft unterwiesen werden. Wenn nötig, zwingen sie dazu Kirchenstrafen. Dies gilt ungeachtet aller Privilegien und Gewohnheiten.“[20] Dieser Beschluss des Konzils ermöglichte erstmals eine systematische und kontinuierliche Belehrung auch der infantilen Gläubigen. Inhaltliche Grundlagen dieser Unterweisung wurden im ebenfalls vom Konzil geplanten und unter Papst Pius V. veröffentlichten Katechismus „Catechismus Romanus“ festgelegt.[21]
Die Reformen der religiösen Erziehung, die auf dem Tridentinum beschlossen wurden, entstanden nicht in einem ideellen Vakuum. Bereits zuvor war eine deutliche Reformmentalität spürbar.[22] Läpple veranschaulicht diese, indem er beispielgebend 28 katechetische Lehrbücher aufführt, die in der Zeit vom beginnenden 16. Jh. bis zum Tridentinum verfasst wurden.[23] Aus dieser Vielzahl ist exemplarisch Erasmus’ von Rotterdam „Explanatio symboli“ von 1533 zu nennen, die ein einfaches Schulbuch für den christlichen Elementarunterricht darstellt, welches Eltern, Paten und Seelsorgern als Vorlage für katechetischen Unterricht dienen sollte.[24] Gleichermaßen ist die umfassende Erziehungslehre „De libri recte instituendeis“ des Humanisten Jacobo Sadoleto aus demselben Jahr hervorzuheben, welche ebenfalls eine kindgerechte Katechese beinhaltete.[25] Hält man sich dieses reformerische Aufbruchsklima vor Augen, ist es nicht verwunderlich, dass manchenorts schon vor den tridentinischen Reformen eine spezifische religiöse Unterweisung von Kindern erfolgte.[26]
[...]
[1] Gamm, Hans-Jochen: Das Judentum. Eine Einführung. Frankfurt a. M. 1979, S. 130.
[2] Nastainczyk, Wolfgang: Art. Religionsunterricht. I. Historisch. in: Lexikon für Theologie und Kirche 8 (31999), Sp. 1074-1076, Sp. 1074.
[3] Stoodt, Dieter: Art. Religionsunterricht in Deutschland. 2. Rechtslage. in: Lexikon der Religionspädagogik 2 (2001), Sp. 1775-1780, Sp. 1775.
[4] Ennuschat, Jörg: Art. Religionsunterricht in Deutschland. 1. Begriff und Geschichte. in: Lexikon der Religionspädagogik 2 (2001), Sp. 1780-1786, Sp. 1781-1784.
[5] Rees, Wilhelm: Der Religionsunterricht und die katechetische Unterweisung in der kirchlichen und staatlichen Rechtsordnung. Regenburg 1986, S. 48.
[6] Rees, Religionsunterricht, S. 49f.
[7] Weber, Bernd: Aspekte zu einer Sozialgeschichte des (evangelischen und katholischen) Religionsunterrichts. in: Anneliese Mannzmann (Hg.): Geschichte der Unterrichtsfächer Bd. 2: Geschichte, Politische Bildung, Geographie, Religion, Philosophie, Pädagogik. München 1983, S. 108-176, S. 113.
[8] Weber, Sozialgeschichte, S. 113.
[9] Läpple, Alfred: Kleine Geschichte der Katechese. München 1981, S. 45-48.
[10] Rees, Religionsunterricht, S. 48f.
[11] Konrad, Franz-Michael: Geschichte der Schule. Von der Antike bis zur Gegenwart. München 2007, S. 27-39.
[12] Weber, Sozialgeschichte, S. 115.
[13] Weitlauff, Manfred: Das Konzil von Trient und die tridentinische Reform auf dem Hintergrund der kirchlichen Umstände der Zeit. in: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 41 (1989), S. 13-59, S. 41.
[14] Weitlauff, Umstände, S. 53.
[15] Weber, Sozialgeschichte, S. 116.
[16] Mette, Norbert: Religionspädagogik, Düsseldorf 22006 (Leitfaden Theologie 24), S. 69.
[17] Goebel, Klaus: Luther als Reformer der Schule. Seine Schrift „An die Ratsherren...“ und Äußerungen des Reformators zu Schule und Erziehung. in: Klaus Goebel (Hg.): Luther in der Schule. Beiträge zur Erziehungs- und Schulgeschichte, Pädagogik und Theologie. Bochum 1985 (Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur historischen Didaktik 6), S. 7-26.
[18] Mette, Religionspädagogik, S. 68.
[19] Paul, Eugen: Geschichte der christlichen Erziehung Bd. 2: Barock und Aufklärung. Freiburg u. a. 1995, S. 133.
[20] Concilium Tridentinum, Sessio XXIV, Decretum de reformatione, Canon IV. in: Josef Wohlmuth (Hg.): Dekrete der ökumenischen Konzilien Bd. 3: Konzilien der Neuzeit. Paderborn 2002, S. 763.
[21] Rees, Religionsunterricht, S. 52.
[22] Paul, Erziehung, S. 87-96.
[23] Läpple, Katechese, S. 90f.
[24] Erasmus, Desiderius: Dilecida et pia explanatio symboli quod apostolorum dicitur et decalogi praeceptorum. Antwerpen 1533.
[25] Sadoleto, Jacobo: De libris recte instituendes. Venedig 1533.
[26] Paul, Erziehung, S. 14.
- Arbeit zitieren
- Johann Mair (Autor:in), 2008, Die Einführung der tridentinischen Schulreformen - Geburtsstunde des heutigen katholischen Religionsunterrichts?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/197784