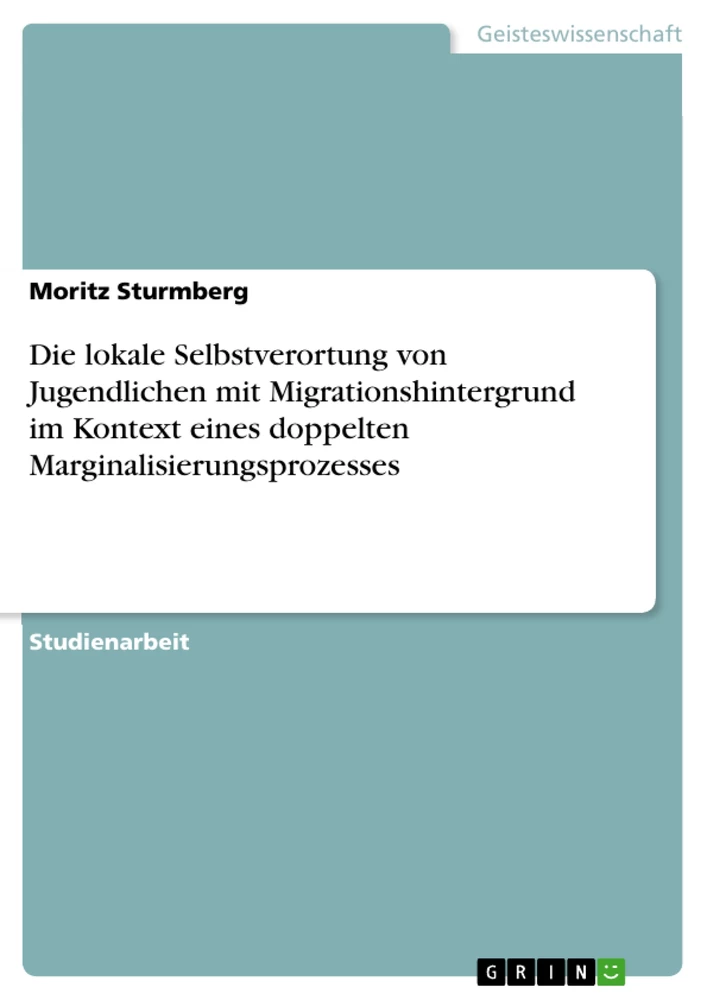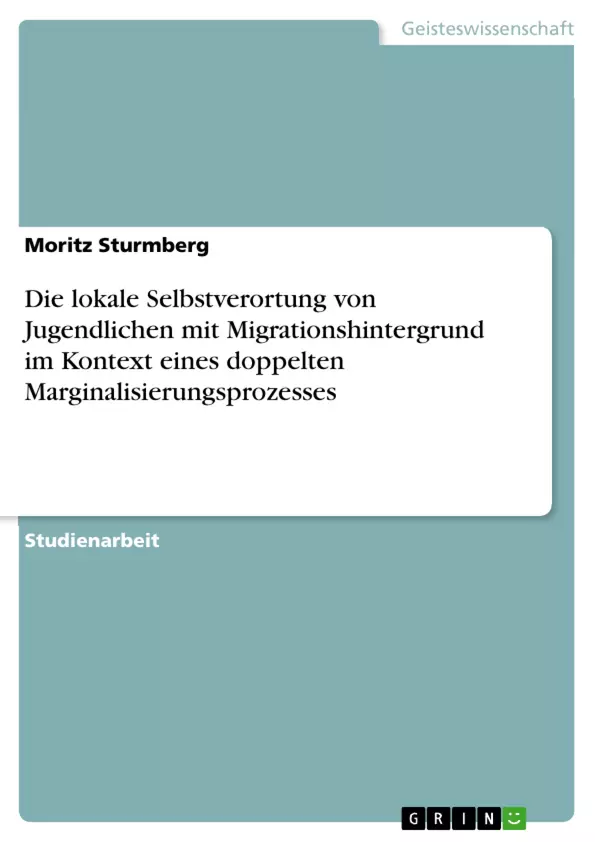Heterogenität als Problem oder Reichtum? Der wissenschaftlich fundierte Begriff der „Parallelgesellschaft“ zeigt deutlich, dass die öffentliche Wahrnehmung, allen voran der alltagstheoretische Diskurs, in der Diskussion um Jugendliche mit Migrationshintergrund in städtischen Quartieren eine eindimensionale Position einnimmt. Wenn von „Integrationsschwierigkeiten der dritten und vierten Generation“ gesprochen wird, wird eine vornehmlich problemzentrierte Wahrnehmung deutlich, die eine ressourcenorientierte Wahrnehmung von pluriformen Lebenslagen und die Heterogenität von Lebensentwürfen und Positionierungen in den sogenannten „Brennpunkten“ außer Acht lässt (Vgl. Riegel/Geisen, 2007, S.15). Neben dem dramatisierenden „Kulturkampf“ gehört hierzu auch die Metapher des ‚zwischen zwei Stühlen sitzens’ und der entsprechenden pädagogischen Literatur, die sich des „Problems“ der betreffenden migrantischen Jugendlichen annehmen möchte (Vgl. Schulze in Riegel/Geisen, 2007, S. 97f). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll der Blick einerseits auf die Quartiere als Ort augenscheinlich gelebter Realität von Heterogenität und individueller Lebensgestaltung gebündelt werden, andererseits der Blick in Hinsicht auf die Selbstbehauptung vieler Jugendlicher mit Migrationshintergrund gegenüber einem sehr statischen Kulturbegriff, mehrheitsgesellschaftlicher Mythen und ihrer medialen Repräsentation geweitet werden.
Diese Arbeit soll auf Grundlage der qualitativen Studie von Schulze „’Und ich fühl mich als Kölner, speziell als Nippeser’ Lokale Verortung als widersprüchlicher Prozess“ einen tieferen Einblick in die Positionierung und Identitätsfindung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ermöglichen und ihren Umgang mit Ausgrenzungs- und Zuschreibungsprozessen kennzeichnen. Als Basisliteratur dient die Einführung von Christine Riegel und Thomas Geisen aus dem Sammelwerk „Jugend, Zugehörigkeit und Migration - Subjektpositionierung im Kontext von Jugendkultur, Ethnizitäts- und Geschlechter-konstruktionen“, deren Thematik von Schulze als Beitrag des Sammelbands aufgegriffen wird. Weitere begleitende Literatur soll schließlich die Situation vieler betroffener Jugendlicher als Positionierung und Kampf um Anerkennung außerhalb einer mehrheitsgesellschaftlichen Mitgliedschaft darstellen und zudem schließlich in Ansätzen den Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zum status quo aus politischer, ökonomischer und sozialstruktureller Hinsicht vor Augen halten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zugehörigkeit und Zugehörigkeit im Kontext von Migration
- 3. Die lokale Selbstverortung - ein widersprüchlicher Prozess
- 4. Strategien der Selbstbehauptung
- 5. Exkurs: „Unterschichtung“ als Merkmal der Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die lokale Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen und Widersprüche, denen diese Jugendlichen im Kontext von Ausgrenzung und Zuschreibungsprozessen begegnen. Die Studie basiert auf qualitativen Daten und beleuchtet den Umgang der Jugendlichen mit ihrer Identität und Zugehörigkeit.
- Identitätsfindung und Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Zugehörigkeit und Ausgrenzung im Kontext von Migration
- Widersprüchliche Prozesse der lokalen Selbstverortung
- Strategien der Selbstbehauptung im Angesicht von gesellschaftlichen Zuschreibungen
- Der Einfluss von Mehrheitsgesellschaftlichen Mythen und medialen Repräsentationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung problematisiert die eindimensionale, problemzentrierte öffentliche Wahrnehmung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in städtischen Quartieren. Sie kritisiert die Fokussierung auf „Integrationsschwierigkeiten“ und das Ausblenden ressourcenorientierter Perspektiven und der Heterogenität von Lebensentwürfen. Die Arbeit fokussiert auf die Quartiere als Orte gelebter Heterogenität und die Selbstbehauptung von Jugendlichen gegenüber statischen Kulturbegriffen und medialen Repräsentationen. Sie basiert auf einer qualitativen Studie, die Einblicke in die Positionierung und Identitätsfindung dieser Jugendlichen ermöglichen soll.
2. Zugehörigkeit und Zugehörigkeit im Kontext von Migration: Dieses Kapitel beleuchtet die adoleszente Identitätsentwicklung und die Bedeutung verschiedener Zugehörigkeitskontexte (nationalstaatlich, international, lokal, familiär, sozial, kulturell etc.). Es hebt das Potenzial dieser Kontexte zur Bereitstellung sozialer Ressourcen und zur Förderung von Handlungsfähigkeit hervor. Zugleich wird die Problematik unterschiedlicher Anerkennung von Zugehörigkeiten thematisiert, insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund, die zwischen vielfältigen Zugehörigkeitskontexten und Ausgrenzungs- und Zuschreibungserfahrungen stehen. Die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdzuordnungen sowie die ambivalente Relation zwischen positiver Identifikation mit einer Gruppe und Abgrenzung von Anderen werden diskutiert.
3. Die lokale Selbstverortung - ein widersprüchlicher Prozess: Dieses Kapitel setzt sich mit der lokalen Selbstverortung im Kontext der Globalisierung auseinander. Die zunehmende Mobilität von Menschen und die Entstehung neuer transnationaler Gemeinschaftsformen werden thematisiert. Es wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus der Spannung zwischen nationalstaatlichen Identitätsvorstellungen und globalen Mobilitätsmustern ergeben. Der Textfragment endet hier, ohne die Kapitel 4, 5 und 6 weiter zu umfassen.
Schlüsselwörter
Jugendliche mit Migrationshintergrund, lokale Selbstverortung, Identitätsfindung, Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Zuschreibungsprozesse, Migration, Integration, Mehrheitsgesellschaft, Identitätskonstruktion, Heterogenität, Selbstbehauptung, qualitative Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Lokale Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht die lokale Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen und Widersprüche, denen diese Jugendlichen im Kontext von Ausgrenzung und Zuschreibungsprozessen begegnen. Der Fokus liegt auf der Identitätsfindung und dem Umgang mit Zugehörigkeit und Ausgrenzung.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Studie basiert auf qualitativen Daten und bietet Einblicke in die Positionierung und Identitätsfindung der Jugendlichen. Es wird nicht explizit auf die genaue Methode eingegangen, aber es ist klar, dass qualitative Forschungsmethoden zum Einsatz kamen.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie umfasst mindestens sechs Kapitel: Einleitung, Zugehörigkeit und Zugehörigkeit im Kontext von Migration, Die lokale Selbstverortung - ein widersprüchlicher Prozess, Strategien der Selbstbehauptung, ein Exkurs zu „Unterschichtung“ als Merkmal der Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und ein Fazit. Die detaillierte Zusammenfassung ist jedoch nur für die ersten drei Kapitel verfügbar.
Was sind die zentralen Themen der Studie?
Zentrale Themen sind Identitätsfindung und Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Zugehörigkeit und Ausgrenzung im Kontext von Migration, widersprüchliche Prozesse der lokalen Selbstverortung, Strategien der Selbstbehauptung im Angesicht gesellschaftlicher Zuschreibungen und der Einfluss von Mehrheitsgesellschaftlichen Mythen und medialen Repräsentationen.
Was ist das Ziel der Studie?
Die Studie will die lokale Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund untersuchen und die Herausforderungen und Widersprüche beleuchten, denen sie im Kontext von Ausgrenzung und Zuschreibungsprozessen begegnen. Sie kritisiert dabei eine eindimensionale, problemzentrierte öffentliche Wahrnehmung und möchte ressourcenorientierte Perspektiven und die Heterogenität von Lebensentwürfen in den Fokus rücken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Jugendliche mit Migrationshintergrund, lokale Selbstverortung, Identitätsfindung, Zugehörigkeit, Ausgrenzung, Zuschreibungsprozesse, Migration, Integration, Mehrheitsgesellschaft, Identitätskonstruktion, Heterogenität, Selbstbehauptung, qualitative Studie.
Was wird in Kapitel 1 (Einleitung) behandelt?
Kapitel 1 problematisiert die eindimensionale, problemzentrierte öffentliche Wahrnehmung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Es kritisiert die Fokussierung auf „Integrationsschwierigkeiten“ und das Ausblenden ressourcenorientierter Perspektiven. Der Fokus liegt auf den Quartieren als Orten gelebter Heterogenität und der Selbstbehauptung der Jugendlichen gegenüber statischen Kulturbegriffen und medialen Repräsentationen.
Was wird in Kapitel 2 (Zugehörigkeit und Zugehörigkeit im Kontext von Migration) behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die adoleszente Identitätsentwicklung und die Bedeutung verschiedener Zugehörigkeitskontexte. Es hebt das Potenzial dieser Kontexte zur Bereitstellung sozialer Ressourcen hervor und thematisiert die Problematik unterschiedlicher Anerkennung von Zugehörigkeiten, insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdzuordnungen wird diskutiert.
Was wird in Kapitel 3 (Die lokale Selbstverortung - ein widersprüchlicher Prozess) behandelt?
Kapitel 3 setzt sich mit der lokalen Selbstverortung im Kontext der Globalisierung auseinander. Die zunehmende Mobilität von Menschen und die Entstehung neuer transnationaler Gemeinschaftsformen werden thematisiert. Es wird auf die Herausforderungen hingewiesen, die sich aus der Spannung zwischen nationalstaatlichen Identitätsvorstellungen und globalen Mobilitätsmustern ergeben.
- Arbeit zitieren
- Moritz Sturmberg (Autor:in), 2011, Die lokale Selbstverortung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Kontext eines doppelten Marginalisierungsprozesses, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/197552