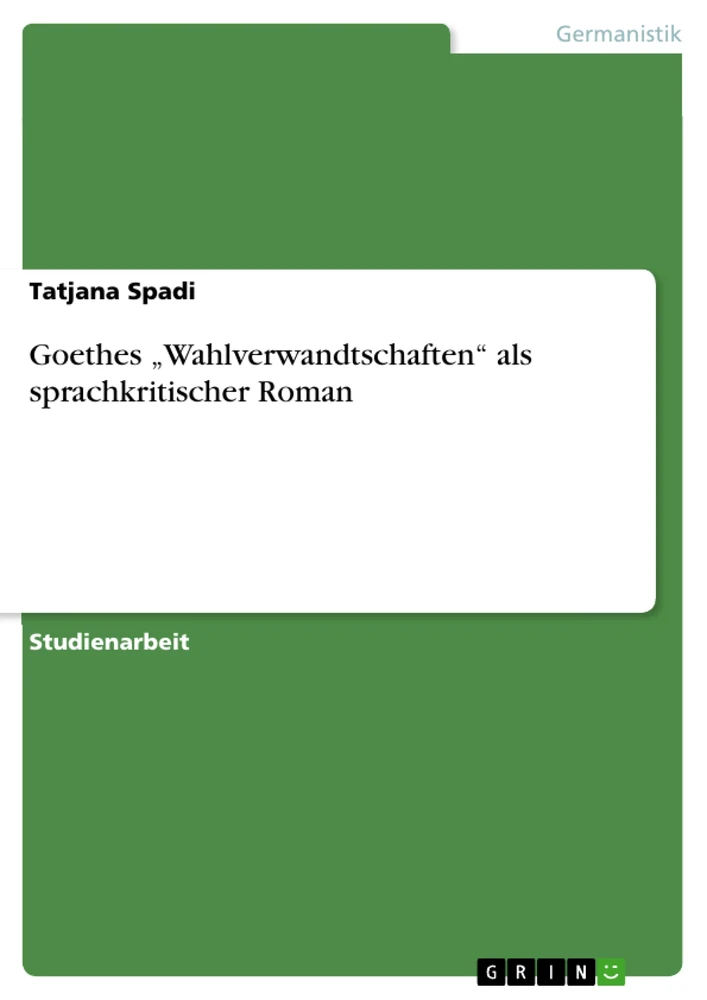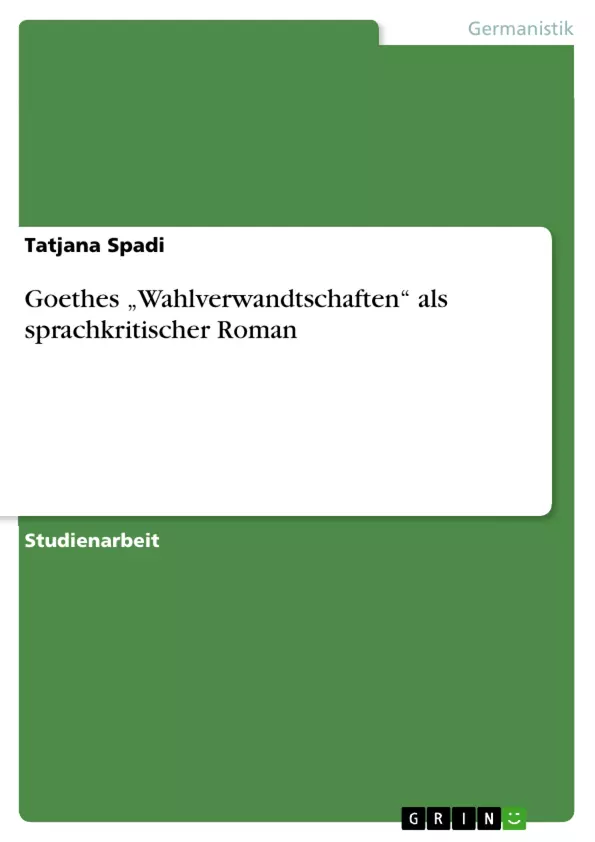Einleitung:
Würde man Johann Wolfgang von Goethe in seiner dichterischen Tätigkeit
charakterisieren, so müsste man ihn als ein sprachliches Genie bezeichnen. Kaum ein anderer weiß mit der Sprache so umzugehen und kann sich so anschaulich und mannigfaltig ausdrücken. Um so verwunderlicher wirkt dann der Titel dieser Arbeit: Goethes „Wahlverwandtschaften“ als sprachkritisches Werk. Denn Sprachkritik gehört nicht unbedingt zu den ersten Assoziationen, mit denen Goethes Werke in Verbindung gebracht werden. Und doch lassen sich eben auch sprachkritische Momente in Goethes theoretischen, aber auch literarischen Schriften erkennen. Diese Feststellung findet sich auch in der Literatur über Goethes Äußerungen zur Sprache. Dabei zeigt sich zunächst, dass für Goethe Sprache immer ein bedeutendes Thema war. Doch wie genau sah seine Sprachauffassung aus? Sollte man nicht denken, dass Goethe die Sprache als Ausdrucksmittel besonders schätzte und von ihr als einzig wahre Aussageform überzeugt war? Betrachtet man seine sprachbezogenen Äußerungen, so lässt sich dieser Standpunkt vorerst nicht bestreiten. Andererseits war sich Goethe sowohl der eigenen Sprachkompetenz als auch dem Vermittlungspotenzial
der Sprache im Allgemeinen nicht immer sicher, sodass sich bei ihm von einer Ambivalenz zwischen Sprachvertrauen und Sprachkritik sprechen lässt. Ein ähnliche Bild von Goethes Spracheinschätzung nimmt auch Andrea Bartl in ihrer Darstellung zur Sprachskepsis in der deutschen Literatur um 1800 wahr. Wie genau diese Bewertungen der Sprache durch Goethe aussahen, wird in einem weiteren Teil dieser Arbeit näher dargelegt. Bevor ich jedoch speziell auf die sprachtheoretischen Abhandlungen Goethes eingehe, werde ich zunächst den Begriff der Sprachskepsis, wie er vor allem von Günter Saße entworfen wurde, thematisieren. Auf dem theoretischen Hintergrund soll sich dann der Hauptteil entfalten, welcher sich den sprachkritischen Aspekten in Goethes literarischem Wirken widmet. In dieser Arbeit wird es genauer um den Roman ,Die Wahlverwandtschaften‘ gehen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, in wie weit sich hierbei von einem sprachkritischen Roman sprechen lässt. Bietet die
Erzählung in der Tat ein breites Spektrum an Sprachkritik oder lassen sich sogar Momente einer Sprachsicherheit finden? Zum Schluss soll es jedoch nicht dabei belassen werden, dass Goethe sein Problem mit der Sprache offen lässt. Als Lösungsvorschlag wird der Begriff des Symbols eingeführt und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Goethe zwischen Sprachvertrauen und Sprachkritik
- 2. Allgemeine Theorien zur Sprachkritik
- 2.1. Ontologische Bedeutungstheorie
- 2.2. Pragmatische Bedeutungstheorie
- 3. Goethes Sprachauffassung
- 3.1. Sprachvertrauen
- 3.2. Sprachkritik
- 3.2.1. Betrachtung unterschiedlicher Sprachformen
- 3.2.2. Das Allgemeine und das Besondere
- 3.2.3. Sprache als Surrogat
- 3.2.4. Metaphysischer Sprachbegriff
- 4. Sprachkritik in „Die Wahlverwandtschaften“
- 4.1. Ordnungs- und Definitionsprobleme
- 4.2. Kommunikationsprobleme
- 4.2.1. Kommunikationsprobleme auf der Figurenebene
- 4.2.2. Kommunikationsverhältnis zwischen Leser und Erzähler
- 4.2.3. Kommunikationsproblematik in der Gestalt des Mittlers
- 4.3. Schweigen als Ausdruck von Sprachkritik
- 4.4. Ottilie als „Sprachbeherrscherin“
- 5. Schluss: Eine Lösung für die Unzulänglichkeit der Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes „Wahlverwandtschaften“ auf sprachkritische Aspekte. Sie beleuchtet Goethes ambivalentes Verhältnis zur Sprache – zwischen Sprachvertrauen und -kritik – und analysiert, wie diese Ambivalenz im Roman zum Ausdruck kommt. Die Arbeit stützt sich dabei auf verschiedene sprachtheoretische Ansätze.
- Goethes Sprachauffassung und seine Ambivalenz zwischen Sprachvertrauen und -kritik
- Anwendung ontologischer und pragmatischer Bedeutungstheorien auf Goethes Werk
- Analyse der Kommunikationsprobleme und der Rolle des Schweigens in „Die Wahlverwandtschaften“
- Untersuchung verschiedener Sprachformen und ihrer Bedeutung im Roman
- Der Roman als Reflexion der Unzulänglichkeit der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Goethe zwischen Sprachvertrauen und Sprachkritik: Die Einleitung stellt die These auf, dass Goethes „Wahlverwandtschaften“ als sprachkritischer Roman interpretiert werden kann, obwohl Goethe zunächst als sprachliches Genie bekannt ist. Sie führt verschiedene Literaturwissenschaftler an, die sich mit Goethes Sprachauffassung auseinandergesetzt haben und verdeutlicht die Ambivalenz zwischen Sprachvertrauen und -kritik in Goethes Werk. Die Einleitung skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit und kündigt die Analyse der „Wahlverwandtschaften“ an.
2. Allgemeine Theorien zur Sprachkritik: Dieses Kapitel führt in die Theorie der Sprachkritik ein, insbesondere in die von Günter Saße entwickelte binäre Typologie. Es werden die ontologische und die pragmatische Bedeutungstheorie erläutert und ihre Relevanz für die sprachkritische Literaturanalyse herausgestellt. Die ontologische Bedeutungstheorie betont die Schwierigkeit, die Wirklichkeit adäquat sprachlich darzustellen, während die pragmatische Bedeutungstheorie den Fokus auf die kommunikativen Aspekte der Sprache legt. Der Abschnitt dient als theoretischer Rahmen für die spätere Analyse von Goethes Werk.
3. Goethes Sprachauffassung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit Goethes eigenem Verständnis von Sprache. Es unterscheidet zwischen Goethes Sprachvertrauen, das seine Fähigkeit, sich eindrucksvoll und vielseitig auszudrücken, unterstreicht, und seiner Sprachkritik, die sich in der Auseinandersetzung mit den Grenzen und Unzulänglichkeiten der Sprache zeigt. Es analysiert verschiedene Aspekte von Goethes Sprachkritik, darunter die Betrachtung unterschiedlicher Sprachformen, das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, die Sprache als Surrogat und den metaphysischen Sprachbegriff.
4. Sprachkritik in „Die Wahlverwandtschaften“: Dieser Abschnitt analysiert die „Wahlverwandtschaften“ im Hinblick auf ihre sprachkritischen Aspekte. Er untersucht die Ordnungs- und Definitionsprobleme, die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Figuren sowie zwischen Leser und Erzähler und die Rolle des Schweigens als Ausdruck von Sprachkritik. Die Analyse beleuchtet, wie die sprachlichen Mittel des Romans die Thematik der Unzulänglichkeit von Sprache unterstützen und die Schwierigkeiten der Figuren bei der Kommunikation und Selbstfindung widerspiegeln. Die besondere Rolle Ottilies als „Sprachbeherrscherin“ wird ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Goethe, Wahlverwandtschaften, Sprachkritik, Sprachvertrauen, Ontologische Bedeutungstheorie, Pragmatische Bedeutungstheorie, Kommunikation, Schweigen, Symbol, Romananalyse, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Sprachkritik in Goethes „Wahlverwandtschaften“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“ unter dem Aspekt der Sprachkritik. Sie untersucht Goethes ambivalentes Verhältnis zur Sprache – zwischen Sprachvertrauen und -kritik – und wie sich diese Ambivalenz im Roman manifestiert.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene sprachtheoretische Ansätze, insbesondere die ontologische und die pragmatische Bedeutungstheorie. Diese Theorien dienen als theoretischer Rahmen für die Analyse der sprachkritischen Aspekte im Roman.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, allgemeine Theorien zur Sprachkritik, Goethes Sprachauffassung, Sprachkritik in „Die Wahlverwandtschaften“ und Schluss. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einführung in die Problematik und endend mit einer zusammenfassenden Schlussfolgerung.
Welche Aspekte von Goethes Sprachauffassung werden behandelt?
Die Arbeit untersucht Goethes Sprachvertrauen und seine Sprachkritik. Im Detail werden Aspekte wie die Betrachtung unterschiedlicher Sprachformen, das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, Sprache als Surrogat und der metaphysische Sprachbegriff analysiert.
Wie wird die Sprachkritik in „Die Wahlverwandtschaften“ analysiert?
Die Analyse von „Die Wahlverwandtschaften“ konzentriert sich auf Ordnungs- und Definitionsprobleme, Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Figuren und zwischen Leser und Erzähler, die Rolle des Schweigens und die besondere Rolle Ottilies als „Sprachbeherrscherin“.
Welche Rolle spielt das Schweigen im Roman?
Das Schweigen wird als ein wichtiger Ausdruck der Sprachkritik im Roman interpretiert. Es wird untersucht, wie Schweigen die Kommunikationsprobleme und die Unzulänglichkeit der Sprache verdeutlicht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu einer Schlussfolgerung über die Unzulänglichkeit der Sprache und wie diese im Roman thematisiert wird. Sie fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine Gesamtsicht auf Goethes sprachkritische Position.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Wahlverwandtschaften, Sprachkritik, Sprachvertrauen, Ontologische Bedeutungstheorie, Pragmatische Bedeutungstheorie, Kommunikation, Schweigen, Symbol, Romananalyse, Literaturwissenschaft.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen für jedes Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Argumente jedes Abschnitts zusammenfassen und den Lesefluss erleichtern.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für Goethes „Wahlverwandtschaften“, Sprachphilosophie und Literaturwissenschaft interessieren. Sie ist besonders nützlich für akademische Zwecke und die Analyse literarischer Texte.
- Arbeit zitieren
- Tatjana Spadi (Autor:in), 2011, Goethes „Wahlverwandtschaften“ als sprachkritischer Roman, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/197405