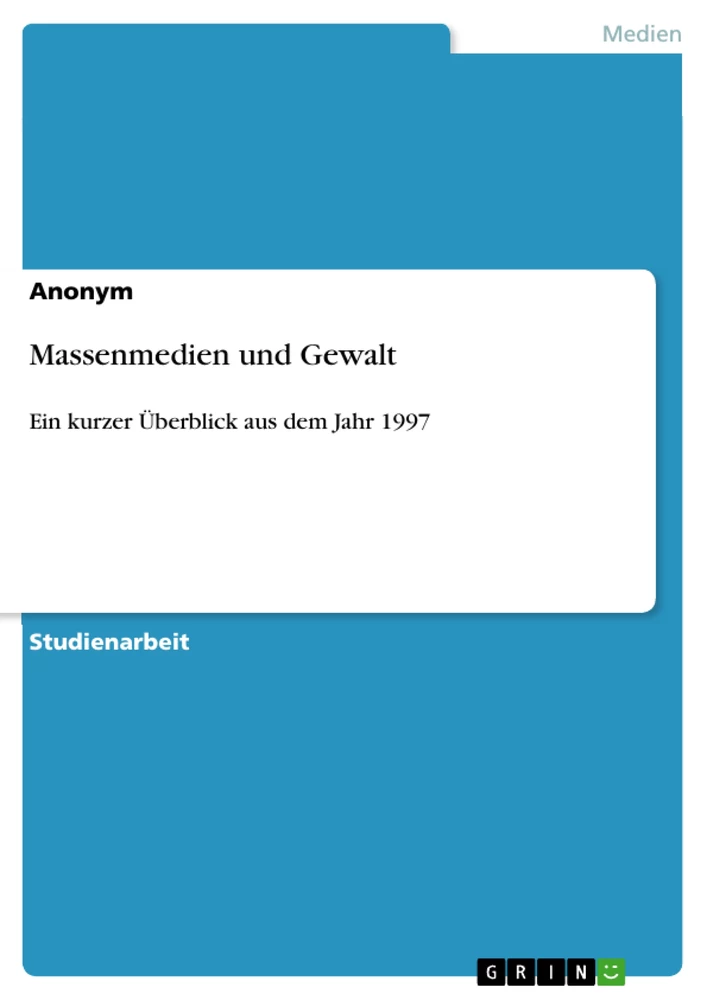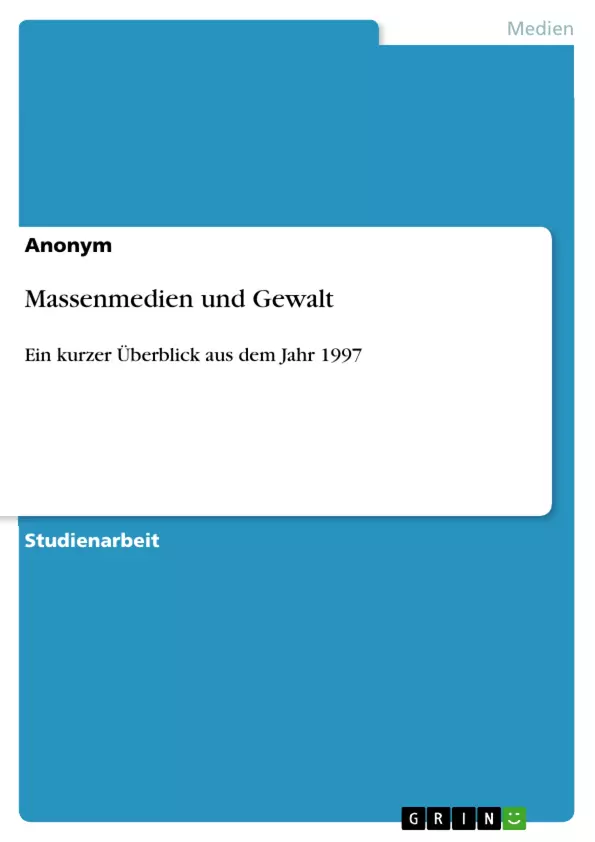Die Diskussion um die Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien ist ein in der Öffentlichkeit immer wieder auftauchendes Thema: Von den einen wird das Fernsehen als Ausgeburt des Teufels betrachtet, die unsere Kultur zerstört und eine Bedrohung für die Menschheit darstellt, während die anderen all diese Vorwürfe abstreiten und keine gefährlichen Auswirkungen befürchten. Vor kurzem ist durch einen vierzehnjährigen Jungen, der mit einer Axt auf seine Cousine und eine Nachbarin einhackte nach dem er sich den Film „Freitag de 13.“ ansah. In dieser Arbeit wird vor allem auf das Fernsehen eingegangen, da es wohl das wichtigste Medium hinsichtlich Gewaltdarstellungen und deren Effekte verkörpert, aber auch andere Medien, wie beispielsweise Comics, Computerspiele oder Bücher, können hier eine Rolle spielen (z.B. wurde in Norwegen ein Kriminaldelikt der Panzerknackerbande eines Micky-Maus-Hefts imitiert1). Die Diskussion über die Wirkungen von Gewaltdarstellungen ist schon sehr lange existent: z.B. wurde schon im antiken Griechenland diskutiert, ob Märchenerzählern den Kindern durch Geschichten über Greueltaten falsche Gedanken zuführen, die sie eigentlich nicht haben sollten.
Um die Wirkung von Gewaltdarstellungen zu analysieren, ist es vor allem wichtig, zu betrachten, welche Inhalte unter welchen Umständen auf welche Individuen wie wirken, eine Verallgemeinerung der Auswirkungen auf die breite Masse ist nahezu unmöglich.
Zum Thema „Massenmedien und Gewalt“ sind unzählige Studien durchgeführt worden und es gibt eine Unmenge von Theorien und Modellen, jedoch ist die Interpretation der Untersuchungsergebnisse sehr problematisch, da beinahe jeder Wissenschaftler seine Studien auf irgendeine Weise so auslegen kann, daß seine eigene Meinung bestätigt wird. Auch sind viele Studien von vornherein schon so ausgelegt, daß sie eine bestimmte Theorie untermauern. Hier soll vor allem auf die wichtigsten Theorien und Thesen eingegangen werden, aber auch auf gesellschaftliche Aspekte und Expertenbefragung, den Gewaltbegriff an sich und die Berichterstattung über Gewaltverbrechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Gewalt
- Modelle zur Wirkung der Massenmedien
- Die Katharsisthese
- Die Inhibitionsthese
- Die Stimulationsthese
- Die Lerntheorie
- Massenmediale Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Die Kontroll- und Reflexionsthese
- Die Eskapismustheorie
- Strukturelle Gewalt (indirekte Gewalt)
- Sexuelle Gewalt
- Kommerzialisierung des Fernsehens
- Methoden der Wirkungsforschung
- Felduntersuchungen versus Laborstudien
- Wirkungsforschung
- Die Vielseherforschung
- Nachrichten und Gewalt
- Die Struktur von Gewaltdarstellungen in den Medien
- Expertenbefragung/Problemgruppenanalyse
- Richter und Staatsanwälte
- Psychiater und Psychologen
- Schlußanmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexen Beziehungen zwischen Massenmedien und Gewalt. Sie setzt sich zum Ziel, die unterschiedlichen Theorien und Modelle zur Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien zu beleuchten und kritisch zu analysieren.
- Die Definition von Gewalt und ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen.
- Die verschiedenen Modelle zur Wirkung von Massenmedien auf Individuen und Gesellschaften, einschließlich der Katharsisthese, der Inhibitionsthese und der Stimulationsthese.
- Die Rolle von Mediengewalt bei der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Kontext der Lerntheorie.
- Die gesellschaftlichen Aspekte der Massenmedien und die Auswirkungen von Gewaltverbrechen auf die Gesellschaft.
- Die Methoden der Wirkungsforschung und die Bedeutung der Vielseherforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die kontroverse Debatte um die Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien und stellt die zentrale These der Arbeit dar: Die Wirkung von Gewaltdarstellungen ist komplex und hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Inhalte, die Umstände und die Rezipienten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Gewalt“ und den Schwierigkeiten, ihn eindeutig zu fassen. Es werden verschiedene Ansätze zur Messung von Gewalt diskutiert und die Bedeutung des Alters der Versuchspersonen für die Interpretation von Forschungsergebnissen hervorgehoben.
Kapitel drei analysiert verschiedene Modelle zur Wirkung der Massenmedien. Es wird die Entwicklung vom Stimulus-Response-Modell zum S-O-R-Modell dargestellt, welches den Organismus als aktiven Filter der Medienwirkung betrachtet.
Die Katharsisthese, die Inhibitionsthese und die Stimulationsthese werden in den folgenden Unterkapiteln im Detail vorgestellt. Die Stimulationsthese wird anhand eines Experiments von L. Berkowitz erläutert, das den Einfluss von Frustration und gewalttätigen Medieninhalten auf Aggression untersucht.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Lerntheorie, die besagt, dass das häufige Ansehen von Gewalt in Medien insbesondere Jugendliche und Kinder mit latenten aggressiven Handlungsmustern versorgt.
Das Kapitel über die Massenmedialen Auswirkungen auf die Gesellschaft befasst sich mit den Aspekten der Kontroll- und Reflexionstheorie sowie der Eskapismustheorie.
Kapitel sechs erläutert die Kommerzialisierung des Fernsehens und die Methoden der Wirkungsforschung, darunter Felduntersuchungen und Laborstudien.
Das Kapitel über die Vielseherforschung untersucht die Auswirkungen des häufigen Konsums von Fernsehprogrammen.
Im letzten Kapitel werden Nachrichten und Gewalt analysiert. Es werden die Struktur von Gewaltdarstellungen in den Medien sowie die Ergebnisse von Expertenbefragungen von Richtern, Staatsanwälten, Psychiatern und Psychologen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Gewalt, Mediengewalt, Massenkommunikation, Wirkungsforschung, Theorien der Medienwirkung, Katharsisthese, Inhibitionsthese, Stimulationsthese, Lerntheorie, Gesellschaftliche Auswirkungen, Vielseherforschung, Expertenbefragung, Gewaltdarstellungen in den Medien.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 1997, Massenmedien und Gewalt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196