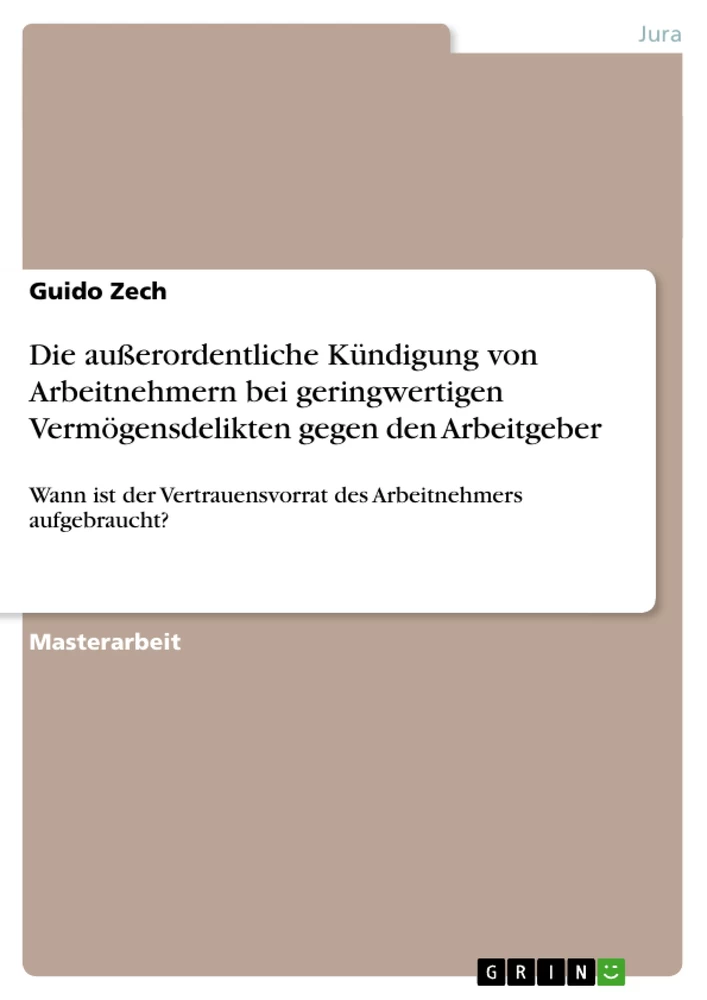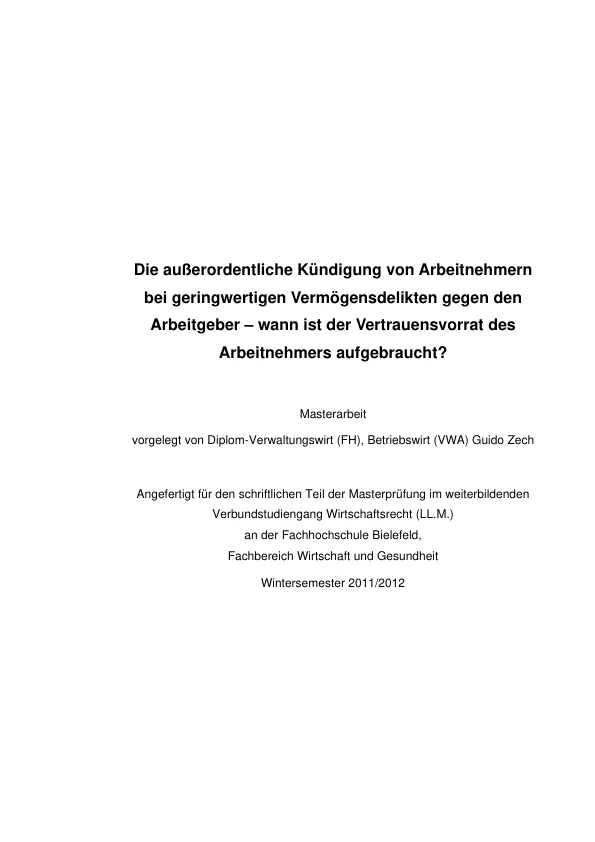Die sog. „Bienenstich“- Rechtsprechung aus dem Jahr 1984 hatte die Rechtslage bei Vermögensdelikten von Arbeitnehmern gegen ihren Arbeit-geber klar gestellt: „Wer klaut, der fliegt!“. Eine Abmahnung ist in diesen Fällen entbehrlich, da derartige Delikte das Vertrauen des Arbeitgebers in den Arbeitnehmer nachhaltig und unwiederbringlich erschüttern und somit einen „wichtigen Grund“ i.S.d. § 626 Abs. 1 BGB darstellen, der eine Weiterbeschäftigung unzumutbar macht. Die Geringwertigkeit des Schadens und die Umstände der Tat sind in der Folge nicht nur im Rahmen der Rechtsprechung thematisiert worden, sondern auch in der Literatur. Eine breite Diskussion über die Einführung einer Erheblichkeitsgrenze (Bagatellgrenze) für außerordentliche Kündigungen entfachte sich in Form einer Gerechtigkeitsdebatte im Zusammenhang mit der Rechtspraxis im Strafrecht bei Bagatelldelikten und mit dem Umgang mit Managerfehlleistungen. Die neue Rechtsprechung im sog. “Emmely“- Fall hat den beinahe Absolutheitsanspruch des eine Abmahnung entbehrlich machenden Kündigungsgrundes bei Vermögensdelikten nunmehr aufgeweicht, wenn nicht sogar aufgelöst. Bei der Interessenabwägung ist nunmehr der beanstandungsfreien Betriebszugehörigkeit als vertrauensbildendem Element eine größere Bedeutung beizumessen. Pointiert ausgedrückt, hat sich der Grundsatz „Wer klaut, der fliegt!“ in den Grundsatz „Wer sein Vertrauen aufgebraucht hat, der fliegt!“ gewandelt.
Durch die „Emmely“- Rechtsprechung ergeben sich darüber hinaus offene Fragen, wie z.B. das Vertrauensverhältnis entsteht und zu bemessen ist und wie der Arbeitgeber im Streitfall nachweisen kann, im Zeitpunkt der Kündigung nur ein geringes oder kein verbliebenes Vertrauen zum betroffenen Ar-beitnehmer gehabt zu haben. Es ist mithin vonnöten, Kriterien für die Interessensabwägung nach § 626 Abs. 1 BGB zu entwickeln, die in entsprechenden Fällen eine sachgerechte und verhältnismäßige Reaktion des Arbeitgebers bestimmen sollten. Die nachfolgende Arbeit unternimmt den Versuch, in An-wendung des § 626 Abs. 1 BGB Antworten zu den aufgeworfenen Fragen zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Gender Erklärung
1. Einleitung
1.1 Gang der Untersuchung
1.2 Problemstellung
2. Die außerordentliche Kündigung von Arbeitnehmern
2.1 Allgemeines zum § 626 BGB
2.1.1 Das Arbeitsverhältnis
2.1.1.1 Personenbezogenes Dauerschuldverhältnis
2.1.1.2 Vertrauen im synallagmatischen Arbeitsverhältnis
2.2 Aufbau der Norm
2.2.1 Der „wichtige Grund“ - ein unbestimmter Rechtsbegriff
2.2.1.1 Absolute Kündigungsgründe
2.2.1.2 Vertragliche Vereinbarung absoluter Kündigungsgründe
2.2.2 Theorie des zweistufigen Prüfungsaufbaus
2.2.3 Theorie des dreistufigen Prüfungsaufbaus
2.3 Gründe der außerordentlichen Kündigung
2.3.1 Personenbedingte Kündigung
2.3.2 Verhaltensbedingte Kündigung
2.3.2.1 Verletzung von Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis
2.3.2.2 Verletzung von Nebenpflichten nach §§ 241 Abs. 2, 242 BGB
2.4 Kündigungsgründe und ihre Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis
2.4.1 Vertrauensbereich
2.4.2 Leistungsbereich
2.4.3 Betriebsbereich/Bereich der vertrieblichen Verbundenheit
2.4.4 Unternehmensbereich
2.5 Kategorisierung der außerordentlichen Kündigung
2.5.1 Tatkündigung
2.5.2 Verdachtskündigung
3. Die geringwertigen Vermögensdelikte als „wichtiger Grund“
3.1 Strafbare Handlungen gegen den Arbeitgeber
3.1.1 Vermögens- und Eigentumsdelikte
3.2 Geringwertige Vermögensdelikte - Bagatelldelikte
3.2.1 Begriff und Abgrenzung
3.2.2 Einführung einer Bagatellgrenze/Erheblichkeitsschwelle
3.2.3 Bewertung der Schadenshöhe
3.2.4 Gesetzesinitiativen zur Einführung einer Bagatellgrenze
3.3 Verstoß gegen konkretisierte Verbote/Weisungen
3.4 Tolerierte Pflichtverstöße - Folgen
4. Die Verhältnismäßigkeit der außerordentlichen Kündigung bei geringwertigen Vermögensdelikten
4.1 Geeignetheit der außerordentlichen Kündigung
4.2 Erforderlichkeit der außerordentlichen Kündigung
4.2.1 Milderes Mittel als die außerordentliche Kündigung
4.2.1.1 Ultima-ratio-Prinzip
4.2.1.2 Bei geringwertigen Vermögensdelikten
4.2.1.3 Abmahnung
4.2.1.4 Versetzung
4.2.1.5 Änderungskündigung
4.2.1.6 Suspendierung
4.2.1.7 Strafanzeige statt Abmahnung
4.2.1.8 Ordentliche Kündigung
4.3 Angemessenheit der außerordentlichen Kündigung
5. Die Interessenabwägung bei geringwertigen Vermögensdelikten
5.1 Grundsätze der Interessenabwägung
5.2 Bestimmung der schutzwürdigen Interessen
5.2.1 Vertragsbezogene Interessen
5.2.1.1 Dauer der Vertragsbeziehung/Betriebszugehörigkeit
5.2.1.2 Beanstandungsfreier Bestand des Arbeitsverhältnisses
5.2.1.3 Beharrlichkeit des pflichtwidrigen Verhaltens/Anzahl der Verstöße
5.2.1.4 Kernbereich der arbeitsvertraglichen Aufgaben
5.2.2 Betriebs- und unternehmensbezogene Interessen
5.2.2.1 Höhe des Schadens - Berücksichtigung von geringwertigen Vermögensdelikten
5.2.2.2 Generalprävention im Betrieb - Betriebsdisziplin
5.2.3 Personenbezogene Interessen
5.2.3.1 Das Lebensalter und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
5.2.3.2 Unterhaltspflichten und Familienstand des Arbeitnehmers
5.2.3.3 Pflicht zur Selbstbezichtigung
5.2.3.4 Sonstige personenbezogenen Interessen
5.2.4 Sonstige schutzwürdige Interessen
5.3 Abwägung der Interessen
5.3.1 Ranghöhe
5.3.2 Interessenhäufung
5.3.3 Interessenintensität
5.3.4 Verschulden
5.3.5 Folgenberücksichtigung
5.4 Mathematische Wertung
5.5 Ergebnis der Interessenabwägung
6. Die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung bei geringwertigen Vermögensdelikten
6.1 Vertrauen als zentraler Begriff
6.2 Aufbau von Vertrauen im Arbeitsverhältnis
6.2.1 Subjektiver Vertrauensbegriff
6.2.2 Objektiver Vertrauensbegriff
6.2.3 Ausdrückliches Anvertrauen bestimmte Aufgaben
6.3 Vertrauenskontinuität
6.3.1 Vertrauensvorrat/Vertrauenskapital
6.3.2 Vertrauensvorratsbestimmungsfunktion der Abmahnung
6.3.3 Abmahnungsentfernungsanspruch aus der Personalakte
6.4 Vertrauensdiskontinuität
6.4.1 Der Vertrauensverlust bei geringwertigen Vermögensdelikten
6.4.2 Motive für Kündigungen bei Bagatelldelikten
6.5 Wiederherstellung von Vertrauen
6.5.1 Prognoseprinzip
6.5.2 Unzumutbarkeit
7. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Rechtsprechungverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gender Erklärung
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Masterarbeit an vielen Stellen die männliche Form einer Personengruppe verwandt. Selbstverständlich sind hiermit auch die weiblichen Personen angesprochen.
1. Einleitung
Die sog. „Bienenstich“- Rechtsprechung aus dem Jahr 1984 2 hatte die Rechtslage bei Vermögensdelikten von Arbeitnehmern gegen ihren Arbeit- geber klar gestellt: „Wer klaut, der fliegt!“. Eine Abmahnung ist in diesen Fäl- len entbehrlich, da derartige Delikte das Vertrauen des Arbeitgebers in den Arbeitnehmer nachhaltig und unwiederbringlich erschüttern und somit einen „wichtigen Grund“ i.S.d. § 626 Abs. 1 BGB darstellen, der eine Weiterbe- schäftigung unzumutbar macht. Die Geringwertigkeit des Schadens und die Umstände der Tat sind in der Folge nicht nur im Rahmen der Rechtspre- chung thematisiert worden, sondern auch in der Literatur. Eine breite Diskus- sion über die Einführung einer Erheblichkeitsgrenze (Bagatellgrenze) für au- ßerordentliche Kündigungen entfachte sich in Form einer Gerechtigkeitsde- batte im Zusammenhang mit der Rechtspraxis im Strafrecht bei Bagatellde- likten und mit dem Umgang mit Managerfehlleistungen. Die neue Rechtspre- chung im sog. “Emmely“- Fall 3 hat den beinahe Absolutheitsanspruch des eine Abmahnung entbehrlich machenden Kündigungsgrundes bei Vermö- gensdelikten nunmehr aufgeweicht, wenn nicht sogar aufgelöst. Bei der Inte- ressenabwägung ist nunmehr der beanstandungsfreien Betriebszugehörig- keit als vertrauensbildendem Element eine größere Bedeutung beizumessen. Pointiert ausgedrückt, hat sich der Grundsatz „Wer klaut, der fliegt!“ in den Grundsatz „Wer sein Vertrauen aufgebraucht hat, der fliegt!“ gewandelt.
Durch die „Emmely“- Rechtsprechung ergeben sich darüber hinaus offene Fragen, wie z.B. das Vertrauensverhältnis entsteht und zu bemessen ist und wie der Arbeitgeber im Streitfall nachweisen kann, im Zeitpunkt der Kündi- gung nur ein geringes oder kein verbliebenes Vertrauen zum betroffenen Ar- beitnehmer gehabt zu haben. Es ist mithin vonnöten, Kriterien für die Interes- sensabwägung nach § 626 Abs. 1 BGB zu entwickeln, die in entsprechenden Fällen eine sachgerechte und verhältnismäßige Reaktion des Arbeitgebers bestimmen sollten. Die nachfolgende Arbeit unternimmt den Versuch, in An- wendung des § 626 Abs. 1 BGB Antworten zu den aufgeworfenen Fragen zu finden.
1.1 Gang der Untersuchung
Die Thesis beginnt entsprechend der Fragestellung des Titels mit einer Aus- einandersetzung mit dem seitens des BAG vorgegebenen Prüfungsaufbau des § 626 Abs. 2 BGB, insbesondere mit dem Begriff des „wichtigen Grun- des“. Es folgt eine Übersicht über die Systematik der Pflichtverletzungen und ihrer Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis. Auf die Problemstellung der Geringwertigkeit von Vermögensdelikten wird ebenso ausführlich wie auf die Einführung einer Erheblichkeitsschwelle eingegangen. Im weiteren Verlauf werden die Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers auf Vermögensdelikte untersucht und diese vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Verhältnis- mäßigkeit bewertet. Ausführlich wird die im Rahmen des § 626 Abs. 2 BGB geforderte Interessenabwägung systematisch dargelegt und sowohl Arbeit- geberinteressen, Arbeitnehmerinteressen und deren systematische Bewer- tung beleuchtet. Im Rahmen der Thematik der Unzumutbarkeit als Ergebnis der Interessenabwägung werden die Entstehung von Vertrauen sowie die Frage, wann das Vertrauenskapital des Arbeitnehmers aufgebraucht ist, dis- kutiert und die (möglichen) Auswirkungen der „Emmely“- Entscheidung auf die weitere Rechtssprechung dargelegt.
Die Arbeit beschränkt aus Abgrenzungsgründen ihre Untersuchung im We- sentlichen auf die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches und berück- sichtigt mithin nicht die kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften des Kündi- gungsschutzgesetzes. Ebenfalls wird auf die Thematiken der Anhörung und Fristsetzungen sowie der Beteiligungspflicht des Betriebsrates weitestgehend verzichtet.
Methodisch werden die Themengebiete anhand einschlägiger Fachliteratur, Beiträgen in Fachzeitschriften und Urteilen der Arbeitsgerichtsbarkeit sowie weiterer Gerichtsbarkeiten diskutiert.
1.2 Problemstellung
Die Thematik der außerordentlichen Kündigung bei geringwertigen Vermö- gensdelikten führt zu der Problemstellung, ob Bagatellfälle anders zu bewer- ten sind, als höhere Schäden und wie sich Taten des Arbeitnehmers gegen die Vermögensinteressen des Arbeitgebers im Allgemeinen auf das Arbeits- verhältnis auswirken. Ein Schwerpunkt dieser Problematik besteht in der Auswahl und Gewichtung der unterschiedlichen Aspekte im Rahmen der In- teressenabwägung, deren Ergebnis zu einer Weiterbeschäftigung oder fristlosen Kündigung führt. Eine wesentliche Schwierigkeit bereitet dabei die Frage, ob die Tat des Arbeitnehmers das Vertrauen des Arbeitgebers unwiederbringlich zerstört hat oder ob ein verbliebenes Restvertrauen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt.
2. Die außerordentliche Kündigung von Arbeitnehmern
Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses kann aufgrund verschiedener Tatbestände erfolgen. Der Gesetzgeber hat hier für Arbeitgeber und Arbeit- nehmer eine Vielzahl von Möglichkeiten geschaffen, um ein einseitig oder beidseitig nicht mehr gewolltes Arbeitsverhältnis zu beenden. Beispielhaft seien hier die Befristung, der Aufhebungsvertrag oder das Erreichen einer (vertraglich vereinbarten) Altersgrenze genannt. Die außerordentliche Kündi- gung als einseitige Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist ein Ausnahme- fall. Ihr müssen gewichtige Ereignisse vorausgehen, um das Dauerschuld- verhältnis eines Arbeitsvertrages ohne Kündigungsfrist zu beenden. Der au- ßerordentlichen Kündigung kommt keine Vergeltungsfunktion für vorange- gangene Vertragswidrigkeiten zu. Sie dient ausschließlich der Reaktion auf die Besorgnis, dass vergleichbare Pflichtverletzungen auch in Zukunft auftre- ten könnten. 4
2.1 Allgemeines zum § 626 BGB
In § 626 BGB kommt der im Wege der Rechtsfortbildung entwickelte und nunmehr durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz in § 314 BGB nor- mierte 5 allgemeine Rechtsgrundsatz zum Ausdruck, dass jedes Dauer- schuldverhältnis aus „wichtigem Grund“ ohne Einhaltung einer Kündigungs- frist gekündigt werden kann, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Vertrags- verhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu einem verein- barten Endtermin (Befristung) nicht zugemutet werden kann. 6
Mithin bietet § 626 BGB eine Art Notausstieg 7, durch den vermieden werden soll, dass eine der Arbeitsvertragsparteien auf Dauer an ein unzumutbar ge- wordenes Arbeitsverhältnis gebunden bleibt. 8 Die Voraussetzungen der au- ßerordentlichen Kündigung sind an Hürden geknüpft, deren Höhe sich an den Umständen des Einzelfalls und der beidseitigen Interessenabwägung orientieren. Eine schematische Prüfung unabhängig vom konkreten Einzelfall wird den Anforderungen des § 626 Abs. 1 BGB gerade nicht gerecht. 9
Eine wirksame außerordentliche Kündigung nach § 626 BGB hat mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Hier ist zunächst die Kündigungserklärung zu nennen, also eine empfangbedürftige einseitige Willenserklärung des Arbeit- gebers, die gegenüber dem Arbeitnehmer gem. § 130 Abs. 1 BGB mit ihrem Zugang wirksam wird. Inhalt dessen muss die unmissverständliche Aussage sein, dem Arbeitnehmer fristlos kündigen zu wollen. 10 Das Formerfordernis verlangt, dass die Kündigung schriftlich zu erfolgen hat. Die Angabe des Kündigungsgrundes ist für die außerordentliche Kündigung jedoch keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Dennoch muss der Kündigende den Grund für die ausgesprochene Kündigung gem. § 626 Abs. 2 S. 3 BGB auf Verlangen des Gekündigten unverzüglich schriftlich nennen, damit letzterer die Berech- tigung der außerordentlichen Kündigung prüfen kann. 11 Eine Verletzung die- ser Mitteilungspflicht führt jedoch allenfalls zu einer Schadensersatzforde- rung nach § 280 Abs. 1 BGB, nicht aber zu Unwirksamkeit der Kündigung. 12
Gem. § 626 Abs. 2 S. 1 BGB unterliegt die fristlose Kündigung einer zweiwö- chigen Kündigungserklärungsfrist. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Er- langung der positiven Kenntnis von den für die Kündigung maßgeblichen Tatsachen (§ 626 Abs. 2 S. 2 BGB), wobei das BAG die Frist erst mit der obligatorischen Anhörung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber begin- nen lässt. Für die Zeit bis zur Anhörung, die ihrerseits jedoch nicht länger als unbedingt nötig hinausgezögert werden darf, kann der Arbeitgeber entsprechende Ermittlungen anstellen. 13
Neben den formellen Anforderungen fordert § 626 Abs. 1 BGB materiell das Vorliegen eines „wichtigen Grundes“, der eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. Auf mögliche wichtige Gründe, die Frage der Zumutbarkeit und der ihr vorgeschalteten Interessenabwägung wird an späterer Stelle ausführlich eingegangen. Gesetzliche Kündigungsverbote wie z.B. § 9 Abs. 3 MuSchG dürfen nicht vorliegen.
2.1.1 Das Arbeitsverhältnis
Das Arbeitsverhältnis ist ein schuldrechtliches Austauschverhältnis, dessen Leistungsgegenstand eine zeitbestimmte Dienstleistung mit im Voraus nicht abgegrenzten Einzelleistungen ist. 14 Es handelt sich mithin um ein Dauer- schuldverhältnis, 15 das regelmäßig durch Abschluss eines Arbeitsvertrages entsteht, 16 der eine Unterform des Dienstvertrages gem. § 611 Abs. 1 BGB darstellt. Beim Arbeitsverhältnis handelt es sich mithin um einen Austausch- vertrag, dessen Hauptleistungspflichten im Synallagma stehen. 17
2.1.1.1 Personenbezogenes Dauerschuldverhältnis
Die Personenbezogenheit des Arbeitsverhältnisses manifestiert sich in § 613 BGB. Die Rechtsprechung sieht jedes Arbeitsverhältnis als personenbezo- genes Dauerschuldverhältnis. 18 Ihrer Rechtsnatur nach ist die Arbeitsleistung gemäß der gesetzlichen Konzeption eine höchstpersönliche Pflicht, die durch den Arbeitnehmer zu erbringen ist (§ 613 S. 1 BGB), auf der anderen Seite im Zweifel vom Arbeitgeber als Dienstleistungsanspruchsberechtigten nicht auf andere übertragen werden kann (§ 613 S. 2 BGB). Es handelt sich hier- bei aber nicht um zwingendes Recht. Die Leistungspflicht bzw. der Leis- tungsanspruch sind durch Individualabrede übertragbar. 19 Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer ohne eine entsprechende Vereinbarung nicht der Weisungsbefugnis eines anderen Arbeitgebers unterstellen. Insofern wirkt die Regelung in § 613 BGB arbeitnehmerschützend. 20
2.1.1.2 Vertrauen im synallagmatischen Arbeitsverhältnis
Der Begriff des synallagmatischen Arbeitsverhältnisses umschreibt die Ge- genseitigkeit dieser Vertragsbeziehung: Leistung und Gegenleistung („do ut des“). Die Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung soll sicherstel- len, dass keine Partei leisten muss, ohne dass sie eine Gegenleistung er- hält. 21 Da es sich um ein persönliches Vertragsverhältnis handelt, spielen neben dem Leistungsaustausch hinsichtlich der Hauptpflichten des Vertrages auch Nebenpflichten (§§ 241 II, 242 BGB) eine wesentliche Rolle, wenn es um die Erfüllung des Vertrages geht. Aufgrund der im Arbeitsrecht durch die besondere persönliche Bindung der Vertragspartner zueinander bestehen gegenseitige Pflichten zur Rücksichtnahme und zum Schutz und zur Förde- rung des jeweiligen Vertragszweckes. 22 Der Arbeitgeber erwartet und ver- traut darauf, dass der Arbeitnehmer keine Handlungen vornimmt, die dem Arbeitgeber und oder dem Betrieb abträglich sind. In der Erfüllung dieser Ne- benpflichten spiegelt sich der Vertrauensgedanke wieder. Im letzten Jahr- hundert wurde das Arbeitsverhältnis noch als personenrechtliches Gemein- schaftsverhältnis angesehen, das ein gewisses gegenseitiges Vertrauens- verhältnis (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers; Treuepflicht des Arbeitsneh- mers) voraussetzt. 23 Trotz dieser als überholt geltenden Betrachtungsweise des Arbeitsverhältnisses als rein personenrechtliches Gemeinschaftsverhält- nis beansprucht der darin zum Ausdruck kommende Grundgedanke, dass dem Vertrauensverhältnis in der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Ar- beitnehmer eine besondere Bedeutung zukommt, nach wie vor Geltung.
2.2 Aufbau der Norm
Durch den Gesetzgeber wurde mit § 626 Abs. 1 BGB eine Generalklausel geschaffen. Die Ausfüllung des darin enthaltenen unbestimmten Rechts- begriffs „wichtiger Grund“ obliegt den Gerichten 24, wodurch der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung getragen hat, dass die Vielzahl möglicher Umstän- de, die als „wichtiger Grund“ in Betracht kommen, nicht antizipiert werden kann.
2.2.1 Der „wichtige Grund“ - ein unbestimmter Rechtsbegriff
Ein unbestimmter Rechtsbegriff bedarf der Auslegung. Seine Anwendung durch die Tatsachengerichte kann im Rechtsmittelverfahren nur daraufhin überprüft werden, ob der Rechtsbegriff selbst verkannt, ob bei der Unterordnung des Sachverhalts unter den Begriff Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssätze verletzt und ob alle vernünftigerweise in Betracht kommenden Umstände, die für oder gegen die außerordentliche Kündigung sprechen, widerspruchsfrei beachtet wurden. 25
Um eine rechtssichere Auslegung dieses Begriffs zu gewährleisten, ist die Bildung von Fallgruppen erforderlich, die seitens der Rechtsprechung durch eine abgestufte Prüfung in zwei systematisch selbständigen Abschnitten des Begriffs „wichtiger Grund“ vorgenommen wird. 26 Dass ein vollständig klarer begrifflicher Rahmen bei der Auslegung des „wichtigen Grundes“ fehlt, führt dazu, dass bestimmte Verhaltensweisen von einzelnen Arbeitsgerichten un- terschiedlich beurteilt werden. Die Gerichte können unter anderen Gesichts- punkten werten und entsprechend normschöpfend tätig werden, 27 wodurch ohne Gesetzesänderungen ständig neue sozialethische Leitgedanken in das geltende Recht einfließen können 28, so dass die Auslegung der Norm dem Wandel unterworfen ist.
Die wichtigen Gründe sind im Allgemeinen, da es sich bei dem Arbeitsver- hältnis um einen Dienstvertrag handelt, schuldrechtliche Pflichtverletzungen, die für den außerordentlichen Kündigungsfall so gravierend sein müssen, dass die Weiterbeschäftigung unzumutbar ist, folglich eine Abmahnung des Arbeitnehmers nicht (mehr) ausreichend wäre, für die Zukunft des Arbeits- verhältnisses eine positive Prognose über eine beanstandungsfreie Beschäf- tigung treffen zu können. Die Frage der (Un-) Zumutbarkeit wird durch eine Abwägung der Interessen beider Vertragsteile beantwortet, der durch die sog. „Emmely“- Rechtsprechung 29 eine bedeutendere Rolle als vormals zu- kommt.
2.2.1.1 Absolute Kündigungsgründe
Entgegen der früheren Rechtslage sind exemplarisch aufgezählte absolute Kündigungsgründe, wie z.B. in § 123 Abs. 1 Nr. 8 GewO oder in § 72 Abs. 1 Nr. 3 HGB nach Änderung des § 626 BGB im Jahre 1969 entfallen. Nach herrschender Meinung und Rechtsprechung gibt es im Rahmen des § 626 Abs. 1 BGB keine absoluten Kündigungsgründe, so dass trotz abstrakter Eignung eines Sachverhaltes als genereller wichtiger Grund stets eine Ab- wägung aller für oder gegen die Auflösung des Arbeitsverhältnisses spre- chenden Umstände erfolgen muss. 30 Als Ausnahme für einen absoluten Kün- digungsgrund ist das in § 64 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 SeemG genannte Kün- digungsrecht zu sehen, dass nach Rechtsprechung und herrschender Mei- nung absolute Kündigungsgründe 31 beschreibt, die auf außerseemännische Arbeitsverhältnisse jedoch nicht übertragbar sind.
2.2.1.2 Vertragliche Vereinbarung absoluter Kündigungsgründe
Immer wieder gab und gibt es Versuche seitens eines Arbeitgebers, in den Arbeitsverträgen absolute Kündigungsgründe zu bezeichnen, durch deren Kenntnis der Arbeitnehmer sich nicht auf Unkenntnis berufen könne. Das BAG und die Literatur stehen auf dem Standpunkt, dass § 626 Abs. 1 BGB zwingenden Charakter habe und eine Vereinbarung sog. absoluter Kündi- gungsgründe daher unzulässig sei. 32 Insofern wird die Vertragsfreiheit durch eine Erweiterung des außerordentlichen Kündigungsrechts über den Geset- zeswortlaut hinaus seitens der Rechtsprechung eingeschränkt. 33 Dennoch ist es möglich, über die vertraglichen Regelungen die im Fall des § 626 BGB notwendige Interessenabwägung nachhaltig zu beeinflussen, und zwar durch Darlegung von inhaltlichen Punkten im Arbeitsvertrag, die für das jeweilige Arbeitsverhältnis eine besondere Bedeutung haben. 34 Diese können bei Streitigkeiten Aufschluss darüber geben, welche Umstände (die zur fristlosen Kündigung führen könnten) eine Partei für so essentiell hält, dass diese durch ausdrückliche Nennung eine besondere Bedeutung erfahren haben. 35
Andererseits steht das in § 626 Abs. 1 BGB eingeräumte Recht zur außerordentlichen Kündigung im Rahmen der Vertragsgestaltung nicht zur Disposition der Vertragsparteien. 36 Es kann weder durch allgemeine Geschäftsbedingungen noch durch Individualabreden abbedungen werden. 37
2.2.2 Theorie des zweistufigen Prüfungsaufbaus
Die Theorie des zweistufigen Prüfungsaufbaus (auch Zweistufenlehre ge- nannt 38 ) hat in der Rechtsprechung seine Begründung in dem sog. Bienen- stich-Urteil 39 gefunden und wird in der höchstrichterlichen Rechtsprechung nach wie vor für die Prüfung des § 626 Abs. 1 BGB verwendet. 40 Sie lehnt sich an den revisionsrechtlichen Prüfungsmaßstab an. 41 Der Entscheidung aus dem Jahre 1984 ging bereits im Jahre 1958 eine Grundsatzentscheidung voraus, die sich mit der Frage beschäftigte, wie der unbestimmte Rechtsbeg- riff des „wichtigen Grundes“ auszulegen sei und die Voraussetzungen für eine Prüfung des § 626 Abs. 1 BGB in mehreren Teilen geschaffen hat. 42 Im Einzelnen besagt die Theorie, dass das Vorliegen eines „wichtigen Grun- des“ gem. § 626 Abs. 1 BGB in zwei Stufen zu untersuchen ist. So ist zuerst zu prüfen, ob der Kündigungssachverhalt ohne die besonderen Umstände des Einzelfalls an sich geeignet ist, eine außerordentliche Kündigung (aus „wichtigem Grund“) zu rechtfertigen, also einen Kündigungsgrund zu bilden. Sofern die erste Frage bejaht wird, erfolgt auf der zweiten Stufe die Prüfung, ob bei Berücksichtigung aller individuellen Umstände und bei Abwägung der gegenseitigen Interessen eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt ist, weil eine Weiterbeschäftigung bzw. ordentliche Kündigung unzumutbar wä- re. 43 Hier wird deutlich, dass es sich bei dem Begriff der Unzumutbarkeit nicht um ein eigenständiges Tatbestandsmerkmal handelt, sondern um die zweite Stufe des Tatbestandmerkmales des „wichtigen Grundes“. 44
Das Vorliegen eines „an sich“ geeigneten Grundes kann ein erstes Kriterium bei der Suche nach dem Vorliegen eines wichtigen Grundes bilden. Der Beg- riff der „an sich“- Eignung findet sich nicht im Gesetz, sondern wurde durch die Rechtsprechung im Rahmen der Entstehung der Theorie des zweistufi- gen Prüfungsaufbaus entwickelt. Die Eigenschaft der „an sich“- Eignung liegt vor, wenn der Sachverhalt unter Außerachtlassung der besonderen Umstän- de des Einzelfalls geeignet ist, einen wichtigen Grund für die außerordentli- che Kündigung abzugeben. 45. Bei strafbaren Handlungen gegen den Arbeit- geber wird nach allgemeiner Ansicht „an sich“ ein Recht zur außerordentli- chen Kündigung begründet. 46
Ein zweites Kriterium bei der Suche nach dem Vorliegen eines wichtigen Grundes sind alle vernünftigerweise in Betracht kommenden Umstände des Einzelfalls. Hierbei ist zu beleuchten, ob die „an-sich-Eignung“ ausnahms- weise in dem konkreten Fall gleichwohl nicht zur Begründung eines wichtigen Grundes ausreicht. 47 Denkbarer Umstand des Einzelfalls könnte etwa die Schadenshöhe bei einem Vermögensdelikt gegen den Arbeitgeber sein. Dies wird in der Rechtsprechung jedoch ausdrücklich verneint. 48 Der Rechtspre- chung fehlt eine trennscharfe Abgrenzung der geeigneten Kündigungsgrün- de, so dass sich die Rechtmäßigkeit der außerordentlichen Kündigung re- gelmäßig erst auf der zweiten Stufe, in der eine umfassende Abwägung aller Umstände des Einzelfalls, entscheidet.
Die Zweistufentheorie ist in der Literatur umstritten. Aus dem Wortlaut des § 626 Abs. 1 BGB lässt sich die vom BAG entwickelte Prüfungsabfolge nicht ableiten. Vielmehr führt § 626 Abs. 1 BGB als Tatbestandsmerkmal den „wichtigen Grund“ auf, der auch die nähere Beschreibung desselben um- fasst. Insofern besteht zwischen dem Merkmal des „wichtigen Grundes“ und dessen normierter Umschreibung Identität. 49 Es wird kritisiert, der zweistufige Prüfungsaufbau sei der Versuch einer Scheinobjektivierung, die Fehlurteile begünstige. 50
Nach anderer Meinung 51 soll das Zweistufenprinzip unzureichend sein, da es nicht hinreichend mit dem System des Kündigungsschutzes verzahnt sei. Aus dem Stufenprinzip folge der Gedanke, dass eine außerordentliche Kün- digung schon dann unwirksam sei, wenn sie an den Rechtsschranken einer ordentlichen Kündigung scheitere. Daraus folgt, dass auch die zu § 1 KSchG entwickelten Rechtsschranken bei § 626 Abs. 1 BGB berücksichtigt werden müssten. Vielmehr führe die Formel vom „an sich geeigneten Kündigungs- grund“ zu keinem Ergebnis, da bislang keine „ungeeigneten“ Kündigungs- gründe festgestellt worden sind oder m.a.W.: „ Die erste Stufe fällt als Vorfilter praktisch aus “52. Belegt wird diese These anhand der bekannten Entschei- dungen des sog. „Kinderreisebett-Fall“ 53 und des sog. „Maultaschen-Fall“ 54, in denen selbst die gutgläubige Aneignung von für den Abfall bestimmten Gegenständen als ein „geeigneter Grund“ angesehen wird. Diese Kritik steht nicht alleine. 55 Selbst das BAG attestiert: „ Weiter widerspricht es der der Rechtssicherheit dienenden systematischen Zweitteilung des § 626 Abs. 1 BGB in den wichtigen Grund an sich und die nachfolgende Zumutbarkeits- prüfung unter Interessenabwägung, wenn rechtswidrigen oder vorsätzliche Verletzungen des Eigentums oder Vermögens des Arbeitgebers von vorn- herein die Eignung für eine au ß erordentliche Kündigung abgesprochen wird, weil die Schädigung ( … ) geringfügig ist. Um Geringfügigkeit zu bejahen, ist eine Wertung erforderlich, was dafür spricht, die Schadenshöhe der Zumut- barkeitsprüfung im Rahmen der Interessenabwägung zuzuordnen “. 56
Ferner wird die Auffassung vertreten, dass mit Rücksicht auf die Rechtsicherheit nicht jedes Fehlverhalten des Arbeitnehmers in die erste Stufe der zwei systematischen Stufen des BAG eingestellt werden dürfe. 57
Die Kritik erkennt zutreffend, dass der ersten Stufe der Prüfung im Ergebnis keine den Tatbestand begrenzende Funktion zukommt. Eine Theorie zu ent- wickeln, die von zwei Tatbeständen ausgeht, von denen der erste im Ergeb- nis stets als erfüllt angesehen wird - zumindest gibt es keinen vom BAG ent- schiedenen Fall, in denen das nicht der Fall war 58 - leistet keinen Beitrag zur Auslegung des Begriffs des wichtigen Grundes. Unabhängig von der Inhalts- leere der ersten Stufe ist die Zweistufentheorie nach wie vor die herrschende Auffassung. 59
2.2.3 Theorie des dreistufigen Prüfungsaufbaus
Die beschriebene Kritik an der Zweistufentheorie und dem seitens des BAG vorgenommenen Versuchs einer Systematisierung der Kündigungsgründe der ordentlichen Kündigung legt eine - wenngleich als solche noch unausge- sprochene - Theorie des dreistufigen Prüfungsaufbaus nahe. 60 Auf der ersten Stufe wäre der Grund zu prüfen, der eine Kündigung rechtfertigen könnte. Das BAG hat bereits durch eine Reihe von Entscheidungen im Rahmen des § 1 KSchG eine Dreiteilung der Kündigungsgründe 61 vorgenommen, wonach nach verhaltens-, personen- und betriebsbedingten Gründen zu unterschei- den ist. Innerhalb dieser Kategorien könnten Fallgruppen gebildet werden. Dies würde Wertungswidersprüche vermeiden. 62 Auf einer zweiten Stufe wä- re eine Prognose für die Zukunft vorzunehmen, inwieweit eine Wiederho- lungsgefahr vorliegt, da die außerordentliche Kündigung eine Reaktion auf eine vergangene (vertragliche) Leistungsstörung im Hinblick auf eine zukünf- tig zu erwartende Beeinträchtigung oder Gefährdung des Leistungszwecks ist. 63 Auf einer dritten Stufe wäre das Verhältnismäßigkeitsprinzip anzuwen- den, um alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen zu können, die Inte- ressen der Vertragspartner abzuwägen und letztlich die Geeignetheit, Erfor- derlichkeit und Angemessenheit einwandfrei darzulegen.
Diese Überlegungen schaffen zwar eine geringfügig andere Struktur der Prü- fung, bringen aber in die Prüfung des § 626 Abs. 1 BGB keine neuen Ele- mente ein. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es die Offenheit des Tatbe- standes „wichtiger Grund“ der Rechtsprechung ermöglicht - unabhängig von der Art der Stufenprüfung - eine einzelfallgerechte Prüfung vorzunehmen, die bei einer generell-abstrakten Wertung kaum vorstellbar wäre. 64
2.3 Gründe der außerordentlichen Kündigung
Eine Einteilung der Gründe ist sinnvoll, um die unterschiedlichen Kriterien differenziert betrachten zu können. Die Kündigungsgründe werden in der Literatur nach h.M. anhand einer an § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG angelehnten Dreiteilung kategorisiert. Demnach existieren personenbezogene, verhaltensbedingte und betriebsbedingte Kündigungsgründe, wobei auf letztere in dieser Arbeit nicht eingegangen wird.
2.3.1 Personenbedingte Kündigung
Personenbedingte Kündigungsgründe sind in der Person des Arbeitnehmers selbst begründet und brauchen seitens des Gekündigten nicht verschuldet worden zu sein. Entscheidend ist vielmehr, dass der Arbeitnehmer nicht (mehr) in der Lage ist, seine Arbeitsleistung vertragsgemäß zu erbringen, weil seine persönlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften dazu nicht (mehr) ausreichen 65, er insofern auch die Störung des Arbeitsverhältnisses nicht (mehr) steuern kann. Insofern sind die häufigsten Ursachen der personenbe- dingten Kündigung Erkrankungen, wobei Krankheiten als solche keinen Kün- digungsgrund darstellen - sie müssen sich störend auf das Arbeitsverhältnis auswirken. 66 Hier ist die ordentliche Kündigung regelmäßig i.S.d. Verhältnis- mäßigkeit geeignet, die Vertragsstörung zu überwinden, während die außer- ordentliche Kündigung in diesem Fall auch erforderlich sein muss, d.h. es darf kein milderes, gleich geeignetes Mittel wie die Abmahnung, die Umset- zung etc. in Betracht kommen. 67
2.3.2 Verhaltensbedingte Kündigung
Eine verhaltensbedingte Kündigung kommt in Fällen vertragswidrigen Verhal- tens des Arbeitnehmers in Betracht, wenn also Haupt- oder Nebenpflichten des Arbeitsverhältnisses verletzt werden und sich der Arbeitnehmer anders verhalten könnte. Die häufigsten derartigen Kündigungsgründe ergeben sich aus Verstößen gegen die Vertragspflichten wie z.B. bei Beschimpfungen, Tätlichkeiten, Betriebsdiebstählen, Arbeitsverweigerung oder ständiger Un- pünktlichkeit. 68 Ein wesentlicher Unterschied zu den personenbedingten Kündigungsgründen liegt mithin in der Steuerungsfähigkeit des Arbeitneh- mers durch sein Verhalten. 69 Insofern werden Vermögensdelikte gegen den Arbeitgeber, insoweit keine kleptomanische Erkrankung 70 des Arbeitnehmers vorliegt, regelmäßig zu einer verhaltensbedingten Kündigung führen. Die Steuerungsfähigkeit bedingt ein rechtswidriges und schuldhaftes Handeln, mithin eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung, damit das Verhalten als Leistungsstörung dem Arbeitnehmer vorwerfbar ist. 71 Ein bloßes Anhaften einer Eigenschaft an einer Person ist kein Verhalten. 72 Entscheidend für die Bewertung der Gründe ist auch die Vertragsbezogenheit, also dass ein die vertragliche zu erbringende Leistung störender Grund vorliegt. Das vertrag- lich nicht erfasste Privatleben des Arbeitnehmers ist grundsätzlich kündi- gungsrechtlich ohne Bedeutung. 73 Sofern nicht vertragswidrige, aber bedeut- same, Verhaltensweisen des Arbeitnehmers Zweifel an dessen Fähigkeit oder Eignung zur Erbringung seiner Dienstleitung ergeben, kommt nur eine personenbedingte Kündigung in Betracht. 74
Die ordentliche und die außerordentliche Kündigung unterscheiden sich in verhaltensbedingten Fällen nur nach dem Gewicht des Kündigungsgrundes, d.h. die Interessenbeeinträchtigung des Arbeitgebers muss im Fall einer außerordentlichen Kündigung so hoch sein, dass eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt erscheint. 75
2.3.2.1 Verletzung von Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis
Eine weitere mögliche Einteilung im Rahmen der Katalogisierung des „wichtigen Grundes“ besteht darin, zwischen der Verletzung vorvertraglicher Pflichten und Haupt- und Nebenpflichten zu unterscheiden.
Der „wichtige Grund“ in § 626 Abs. 1 BGB kann darüber hinaus durch eine Vielzahl von Fallgruppen erfüllt sein, die höchst unterschiedliche Pflichtver- letzungen des Arbeitnehmers beschreiben. Diese Bildung von Fallgruppen dient der Orientierung, ob der jeweilige Sachverhalt einem typischen „wichti- gen Grund“ i.S.d. § 626 Abs. 1 BGB zuzuordnen ist. Dennoch können diese Fallgruppen eine verständige Würdigung des Einzelfalls durch das Gericht nicht ersetzen. Sofern die Zuordnung des Einzelfalls zu einer Fallgruppe nicht gelingt, bedeutet dies nicht, dass dieser Sachverhalt nicht auch einen „wichtigen Grund“ darstellen könnte. Vielmehr ist in diesen Fällen zu unter- suchen, inwieweit der Sachverhalt einer Fallgruppe gleichzustellen ist oder als wichtiger Grund nicht in Frage kommt. 76
Nach umstrittener Meinung begründet das Arbeitsverhältnis eine Gattungs- schuld, so dass nach § 243 Abs. 1 BGB eine Leistung mittlerer Art und Güte geschuldet wird. 77 Hier wird deutlich, dass durchaus Fehler im tolerierbaren Bereich liegen, sofern sie nicht überhand nehmen oder klare Vertragsverlet- zungen darstellen. Die Hauptpflicht des Arbeitnehmers besteht darin, die ge- schuldete Arbeitsleistung am vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit zu erbringen. Verletzungen gegen diese Hauptleistungspflichten können in Form der Nichtleistung, des Verzugs oder der Schlechtleistung begangen werden. Beispiele für Verstöße durch Nichtleistung und Verzug können Arbeitverwei- gerung, Arbeitszeitbetrug, wilder Streik, Nichtleistung von Überstunden, un- entschuldigtes Fehlen, Unpünktlichkeit, unberechtigter Urlaubsantritt oder Urlaubsüberschreitung und Vortäuschung der Arbeitsunfähigkeit sein. 78 Auf Fälle der Schlechtleistung soll in dieser Masterarbeit nicht eingegangen wer- den.
2.3.2.2 Verletzung von Nebenpflichten nach §§ 241 Abs. 2, 242 BGB
Ein Arbeitsverhältnis begründet nicht nur Hauptleistungspflichten, sondern auch Nebenpflichten, welche in positive Verhaltenspflichten und Unterlas- sungspflichten unterteilt werden können. Werden die Nebenpflichten verletzt, so kann dies je nach ihrer Bedeutung und Qualität eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Strafbare Handlungen gegen das Vermögen des Arbeitgebers, die seitens des Arbeitnehmers bei oder im Zusammenhang mit seiner Arbeit begangen werden, verletzen grundsätzlich in schwerwiegender Weise die schuldrechtliche Pflicht des Arbeitnehmers zur Rücksichtnahme gem. § 241 Abs. 2 BGB und können auch bei nur geringerem Wert bzw. Schaden einen wichtigen Grund i.S.d. § 626 Abs. 1 BGB darstellen. 79 Neben diesen in Arbeitsverträgen regelmäßig nicht näher konkretisierten Neben- pflichten sind freilich auch Arbeitsverträge denkbar, in denen Nebenpflichten ausdrücklich aufgeführt werden. Hier ist eine Grenze dahingehend zu beach- ten, dass die private Lebensführung des Arbeitnehmers grundsätzlich der Sanktionierung des Arbeitgebers durch Kündigung oder Abmahnung entzo- gen sein muss. Es sind gleichwohl auch Fälle denkbar, in denen die private Lebensführung sehr wohl Einfluss auf das Arbeitsverhältnis haben kann. Man stelle sich an dieser Stelle einen spielsüchtigen, hoch verschuldeten Arbeit- nehmer vor, der über Bargeld des Arbeitgebers verfügt oder wesentliche Vermögensdispositionen treffen kann. Es kann nicht i.S.d. Arbeitgebers lie- gen, Arbeitnehmern in solchen persönlichen Zwangslagen weiterhin eine ent- sprechend vertrauensvolle Beschäftigung fortführen zu lassen. Hier wäre der Arbeitnehmer mindestens gehalten, dem Arbeitgeber wesentliche Ver- schlechterungen seiner Vermögenssituation oder die Spielsucht 80 anzuzei- gen, damit dieser entsprechend reagieren kann.
Es bleibt unabhängig von den vorstehenden Ausführungen zu den Haupt- und Nebenleistungspflichtverletzungen festzustellen, dass die Rechtspre- chung die gemeinhin üblichen Unterscheidungen aus dem allgemeinen Schuldrecht in Arbeitsgerichtsprozessen nur sehr zögerlich verwendet.
2.4 Kündigungsgründe und ihre Auswirkungen auf das Arbeitsver- hältnis
Neben den genannten Kündigungsgründen 81 differenziert das BAG in Anleh- nung an die Ausführungen von König nach verschiedenen Störbereichen: den Vertrauensbereich, den Leistungsbereich, den Betriebsbereich und den Unternehmensbereich. 82 Auf diese Weise werden die Auswirkungen der Kündigungsgründe auf die verschiedenen Bereiche systematisiert. Diese Systematisierung ist nicht unumstritten. 83 Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Differenzierung bzgl. der Notwendigkeit einer Abmahnung bei Ver- stößen im Vertrauensbereich bzw. im Leistungsbereich und der Nichtorientie- rung an den eigentlichen vertraglichen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. 84 Gleichwohl hält das BAG an den Begrifflichkeiten weiterhin fest. 85 Die Eintei- lung in verschiedene Bereiche führte in der Vergangenheit zu unterschiedli- chen Ergebnissen, wenn es beispielsweise um die Notwendigkeit von Ab- mahnungen geht. Das BAG ging im Allgemeinen davon aus, dass bei Kündi- gungen im Betriebsbereich und Vertrauensbereich keine Abmahnung erfor- derlich ist, da ein einmal gestörter Betriebsfriede oder ein einmal geschwun- denes Vertrauen nicht wiederhergestellt werden kann. 86 Diese Rechtsauffas- sung hat sich durch neuere Rechtsprechung des BAG zwischenzeitlich über- holt, da nicht stets und von vornherein ausgeschlossen ist, dass verloren ge- gangenes Vertrauen zurück gewonnen werden kann. 87
2.4.1 Vertrauensbereich
Der Vertrauensbereich betrifft nicht das „Vertrauen“ des Arbeitgebers in die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers oder in dessen Vermögen oder Willen zur korrekten Arbeitsausführung, sondern den Glauben an die Gutwilligkeit, Loyalität und Redlichkeit des Arbeitsnehmers - den Glauben daran, dass sich der Arbeitnehmer nicht unlauter gegen die Interessen des Arbeitgebers stellt, dass er sich nicht falsch, unaufrichtig oder hinterhältig gegen seinen Vertragspartner stellen wird. Damit ist in erster Linie die charakterliche Seite und nicht die Qualifikation des Arbeitnehmers angesprochen. 88 Der Vertrau- ensbereich erfasst folglich in erster Linie den Aspekt gegenseitiger Achtung der Vertragspartner. Zu den Störungen des Vertrauensbereichs zählen u.a. Unterschlagungen, Betrug, Diebstahl, Tätlichkeiten, grobe Beleidigungen, etc.
2.4.2 Leistungsbereich
Der Vertrauensbereich ist nach Auffassung der Rechtsprechung ein Abgren- zungsbegriff zum Leistungsbereich, der u.a. schlechte Arbeit, Nichtleistung oder Unpünktlichkeit umfasst. 89 Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer sei- ner Hauptleistungspflicht, also der Arbeitspflicht, nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. 90 In vertragsstörenden Fällen im Leistungsbereich wird seitens der Rechtsprechung stets vor der außerordentlichen Kündigung eine Ab- mahnung verlangt. 91
2.4.3 Betriebsbereich/Bereich der vertrieblichen Verbundenheit
Neben dem Vertrauens- und dem Leistungsbereich, die beide das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber betreffen, wird ein weiterer Störbe- reich im Betriebsbereich gesehen, der das Verhältnis der Arbeitnehmer un- tereinander und ihren Vorgesetzten beschreibt. Hier sind die Begriffe „Be- triebsordnung“ und „Betriebsfrieden“ zu nennen. 92 Beispiele sind in diesem Zusammenhang insbesondere Tätlichkeiten gegenüber anderen Beschäftig- ten, politische Agitationen oder Verletzungen des betrieblichen Rauch- bzw. Alkoholverbotes, die sich negativ auf das Betriebsklima auswirken können. 93
2.4.4 Unternehmensbereich
Eine Störung im Unternehmensbereich hat für die Praxis der außerordentli- chen Kündigung eher geringere oder gar keine Bedeutung, da außerbetrieb- liche Umstände gemeint sind wie die Zerstörung betrieblicher Einrichtungen durch äußere Einflüsse. 94 Diese Umstände gehören zum Betriebsrisiko des Unternehmers und rechtfertigen regelmäßig keine außerordentlichen Kündi- gungen. Unternehmensrelevant und damit für eine fristlose Kündigung aus- reichend kann der Verrat von Betriebsgeheimnissen sein, der jedoch auch ohne Weiteres dem Vertrauensbereich zugeordnet werden kann. 95
2.5 Kategorisierung der außerordentlichen Kündigung
In der Literatur haben sich mehrere Kategorien der außerordentlichen Kündigung herausgebildet. Zu nennen sind hier die außerordentliche Änderungskündigung, die (regelmäßige) Tatkündigung, die Verdachtskündigung, die Vertrauenskündigung und die Druckkündigung. Auf erstere und letztere soll hier nicht näher eingegangen werden. Eine weitere Differenzierung findet sich in der Unterscheidung nach möglichen Pflichtverstößen 96.
2.5.1 Tatkündigung
In § 626 Abs. 1 BGB wird der „wichtige Grund“ näher konkretisiert, indem die Bedingung „wenn Tatsachen vorliegen“ gestellt wird. Insofern müssen bei außerordentlichen Kündigungen, die auf einem „wichtigen Grund“ beruhen stets Tatsachen genannt werden können, aufgrund derer eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses geboten ist. Bei der Tatkündigung ist für den Kündi- gungsentschluss maßgebend, dass der Arbeitnehmer nach der Überzeugung des Arbeitgebers die strafbare Handlung bzw. Pflichtverletzung tatsächlich begangen hat und dem Arbeitgeber aus diesem Grund die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist. 97 Der Arbeitgeber muss diese Tat des Arbeitnehmers nachweisen können.
2.5.2 Verdachtskündigung
Der Verdacht einer strafbaren Handlung oder eines vertragswidrigen (pflicht- widrigen) Verhaltens des Arbeitnehmers stellt nach ständiger Rechtspre- chung des BAG gegenüber dem Tatvorwurf einen eigenständigen Kündi- gungsgrund dar 98 und ist insofern auf der ersten Stufe der Prüfung nach § 626 Abs. 1 BGB „an sich“ geeignet, eine außerordentliche Kündigung aus- zusprechen.
Voraussetzung für die Rechfertigung einer außerordentlichen Verdachtskün- digung ist, das objektive tatsächliche Anhaltspunkte einen dringenden Ver- dacht begründen, und es gerade die Verdachtsmomente sind, die das schutzwürdige Vertrauen des Arbeitgebers in die Rechtschaffenheit des Ar- beitnehmers zerstören und so die weitere Fortsetzung des Arbeitsverhältnis- ses unzumutbar machen. 99 Das vom BAG anerkannte Rechtsinstitut der Ver- dachtskündigung ist seit seiner Entwicklung umstritten. 100 Streitpunkt ist vor allem die Vereinbarkeit mit dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Recht- staatsprinzip und Art. 6 Abs. 2 EMRK, welche der Unschuldsvermutung zu Gunsten des Arbeitnehmers verfassungs- und völkerrechtlichen Rang verlei- hen. 101 Für das Institut der Verdachtskündigung spricht vor allem die mittelba- re Drittwirkung der Berufs- und Gewerbefreiheit, die ihre Grundlage in Art. 12 und 14 GG haben. Die moderne Arbeitswelt verlangt einen hohen Grad an Delegation der Aufgaben und Entscheidungen auf die Arbeitnehmer, was für eine erfolgreiche Arbeitsbeziehung ein hohes Maß an Vertrauen erfordert. Insofern kann schon der bloße Verdacht relevant werden, ein Vertrauensver- hältnis zu zerstören. 102 Die Unschuldsvermutung und das Rechtsstaatsprinzip erfassen die staatliche Gewalt im Verhältnis zum Bürger, nicht aber das Ver- hältnis der Privatrechtssubjekte untereinander, zumindest nicht unmittel- bar. 103 Des Weiteren wird im Kündigungsrecht die Unschuldsvermutung durch das Prognoseprinzip überlagert, da es sich bei der Kündigung nicht um eine Strafe handelt. 104
In der Verdachtskündigung wird gleichwohl eine unzulässige Rechtsfortbil- dung gesehen, weil das Gesetz vom Wortlaut her diese Möglichkeit nicht ein- räume. 105 Das Institut der Verdachtskündigung könne dazu verleiten, unlieb- same Arbeitnehmer auf mehr oder minder unkontrollierbaren Schleichwegen loszuwerden zu wollen. 106 Um entsprechende „Umweg-Kündigungen“ zu vermeiden, wurden vom BAG für die Verdachtskündigung Regeln entwickelt.
Der Arbeitgeber ist ohne vorherige Abmahnung zur Kündigung berechtigt, wenn sich der Verdacht als wahr herausstellen würde, mithin die Tatkündi- gung zulässig wäre. 107 Demgegenüber ist bei einer Verdachtskündigung be- reits der dringende Verdacht einer erheblichen Pflichtverletzung ausreichend, der auf objektiven bestimmbaren Tatsachen beruht. Zur Aufklärung muss der Arbeitgeber alles ihm Zumutbare unternehmen. 108 Im Zuge dieser Aufklä- rungspflicht des Arbeitgebers ist der Arbeitnehmer nach den Umständen des Einzelfalls regelmäßig anzuhören. 109 Bloße auf mehr oder weniger haltbare Vermutungen gestützte Verdächtigungen gegen den Arbeitnehmer reichen zur Rechtfertigung eines dringenden Tatverdachts nicht aus. 110 Auf der zweiten Stufe der Prüfung nach § 626 Abs. 1 BGB ist dann eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen, in der der Vorwurf durch den verständigen und gerecht abwägenden Arbeitgeber bewertet wird.
Bei der Verdachtskündigung, die an das zerstörte Vertrauen in die Integrität des Arbeitnehmers anknüpft, handelt es sich nach herrschender Meinung und jüngerer Rechtsprechung des BAG um eine personenbezogene Kündi- gung, 111 da das weggefallene Vertrauen zu einer Vertrauensunwürdigkeit desselben führt und somit mit der Person des Arbeitnehmers untrennbar ver- bunden ist.
3. Die geringwertigen Vermögensdelikte als „wichtiger Grund“
Im Schrifttum sind geringwertige Vermögensdelikte gegen den Arbeitgeber spätestens seit der sog. „Bienenstich“- Rechtsprechung aus dem Jahr 1984 112 immer wieder Anlass zu besonderen Auseinandersetzungen über deren Kündigungsrelevanz gewesen. Die jüngere sog. „Emmely“- Entschei- dung 113 hat diesen Streit aktualisiert. In der Auseinandersetzung spiegelt sich häufig ein vorweggenommenes entweder arbeitgeber- oder arbeitnehmer- freundliches Vorverständnis wider. 114 Es soll nachfolgend unter angemesse- ner Berücksichtigung beider Interessensphären der Versuch unternommen werden, für entsprechende Konflikte ein vertretbares Lösungsmodell zu ent- wickeln.
Geringwertige Vermögensdelikte sind bei der Katalogisierung nach den oben dargestellten Klassifizierungen den verhaltensbedingten Kündigungsgrün- den 115 zuzuordnen und innerhalb dieser Einteilung den Unterlassungspflich- ten. 116 Daraufhin ausgesprochene außerordentliche Kündigungen beruhen auf Tatbeständen im Vertrauensbereich 117. Inwieweit der Arbeitnehmer die Tat tatsächlich begangen hat und es daraufhin zu einer Tatkündigung 118 oder aufgrund verdächtiger Umstände zu einer Verdachtskündigung 119 kommt, sei an dieser Stelle dahin gestellt. Grundsätzlich rechtfertigen Straftaten, insbe- sondere Vermögensdelikte, gegen den Arbeitgeber regelmäßig eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung. 120 Es stellen sich in diesem Zusammenhang die Fragen, wann ein wichtiger Grund im Zusammenhang mit Vermögensde- likten gegen den Arbeitgeber vorliegt und ab wann man von geringwertigen Vermögensdelikten spricht, die eine außerordentliche Kündigung rechtferti- gen.
3.1 Strafbare Handlungen gegen den Arbeitgeber
Für die Entscheidung, ob ein strafbares Verhalten des Arbeitnehmers einen wichtigen Grund i.S.d. § 626 Abs. 1 BGB darstellen kann, ist zunächst einmal entscheidend, ob dieses Verhalten in irgendeinem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis steht. Ist dies nicht der Fall, besteht in der Regel kein ar- beitsrechtliches Problem. 121 Als wichtiger Grund kommt mithin eine strafbare Handlung in Frage, die mit der (gewollten oder ungewollten) Zielrichtung ge- gen das Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber begangen wurde.
Soweit eine Strafbarkeit im Sinne des StGB vorliegt, ist dies ein Indiz für eine gewisse Erheblichkeit, was wiederum eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür ergibt, dass ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB vorliegen könnte. Gleichwohl erscheint eine Strafrechtsakzessorietät, also die Abhän- gigkeit des Bestehens eines wichtigen Grundes von dem Vorliegen einer Straftat, als abwegig. 122 Eine Strafrechtsakzessorietät verneint das BAG in seiner maßgeblichen Entscheidung der „Emmely“- Rechtsprechung aus- drücklich. 123 Das Verhalten eines Arbeitnehmers soll auch dann als wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB in Betracht kommen, wenn es nicht strafbar ist. Weder die straf- noch die sachenrechtliche Beurteilung soll maß- geblich sein. Auch eine nicht strafbare, gleichwohl erhebliche Verletzung der sich aus dem Arbeitsverhältnis ergebenden Pflichten kann demnach ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB sein. Das soll insbesondere in Fällen gelten, in denen die Pflichtverletzung mit einem vorsätzlichen Ver- stoß gegen eine die unmittelbaren Vermögensinteressen des Arbeitgebers dienende Weisung des Arbeitgebers einhergeht. 124
Diese Grundsätze fügen sich in die frühere Rechtsprechung des BAG ein, das bei Kündigungen die arbeitsrechtliche und nicht die strafrechtliche Wertung entscheide. Ausschlaggebend ist, dass dem Arbeitgeber noch zumutbar sein muss, das Arbeitsverhältnis fortzuführen. 125 Es erweist sich insoweit, dass nicht nur die Beurteilung des Sachverhaltes durch die Strafjustiz das Arbeitsgericht nicht binden kann, sondern überdies der arbeitsvertragliche Maßstab ein zivil- und kein strafrechtlicher ist. 126
Eine Strafrechtsakzessorietät würde nicht nur dem zivilrechtlichen Charakter des Arbeitsverhältnisses nicht gerecht. Es würde vielmehr insbesondere ver- kannt, dass das Strafrecht etwa Eigentum und Vermögen nur lückenhaft schützt. Folgender Fall mag dies verdeutlichen: Ein Arbeitnehmer in einem Ingenieur- und Energieberatungsbüro nimmt jedes Wochenende ohne Wis- sen und gegen den erklärten Willen seines Arbeitgebers eine sehr teure und seltene Wärmebildkamera mit, um damit auf eigene Rechnung Energiebera- tungen durchzuführen. Das Verhalten ist als bloße Gebrauchsanmaßung nicht strafbar. 127
[...]
1 Eichler, Vorwort, S. VI.
2 BAG, Urt. v. 17.05.1984, 2 AZR 3/83, AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 14 („Bienenstich“- Rechtsprechung).
3 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 („Emmely“- Rechtsprechung). 1
4 Wetzling/Habel, BB 2011, 1077-1084 (1077).
5 Palandt/Grüneberg, § 314 Rn. 1.
6 ErfK/Müller-Glöge, § 626 BGB Rn. 1.
7 Bötticher für Molitor, S. 123 (124): Bötticher bezeichnet den vertraglichen Bestandsschutz als absolut und sieht in der außerordentlichen Kündigung ein Sicherheitsventil.
8 Bröhl, S. 70.
9 Boemke, JuS 2011, 175-177 (177).
10 Dütz/Thüsing, § 9 Rn. 457.
11 Dütz/Thüsing, § 9 Rn. 458.
12 Dütz/Thüsing, § 9 Rn. 458.
13 BAG, Urt. v. 02.03.2006, 2 AZR 46/05, AP SGB IX § 91 Nr. 6 (Bl. 1681).
14 MüArbR/Richardi, § 3 Rn. 22.
15 MüArbR/Richardi, § 3 Rn. 22.
16 Auf andere Begründungsfälle eines Arbeitsverhältnisses, wie die Frage der betrieblichen Eingliederung, wird hier nicht eingegangen.
17 ErfK/Preis, § 611 BGB Rn. 3.
18 BAG, Urt. v. 14.09.1994, 2 AZR 164/94, BAGE 78, 18-30 (II. 3. c)).
19 ErfK/Preis, § 613 BGB Rn. 3, 8.
20 ErfK/Preis, § 613 BGB Rn. 8.
21 Alpmann Brockhaus, S. 1141.
22 ErfK/Preis, § 611 BGB Rn. 708.
23 MüArbR/Richardi, § 3 Rn. 15ff.; Klueß, AuR 5, 2010, 4-7 (4); Weber, RdA 2011,108-119 (110); BAG, Urt. v. 14.09.1994, 2 AZR 164/94, NJW 1995, 1110 (1111).
24 ErfK/Müller-Glöge, § 626 BGB Rn. 14; ebs. MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 73.
25 Ständige Rechtsprechung, BAG, Urt. v. 27.11.2008, 2 AZR 193/07, NZA 2009, 671 (III.); bestätigt durch BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 (A. I.) - („Emmely“- Rechtsprechung).
26 ErfK/Müller-Glöge, § 626 BGB Rn. 15.
27 APS/Dörner, § 626 BGB Rn. 21; ebs.: KDZ/Däubler, § 626 Rn. 25f.
28 Ermann/Belling, § 626 Rn. 28.
29 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 („Emmely“- Rechtspre- chung).
30 KR/Fischmeyer, § 626 BGB, Rn. 81; BAG, Urt. v. 15.11.1984, 2 AZR 613/83, NJW 1986, 342-344: es gibt keine unbedingten (absoluten) Kündigungsgründe.
31 APS/Dörner, § 64 SeemG Rn. 3; BAG, Urt. v. 30.11.1978, 2 AZR 145/77, NJW 1980, 255- 256: Die außerordentliche Kündigung ist bei Vorliegen der Tatbestände nach § 64 SeemG stets berechtigt; eine Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, wie in § 626 Abs. 1 BGB vorgeschrieben, scheidet hier aus.
32 Preis, DB 1990, 630-634 (631) m.w.N.
33 RGKU/Stoffels, § 626 BGB Rn. 24; BAG, Urt. v. 22.11.1973, 2 AZR 580/72, AP BGB § 626 Nr.67 (Bl. 902): hier sah der Arbeitsvertrag vor, dass sich der Arbeitsgeber neben den gesetzlichen Kündigungsgründen für die fristlose Kündigung u.a. auch auf fehlende Geld- oder Warenbestände berufen kann. Diese Vereinbarung sah das BAG als unzulässig an.
34 RGKU/Stoffels, § 626 BGB Rn. 26; MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 59.
35 MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 59.
36 RGKU/Stoffels, § 626 BGB Rn. 18.
37 Palandt/Weidenkaff, § 626 Rn. 2.
38 Etwa bei HK-ArbR/Griebeling, § 626 Rn. 49.
39 BAG, Urt. v. 17.05.1984, 2 AZR 3/83, AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 14 (II. 1. b)) - („Bienenstich“- Rechtsprechung).
40 Zuletzt bestätigt durch BAG, Urt. v. 12.08.1999, 2 AZR 923/98 , BAGE 92, 184-203; darauf Bezug nehmend: BAG, Urt. v. 11.12.2003, 2 AZR 36/03, AP BGB § 626 Nr. 179.
41 KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 83.
42 BAG, 24.03.1958, 2 AZR 587/55, AP BGB § 626 Nr. 5 Verdacht strafbarer Handlung.
43 HK-ArbR/Griebeling, § 626 Rn. 49.
44 Wollschläger, S. 124 mit Verweis auf Ermann/Belling, § 626 Rn. 43.: Der Begriff der Unzumutbarkeit steht im Mittelpunkt der Definition des wichtigen Grundes.
45 Boemke, JuS 2011, 175-177 (175).
46 Weber, RdA 2011,108- 119 (109f); Das BAG bleibt in dieser Frage stets konsequent, an- ders aber z.B. LAG Hamm, Urt. v. 17.03.1977, 8 Sa 1348/76, DB 1977, 2002: „ Die Entwen- 10
47 BAG, 24.03.1958, 2 AZR 587/55, AP BGB § 626 Nr. 5 Verdacht strafbarer Handlung.
48 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 (A. II. 2. f)) - („Emmely“Rechtsprechung).
49 ErfK/Müller-Glöge, § 626 BGB Rn. 16.
50 Bengelsdorf, SAE 2011, 122-139 (128) m.w.N.
51 Preis, AuR 2010, 186-192 (188f.): Die Feststellung, dass es keine grds. Ungeeigneten Kündigungsgründe gibt, gilt in diesem Zusammenhang freilich nur für Vermögensdelikte - in anderen Fällen sind solche grds. ungeeigneten Gründe durchaus denkbar, vgl. KR/Fischmeier, § 626 BGB Rn. 91-93.
52 Stoffels, NJW 2011, 118-123 (120).
53 LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 10.02.2010, 13 Sa 59/09, LAGE BGB 2002 § 626 Nr. 27 - „Kinderreisebett“- Entscheidung.
54 ArbG Lörrach, Urt. v. 16.10.2009, 4 Ca 248/09, PflR 2010, 13-23 -„Maultaschen“.
55 Stoffels, NJW 2011, 118-123 (120): Die erste Prüfungsstufe fällt als Vorfilter praktisch aus; Kritisch auch: MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 76: Wenn wie im Bienenstichfall schon ein solch geringwertiger Verstoß nicht an sich ungeeignet ist, dann „ entscheidet sich die Rechtm äß igkeit der au ß erordentlichen Kündigung in allen problematischen Fällen erst auf der zweiten Stufe der umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. “.
56 BAG, Urt. v. 12.08.1999, 2 AZR 923/98, BAGE 92, 184-203 (II. 2. b) 1. bb)).
57 MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 77.
58 In Vorinstanzen sehr wohl, bspw.: LAG Hamburg, Urt. v. 08.07.1998, 4 Sa 38/97, LAGE BGB § 626 Nr. 10 Verdacht strafbarer Handlung; ArbG Reutlingen, 04.06.1996, 1 Ca 73/96, AiB 1996, 626; LAG Hamm, Urt. v. 17.03.1977, 8 Sa 1348/76, BB 1977, 849.
59 MüArbR/Wank § 98 Rn. 39 m.w.N.
60 SPV/Preis, § 22 Rn. 552.
61 SPV/Preis, § 22 Rn. 552.
62 Preis, AuR 2010, 186-192 (188); kritisch dazu Bengelsdorf, SAE 2011, 122-139 (128ff).
63 MüArbR/Wank § 98 Rn. 50.
64 HK-ArbR/Griebeling, § 626 Rn. 48.
65 ErfK/Oetker, § 1 KSchG Rn. 99.
66 ErfK/Oetker, § 1 KSchG Rn. 110.
67 MüArbR/Wank § 98 Rn. 53.
68 KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 138.
69 Berkowsky, § 6 Rn. 14.
70 Pathologischen Stehlen, Krankheit F 63.2, nach ICD-10, GM-Version 2012, <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2012/block-f60-f69.htm>, ab- gerufen am 07.12.2011, 14:11 Uhr: In diesem Fall würde es sich um eine Erkrankung und damit um einen Fall der personenbedingten Kündigung handeln.
71 BAG, Urt. v. 21.11.1996, 2 AZR 357/95, AP BGB § 626 Nr. 130 (II. 3. b).
72 ErfK/Oetker, § 1 KSchG Rn. 189.
73 ErfK/Oetker, § 1 KSchG Rn. 193.
74 Preis, DB 1990, 630-634 (632).
75 SPV/Preis, § 22 Rn. 565.
76 Schall/Strafrechtsprüfung, RdA 2010, 225-229 (228).
77 Berkowsky, § 6 Rn. 39.
78 SPV/Preis, § 22 Rn. 570ff.
79 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172, (A. II. 2. f)) - („Emmely“- Rechtsprechung): das BAG hat damit auch zum Ausdruck gebracht, dass Vermögensdelikte eine Nebenpflichtverletzung des Arbeitnehmers darstellen (Verstoß gegen § 241 Abs. 2 BGB).
80 Pathologisches Spielen, Krankheit F 63.2, nach ICD-10, GM-Version 2012, <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlgm2012/block-f60-f69.htm>, ab- gerufen am 09.12.2011, 16:39 Uhr.
81 S. Ziff. 2.3ff.
82 König, RdA 1969, 8-16 (13); Preis, DB 1990, 630-634 (634) m.w.N.
83 Preis, DB 1990, 630-634 (634) m.w.N; Schlachter, NZA 2005, 433-437 (435); ebs. KDZ/Däubler § 626 Rn. 41; BAG, Urt. v. 04.06.1997, 2 AZR 526/96, BAGE 86, 95-105 (II. 1. d)): „ zudem wird deutlich, dass die Differenzierung nach verschiedenen Störbereichen nur von eingeschränktem Wert ist. “
84 Oetker, SAE 1985, 175-178 (177) m.w.N.
85 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 (A. III. 3. c)) - („Emmely“- Rechtsprechung); das BAG hat die Differenzierung aber auch schon selbst kritisch gesehen: BAG, Urt. v. 04.06.1997, 2 AZR 526/96, BAGE 86, 95-105: die frühere Differenzierung nach verschiedenen Störbereichen war lediglich von eingeschränktem Wert.
86 Schaub, NZA 1997, 1185 (1186).
87 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 (A. III. 3. c) („Emmely“Rechtsprechung); BAG, Urt. v. 04.06.1997, 2 AZR 526/96, BAGE 86, 95-105.
88 LAG Köln, Urt. v. 10.06.1994, 13 Sa 228/94, LAGE BGB § 611 Nr. 37 Abmahnung.
89 LAG Köln, Urt. v. 10.06.1994, 13 Sa 228/94, LAGE BGB § 611 Nr. 37 Abmahnung.
90 KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 167.
91 BAG, Urt. v. 04.04.1974, 2 AZR 452/73, AP BGB § 626 Nr. 1 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat (V. 2.) - im Umkehrschluss.
92 KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 168 mit weiteren Erläuterungen.
93 MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 217.
94 KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 170.
95 KDZ/Däubler § 626 Rn. 40.
96 S. Ziff.3ff.
97 BAG, 18.11.1999, 2 AZR 743/98, BAGE 93, 1-11.
98 BAG, Urt. v. 23.06.2009, 2 AZR 474/07, AP BGB § 626 Nr. 47 Verdacht strafbarer Handlung (A. III. 2. b) aa)); bestätigt durch BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 (A. III. 1. c) aa)) - („Emmely“- Rechtsprechung).
99 BAG, Urt. v. 12.05.1955, 2 AZR 77/53, BAGE 2, 1; weiterentwickelt durch BAG, Urt. v.
04.06.1964, 2 AZR 310/63, BAGE 16, 72 ; zuletzt bestätigt durch BAG, 18.11.1999, 2 AZR 743/98, BAGE 93, 1-11; weiterentwickelt durch BAG, Urt. v. 29.11.2007, 2 AZR 724/06, AP BGB § 626 Nr. 40 Verdacht strafbarer Handlung.
100 Schon früh: Joachim, AuR 1964, 33-39 (39): „Werfen wir lieber das Scheusal der Verdachtskündigung in die Wolfsschlucht!“
101 Siehe zum Streitstand: KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 221.
102 Stöhr, JuS 2010, 1052-1056 (1053); a.M. Perreng, Einblick 2009, 7: hält ein Vertrauensverhältnis in großen Organisationseinheiten bei prekärer Beschäftigung und mangelnder Fürsorge des Arbeitsgebers für nicht selbstverständlich.
103 Anderer Meinung ist Ritter, NJW 2010, 1110-1114 (1114): der den wichtigen Grund in § 626 BGB nicht mehr (nur) auf die objektive Werteordnung des GG, sondern unter Bezug auf die objektive europäische Werteordnung ausgelegt wissen will.
104 BAG, Urt. v. 14.09.1994, 2 AZR 164/94, BAGE 78, 18-30 (II. 3. c)).
105 GE Fraktion Die Linke, BT-Drs. 17/649, S. 5; inhaltlich andere Auffassung BAG, Urt. v. 10.12.2009, 2 AZR 534/08, NZA 2010, 698.
106 Grunsky, ZfA 1977, 167-186 (169); ebs. Moritz, NJW 1978, 402-406 (403).
107 SPV/Preis, § 22 Rn. 703; Stöhr, JuS 2010, 1052-1056 (1053).
108 MünchKommBGB/Henssler, § 626 Rn. 245ff.
109 BAG, Urt. v. 13.03.2008, 2 AZR 961/06, AP BGB § 626 Nr. 43 Verdacht strafbarer Handlung (2. OS, B. I. 1. a)), bestätigt durch BAG, Urt. v. 23.06.2009, 2 AZR 474/07, AP BGB § 626 Nr. 47 Verdacht strafbarer Handlung.
110 BAG, Urt. v. 29.11.2007, 2 AZR 724/06, AP BGB § 626 Nr. 40 Verdacht strafbarer Hand- lung.
111 Junker, Rn. 412; ebs. und umfassend dazu m.W.N.: KR/Fischmeier, § 626 BGB, Rn. 211; BAG, Urt. v. 27.11.2008, 2 AZR 193/07, NZA 2009, 671 (B. IV. 4. a); a.M. Seeling/Zwickel, MDR 2008, 1020-1025 (1020) und Enderlein, RdA 2000, 325-330 (330): es wird auch in Zukunft ein negativ bewertetes Vertrauen bewertet bzw. ob eine vertrauensvolle Zusam- menarbeit in Zukunft noch möglich sein wird. Daher wird in der Verdachtskündigung eine verhaltensbedingte Kündigung gesehen.
112 BAG, Urt. v. 17.05.1984, 2 AZR 3/83, AP BGB § 626 Verdacht strafbarer Handlung Nr. 14 („Bienenstich“- Rechtsprechung).
113 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 („Emmely“- Rechtspre- chung).
114 Rieble für Adomeit, S. 619.
115 S. Ziff. 2.3.2.
116 S. Ziff. 2.3.2.2.
117 S. Ziff. 2.4.1.
118 S. Ziff. 2.5.1.
119 S. Ziff. 2.5.2.
120 Siehe Fn. 112 und Fn. 113.
121 KDZ/Däubler, § 626 Rn. 78f. m.w.N: bestimmte Straftaten außerhalb des Arbeitsverhältnisses können aber die Eignung (personenbedingter Grund) für das Arbeitsverhältnis vernichten, z.B. Ermordung von Frau und Kind, Kindesmissbrauch von Lehrern oder Erziehern etc.; ebs. SPV/Preis, § 22 Rn. 689.
122 Anderer Meinung: Schall, RdA 2010, 225-229 (225).
123 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 („Emmely“- Rechtspre- chung).
124 BAG, Urt. v. 10.06.2010, 2 AZR 541/09, NJW 2011, 167-172 (A. III. 2. e) - („Emmely“Rechtsprechung); KR/Fischmeyer, § 626 Rn. 459.
125 BAG, Urt. v. 22.12.1956, 3 AZR 91/56, NJW 1957, 478-479 (478).
126 BAG, Urt. v. 12.01.1956, 2 AZR 117/54, BAGE 2, 252 (255); bestätigt durch BAG, Urt. v. 12.08.1999, 2 AZR 923/98, BAGE 92, 184-203 (II. 2. b) cc)) - („ICE-Steward).
127 Gleichwohl dürfte es im Ergebnis schwerer wiegen als „Emmelys“ nach § 242 StGB straf-barer Diebstahl.
- Arbeit zitieren
- Guido Zech (Autor:in), 2012, Die außerordentliche Kündigung von Arbeitnehmern bei geringwertigen Vermögensdelikten gegen den Arbeitgeber, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/196320