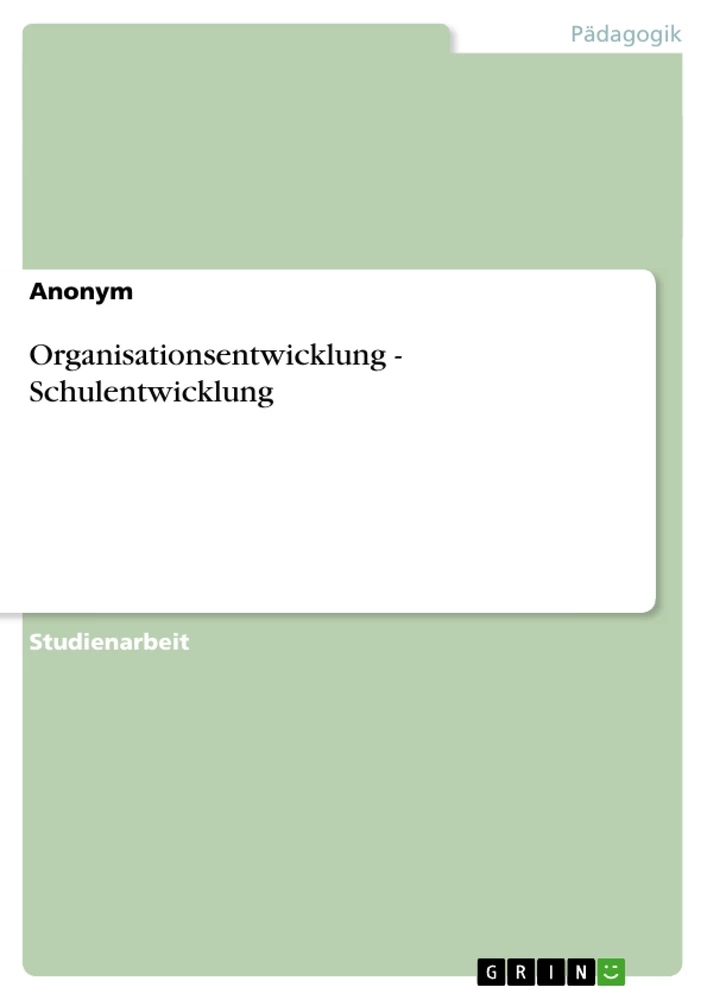Der deutsche Begriff kommt von dem amerikanischen „organization development“. Problematisch
bei dieser Bezeichnung ist der Begriff „Organisation“, denn darunter wird im deutschen
Sprachgebrauch Verschiedenes verstanden. Im engeren Sinn ist die Koordinierung eines
Systems gemeint. So „hat“ jedes Unternehmen eine Organisation, um reibungsloses Funktionieren
zu gewährleisten. Im weiteren Sinn „ist“ Organisation ein soziales System, zum Beispiel
ein Unternehmen, das auf dem Markt ein gewisses Eigenleben führt.
Im folgenden wird OE als sozio – technisches System im umfassenden Sinn verstanden. In
Annäherung an eine vorläufige Definition kann OE verstanden werden als ein
„Konzept zur Entwicklung von Organisationen [...] mit dem Ziel einer aktiven und flexiblen
Anpassung an die Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Umwelt. Es ist eine
Entwicklung im Sinne höherer Wirksamkeit der Organisation und größerer Arbeitszufriedenheit
der beteiligten Menschen.“1
1.1 Wie entstand OE ?
Die ersten Ansätze von OE liegen in den USA der 50er Jahre. OE entstand aus der externen
Position von Organisationsforschern, die unterschiedliche Phänomene wie Arbeitsplatzbedingungen
oder Humanisierung des Arbeitsplatzes untersuchten.
Ziel war unter anderem, die Mitglieder von Organisationen in die Lage zu versetzen, Probleme
selbst zu erkennen, zwischenmenschliche Beziehungen zu erproben und selbst Bedingungen
zu gestalten, die den eigenen Bedürfnissen und den Leistungserfordernissen der Organisation
angemessen sind. Mit Hilfe von Gruppendynamischem Training und Selbsterfahrungsgruppen
sollte dies erreicht werden. Das Verhalten der so Trainierten änderte sich zwar, war
aber nicht umzusetzen, da die Arbeitsbedingungen die alten blieben. In der weiteren Entwicklung
wurden also strukturelle und technologische Bedingungen in die „Therapie“ miteinbezogen.
Kennzeichnend war und ist die gemeinsame und schrittweise Erprobung des Entwicklungsprozesses.
Dick Beckhard prägte in den 50er Jahren den Ausdruck Organisationsentwicklung für diese
Tätigkeit. Durch Lewin kam die Gruppendynamik dazu, als Selbsterforschung von Gruppen.
1 In: Becker, H., Langosch, I.: Produktivität und Menschlichkeit. Qualitätsentwicklung und ihre Anwendung in
der Praxis. Stuttgart 2002. S. 3
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Organisationsentwicklung (OE) ?
- Wie entstand OE ?
- Definitionsversuche
- Warum OE ?
- Umweltveränderungen
- Bürokratische Organisationen
- Motivation und Kooperation
- Das Konzept der OE
- Ziele und Grundannahmen
- Kriterien und Prinzipien
- Vorgehensweise
- Methoden der OE
- Systemtechnik und Organisationslehre
- Gruppenpädagogik und Gruppendynamik
- Gesprächs- und Beratungstechniken
- Schulentwicklung
- Von der OE zur Schulentwicklung
- Der Institutionelle Schulentwicklungs – Prozess (ISP)
- Annahmen
- Phasen des ISP
- Einwände zum ISP
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese schriftliche Ausarbeitung des Referats zum Thema „Veränderungsprozesse in der Schule“ widmet sich der Organisationsentwicklung (OE) und ihrer Anwendung im Bildungsbereich. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der OE sowie die zentralen Ziele und Prinzipien dieses Konzepts. Der Fokus liegt dabei auf der Übertragung von OE-Methoden auf die schulische Praxis im Rahmen der Schulentwicklung.
- Die Entstehung und Entwicklung von OE
- Die Ziele und Prinzipien von OE
- Die Anwendung von OE-Methoden in der Schulentwicklung
- Der Institutionelle Schulentwicklungsprozess (ISP)
- Kritische Reflexionen und Einwände zur OE und Schulentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Was ist Organisationsentwicklung (OE)?
Dieses Kapitel erläutert den Begriff „Organisationsentwicklung“ und definiert ihn als ein Konzept zur Entwicklung von Organisationen, das auf eine aktive und flexible Anpassung an die Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Umwelt abzielt. Es geht um höhere Wirksamkeit der Organisation und größere Arbeitszufriedenheit der beteiligten Menschen.
1.1 Wie entstand OE?
Der Ursprung der OE liegt in den USA der 1950er Jahre und ist eng mit der Entwicklung der Organisationsforschung verknüpft. Die ersten Ansätze fokussierten auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Humanisierung des Arbeitsplatzes. Durch Gruppendynamisches Training und Selbsterfahrungsgruppen sollte eine höhere Selbständigkeit und Problemlösefähigkeit der Organisationsmitglieder erreicht werden.
1.2 Definitionsversuche
Das Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen der OE. Im Zentrum stehen dabei die Ziele der OE, die auf die Entwicklung von Organisationen in Hinblick auf die sich ständig wandelnden Anforderungen abzielen. Es wird betont, dass die Veränderungsbemühungen prozessual, langfristig geplant und unter aktiver Beteiligung der Organisationsmitglieder erfolgen müssen.
1.3 Warum OE?
Dieses Kapitel behandelt die Gründe, warum OE betrieben wird. Die mangelnde Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Zustand von Organisationen, der zunehmende Druck auf Unternehmen und der harte Kampf um Marktanteile sind einige der Gründe, die OE notwendig machen. Es werden drei zentrale Gründe für den Wandel genannt: Veränderungen der Umwelt, bürokratische Organisationen und Motivation/Kooperation.
1.3.1 Umweltveränderungen
Die fortschreitenden Veränderungen der Umwelt, wie z.B. der sich verändernde Markt, wissenschaftliche Erkenntnisse, technischer Fortschritt und neue Gesetze, erfordern Anpassungsfähigkeit von Organisationen.
1.3.2 Bürokratische Organisationen
Bürokratische Strukturen, wie z.B. eindeutige Machtverteilung, Arbeitsteilung und hierarchisches Denken, stellen oft Hindernisse beim Umgang mit Veränderungen dar.
1.3.3 Motivation und Kooperation
Der Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen auf individueller, menschlicher Ebene. Themen wie Desinteresse, Konkurrenzdenken und Existenzangst werden angesprochen.
2. Das Konzept der OE
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der OE, indem es die Ziele, Grundannahmen, Kriterien und Prinzipien dieses Ansatzes beleuchtet. Außerdem werden Methoden der OE vorgestellt, die auf Systemtechnik, Gruppenpädagogik, Gruppendynamik sowie Gesprächs- und Beratungstechniken basieren.
3. Schulentwicklung
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Übertragung von OE-Methoden auf die Schulentwicklung. Dabei wird der Übergang von der allgemeinen OE zur Schulentwicklung erläutert.
3.1 Von der OE zur Schulentwicklung
Dieser Abschnitt beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Chancen der Anwendung von OE-Methoden im Bildungsbereich.
3.2 Der Institutionelle Schulentwicklungs – Prozess (ISP)
Dieses Kapitel behandelt den Institutionellen Schulentwicklungs-Prozess (ISP) als ein strukturiertes Verfahren zur Weiterentwicklung von Schulen. Die Annahmen, Phasen und Einwände zum ISP werden genauer betrachtet.
Schlüsselwörter
Organisationsentwicklung, Schulentwicklung, OE, ISP, Veränderungsprozesse, Humanisierung, Motivation, Kooperation, Umweltveränderungen, Bürokratie, Arbeitszufriedenheit, Wirksamkeit, Gruppenpädagogik, Gruppendynamik, Systemtechnik, Gesprächs- und Beratungstechniken.
Häufig gestellte Fragen zur Organisations- und Schulentwicklung
Was ist Organisationsentwicklung (OE)?
OE ist ein Konzept zur Entwicklung von sozialen Systemen mit dem Ziel, diese aktiv und flexibel an eine sich wandelnde Umwelt anzupassen und gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit der Beteiligten zu erhöhen.
Wo liegen die Ursprünge der Organisationsentwicklung?
OE entstand in den USA der 1950er Jahre aus der Organisationsforschung und wurde stark durch Konzepte wie die Gruppendynamik von Kurt Lewin beeinflusst.
Warum ist OE für Schulen relevant?
Schulen stehen unter Druck durch Umweltveränderungen, neue pädagogische Erkenntnisse und bürokratische Hürden. OE hilft dabei, Veränderungsprozesse professionell zu gestalten.
Was ist der Institutionelle Schulentwicklungs-Prozess (ISP)?
Der ISP ist ein strukturiertes Verfahren zur Schulentwicklung, das verschiedene Phasen durchläuft, um die Qualität und Wirksamkeit der Schule als Institution zu steigern.
Welche Methoden werden in der OE eingesetzt?
Zum Einsatz kommen unter anderem Systemtechnik, Gruppenpädagogik, Gruppendynamik sowie spezifische Gesprächs- und Beratungstechniken.
Was sind Hindernisse in bürokratischen Organisationen?
Starre Machtverteilung, strikte Arbeitsteilung und hierarchisches Denken erschweren oft die notwendige Flexibilität beim Umgang mit Veränderungen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2003, Organisationsentwicklung - Schulentwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/19594