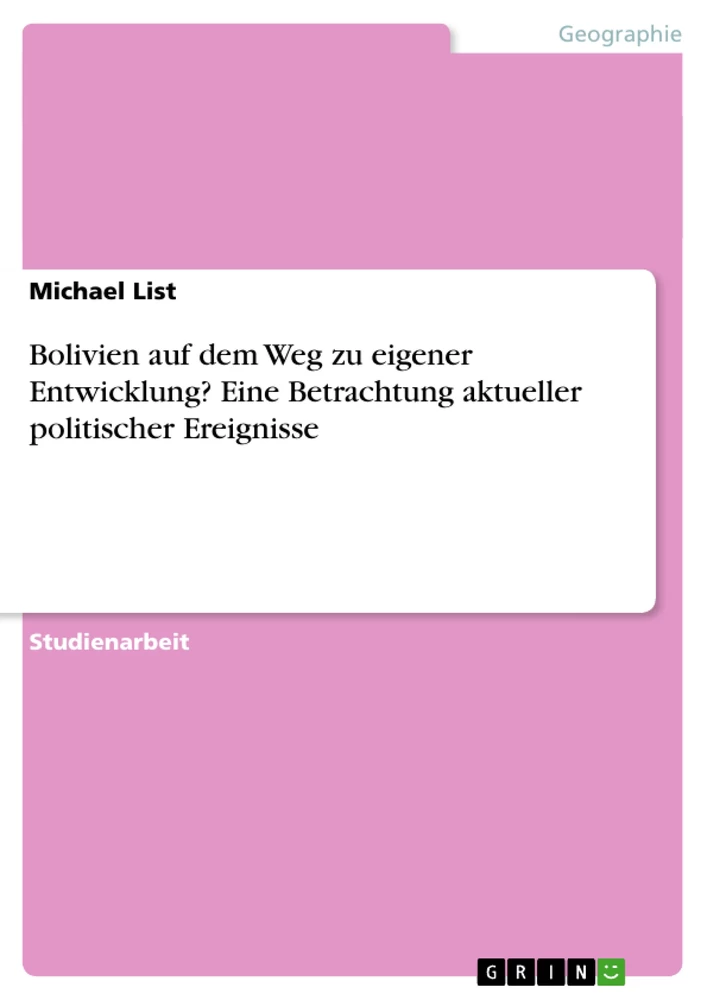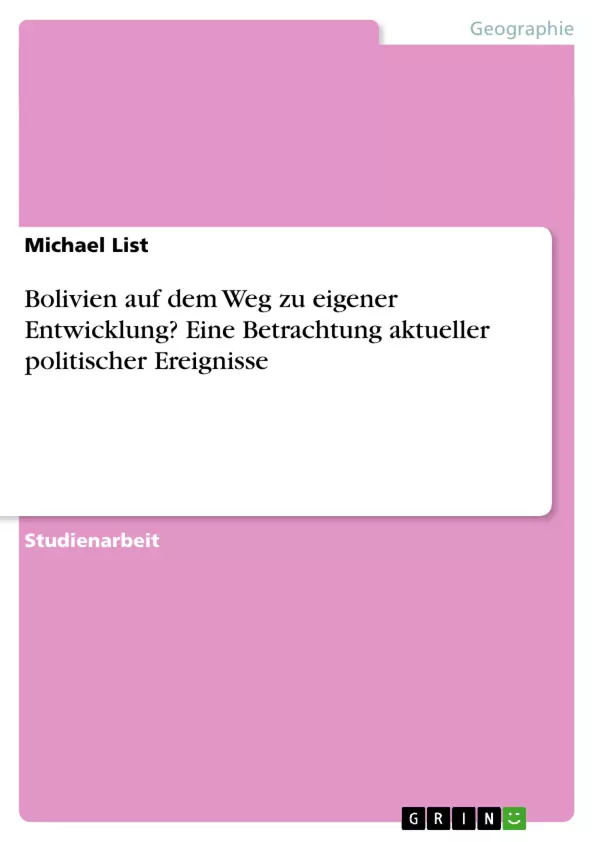Bolivien, ein Land auf dem Weg zu eigener Entwicklung. Mit diesem Titel ist diese Arbeit überschrieben. "Bei Betrachtung der wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren ist Bolivien ein armes Land, reich dagegen ist es an kultureller und landschaftlicher Vielfalt." (Schwarzbauer 2005:81) Viele Prozesse liefen in den Vergangenen Jahren in einem der ärmsten Ländern der Welt ab. Seit einigen Jahren, im speziellen seit der Wahl von Evo Morales als ersten indigenen Präsidenten, lässt sich eine „eigene Entwicklung“ im Sinne von indigener Bevölkerung aber auch eigener Wirtschaftlicher Entwicklung erkennen. Das Land hat wegen Evo Morales in den letzten Jahren internationale Aufmerksamkeit erhalten. Bisher erfolgten Berichte über die indigene Bevölkerung in Lateinamerika in der Regel nur, wenn es um Armut oder um Aufstände ging. (vgl. Ströbele-Gregor 2006:5) Insgesamt lohnt es sich Bolivien ge-nauer zu betrachten da innere und äußere Faktoren, politische, ökonomische und kulturelle Entwicklungen mit der Frage nach der Ausrichtung des Landes, den ethnischen Gruppen und der politischen Führung eng verbunden sind. (vgl. Jäger, Lessmann & Schorr 2009:9) Nach einem allgemeinen landeskundlichen Überblick folgt im Hauptteil der Arbeit die Analyse der aktuellen politischen Entwicklungen mit der angestrebten Neugründung des Landes durch Evo Morales und die daraus resultierenden soziokulturellen Auswirkungen auf das Land.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Landeskunde
2.1 Strukturdaten zu Bolivien
2.2 naturräumliche Gliederung
2.3 Klima
2.4 Städte
2.5 Departamentos
2.6 Bevölkerung und Ethnische Gruppen
2.7 Wirtschaft
2.7.1 Wirtschaftsentwicklung in Bolivien
2.7.2 Bedeutung und Geschichte des Media Luna
2.7.3 Erdöl-Erdgasproduktion
2.7.4 Landwirtschaft
2.7.5 Bergbau
3. Politische Strukturen in Bolivien als Grundlage für eigene Entwicklung?
3.1 Politische Entwicklung bis Morales
3.1.1 Entwicklungen ab der „Revolution“ von 1952
3.1.2 wichtige Präsidenten 1993
3.1.3 Stärkung der Opposition ab 2000
3.2 Evo Morales
3.3 Die Wahl Morales 2005
3.4 Aktuelle Politik und Entwicklungen ab 2006
3.5 Wahlen im Dezember 2009
4. Bolivien - auf dem Weg zu eigener Entwicklung?
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Human Development Index Boliviens im Vergleich
Abbildung 2: Schematische naturräumliche Gliederung Boliviens
Abbildung 3: Klimadiagramm La Paz, Altiplano
Abbildung 4: Klimadiagramm Riberalta, Amazonas Tiefland
Abbildung 5: Klimadiagramm Santa Cruz, Tiefland
Abbildung 6: Departamentos in Bolivien
Abbildung 7: Anteil der indigenen Bevölkerung nach Provinzen
Abbildung 8: Armutsquote in Bolivien
Abbildung 9: Dominanter Wirschaftssektor in den Provinzen
Abbildung 10: Zeittafel der wirtschaftlichen Entwicklung in Bolivien
Abbildung 11: reales BIP pro Kopf im Vergleich
Abbildung 12: Erdgasförderung nach Regionen
Abbildung 13: BIP pro Kopf nach Regionen
Abbildung 14: Verteilung landwirtschaftlicher Farmen nach Größe
Abbildung 15: Konflikthäufigkeit in Bolivien
Abbildung 16:Ergebnisse der Präsidentenwahl 2005
Abbildung 17: Zustimmung zum Verfassungsreferendung vom Januar 2009
Abbildung 18a/b: Umfrageergebnisse zur Präsidentenwahl Dezember 2009
Abbildung 19: Ergebnis der Wahlen vom 6.12.2009
Abbildung 20: Ergebnis der Wahlen vom 6.12.2009 verteilt auf die Regionen
1. Einleitung
Bolivien, ein Land auf dem Weg zu eigener Entwicklung. Mit diesem Titel ist diese Arbeit überschrieben. "Bei Betrachtung der wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren ist Bolivien ein armes Land, reich dagegen ist es an kultureller und landschaftlicher Vielfalt." (Schwarzbauer 2005:81) Viele Prozesse liefen in den Vergangenen Jahren in einem der ärmsten Ländern der Welt ab. Seit einigen Jahren, im speziellen seit der Wahl von Evo Morales als ersten in- digenen Präsidenten, lässt sich eine „eigene Entwicklung“ im Sinne von indigener Bevölkerung aber auch eigener Wirtschaftlicher Entwicklung erkennen. Das Land hat wegen Evo Morales in den letzten Jahren internationale Aufmerksamkeit erhalten. Bisher erfolgten Berichte über die indigene Bevölkerung in Lateinamerika in der Regel nur, wenn es um Armut oder um Aufstände ging. (vgl. Ströbele-Gregor 2006:5) Insgesamt lohnt es sich Bolivien genauer zu betrachten da innere und äußere Faktoren, politische, ökonomische und kulturelle Entwicklungen mit der Frage nach der Ausrichtung des Landes, den ethnischen Gruppen und der politischen Führung eng verbunden sind. (vgl. Jäger, Lessmann Schorr 2009:9) Nach einem allgemeinen landeskundlichen Überblick folgt im Hauptteil der Arbeit die Analyse der aktuellen politischen Entwicklungen mit der angestrebten Neugründung des Landes durch Evo Morales und die daraus resultierenden soziokulturellen Auswirkungen auf das Land.
2. Landeskunde
Dieser Abschnitt soll einen landeskundlichen Überblick über die Präsidialrepublik Bolivien geben. Neben allgemeinen Strukturdaten und einer naturräumlichen Gliederung wird auf die Punkte Bevölkerung und Wirtschaft und Landwirtschaft genauer eingegangen, da sie für die Struktur des Landes von großer Bedeutung sind.
2.1 Strukturdaten zu Bolivien
Bolivien ist eins der beiden Binnenländern des südamerikanischen Kontinents. Es liegt zwischen neun und 23 Grad südlicher Breite und damit vollständig im Bereich der Tropen. Der niedrigste Punkt des Landes befindet sich 90 m über dem Meer, der Höchste 6543 m. Bolivien hat eine Fläche von 1.098.581 km2. Die West-Ost Ausdehnung beträgt ca. 1300 km, die Nord-Süd Ausdehnung 1500 km. Nachbarländer sind Brasilien, Peru, Chile, Argentinien und Paraguay.
Hauptstadt des Staates ist Sucre, wobei der Regierungssitz in La Paz ist. Die Amtsprachen sind Spanisch, Ketschua und Aimara. 95 % der Bevölkerung sind Katholiken. Der Rest sind u.a. Protestanten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bolivien ist nach dem Human Development Index (HDI) der Uno von 2009 das schlecht entwickelteste Land in Südamerika. Bolivien hat einen HDI Index von 0,729 wobei zum Vergleich das Nachbarland Chile als am höchst entwickeltes Land einen HDI von 0,878 hat. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des HDI’s im Vergleich zu anderen Ländern. (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2008; Pachner Schmid 2004:59f.; United Nations Development Programme (www.undp.org))
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2 naturräumliche Gliederung
Nach Pachner Schmid (2004:59) lässt sich Bolivien in drei naturräumliche Einheiten gliedern: Hochland der Anden (mit dem Altiplano), die Gebirgstäler (Valles) und die Yungas an der Ostabddachung der östlichen Kordilliere sowie das Tiefland des Oriente. Caldas-Meyer (2009) gliedert in fünf Teile und fügt noch Amazonien im Norden und das Chaco im Süden hinzu. Abbildung 2 zeigt die Einteilung der Großregionen. Einige wichtige Charakteristika der Regionen lassen sich wie folgt aufführen:
Im Weste an der Grenze zu Chile befindet sich die West Kordilliere der Anden welche aus größtenteils erloschenen Vulkanen bestehen und meist über 4500 m liegen, also zur tierra nevada gehören. Daran schließt sich das Altiplano (Hochland, etwa 25 % der Landesfläche) an. Es ist ein abflussloses Becken, welches durch mehrere Hügelketten getrennt wird und durchschnittlich auf 3800 m zwischen den Kordil- nach Süden über die wechselfeuchten Savannen zu den Steppen und Trockenwäldern des Chaco.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3 Klima
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Insgesamt ist das Klima Boliviens von den Höhen über Normalnull und den Jahreszeitlichen Unterschiede geprägt. Die Besonderheit des Bolivianischen Klimas ist eine ausgeprägte Sommerregenzeit, der in den meisten Regionen eine Aride Winterzeit gegenübersteht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Winterzeit (Juli) steht Bolivien unter keinem besonderen Druckeinfluss. Die geringen Niederschläge, welche von Süden mit den Passatwinden über den Südamerikanischen Kontinent ziehen, regnen sich meist schon in Argentinien ab. Daraus ergeben sich geringe Niederschläge (unter 25mm im Süden, bis 50mm im Norden). Gerade in den Höhenlagen ergeben sich aufgrund der fehlenden Bewölkung hohe Temperaturamplituden.
In der Sommerzeit (Januar) liegt Bolivien im zentralen Einflussbereich der inntertropischen Konvergenzzone. Zudem verstärkt sich das Tiefdruckgebiet durch ein sich im Altiplano bildendes Hitzetiefe aufgrund der großen Abstrahlung der Hochebene. Durch die Passatwinde geraten große Niederschlagsmengen von Norden nach Bolivien. Am Anstieg an der Ostkodilliere regenen sich diese ab (vgl. bis zu 2000mm im Norden, 1000mm im Süden). Im Altiplano fallen fallen im Sommer meist nicht mehr als 200mm.
Oft fallen die Niederschläge in den Sommermonaten als Starkregenereignisse. Kommt es, wie im Januar 2010 zum Auftreten des sogenannten El-Nino Effekts, kommt es zu massiven Überschwemmungen und Erdrutschen. Nach einem Bericht der Quetzal Redaktion vom 30. Januar 2010 sind „vor allem die Departments La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni und Chuquisaca von Überschwemmungen und Erdrutschen infolge von schweren Regenfällen oder Hagelschauern betroffen. Die im Januar gemessenen Niederschläge sind die heftigsten der letzten 20 Jahre für diesen Monat. Laut der Tageszeitung La Razon sollen mehr als 26.000 Familien von den aktuellen Wirkungen des “Christkindes” im ganzen Land betroffen sein [...] Die Prognosen den nationalen Wetterdienstes sagen starke Regenfälle auch für die nächsten Tage und stellenweise bis in den Februar voraus. Schon jetzt sind Folgen für die Landwirtschaft abzusehen, da mindestens 23.000 Hektar kultivierter Fläche durch die Überschwemmungen betroffen sind“ (Quetzal Redaktion 2010) Die Klimadiagramme verdeutlichen die oben beschriebenen Unterschiede in den Landesteilen.
2.4 Städte
Bolivien besaß 2003 einen Verstätterungsgrad von 63% (vgl. Pachner Schmid 2004:62). Wichtige Städte sind die Hauptstadt Sucre im Bereich des Valles mit 215.778 Einw. (Stand 2001), die Metropole La Paz im Altiplano mit 793.293 Einw. (Stand 2001) als Regierungssitz, das Regionalzentrum Cochabamba am Übergang zur Tiefebene mit 517.024 Einw. (Stand 2001) sowie das Zentrum des Tieflandes und Bevölkerungsreichste Stadt Santa Cruz de la Sierra mit 1.135.526 Einwohnern (Stand 2001). (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2008).
2.5 Departamentos
Die Ausformung der Regionen Boliviens gewann bereits während der Kolonialzeit an Konturen. Die Begünstigung mancher Gebiete aufgrund der hohen Konzentration von Edelmetallen bzw. die Vernachlässigung anderer, nämlich rohstoffarmer Gebiete haben den entscheidenden Impuls für die Herausbildung der späteren Landesstruktur gegeben.
Wie schon bei den Großregionen lassen sich die Regionen Bolivien in drei große Bereiche (wirtschaftlich sowie soziokulturell) unterteilen. Abbildung 6 zeigt eine Übersicht der Depar- tamentos in Bolivien.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zum Altiplano gehören die Departamentos La Paz, Oruro und Potosí, welche während der Kolonialzeit das Land dominierten. Dort gab es wichtige Bodenschätze wie Silber und Zinn. Die Fokussierung auf diese Regionen blieb bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bestehen.
Zum Bereich der Valles gehören grob die Departamentos Cochabamba und Chuquisaca. Dieser Bereich ist durch starke landwirtschaftliche Nutzung geprägt und das Gebiet das von den Indigenas bewohnt wird (vgl. Abschnitt 2.6) Das Tiefland wird hauptsächlich durch Santa Cruz, Beni und Pando gebildet. Aufgrund der umfangreichen Erdgasvorkommen wird Tarija auch zum Halbmond (Media Luna) gezählt (vgl. unter ande-
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
rem Caldas-Meyer 2009 Weisbrot Sandoval 2009). Das Tiefland erhielt seinen Aufschwung nach der Revolution 1952, da dort eine Schwerpunktverlagerung der Wirtschaft auf die dortige Agrarproduktion und die Erdöl/gas Reserven viel (vgl. Abschnitt 2.7) Mit dem Aufstieg der Wirtschaft der Media Luna wuchs deren Wunsch nach Autonomie, welche bis heute die politischen Spannungen beeinflusst (vgl. Abschnitt 3) (vgl. Caldas-Meyer 2009)
2.6 Bevölkerung und Ethnische Gruppen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bolivien stellt im Vergleich zu anderen Lateinamerikanischen Ländern eine Besonderheit dar. Von den rund 10 Millionen Einwohnern sind ca. 62 Prozent indigenen Bevölkerungsgruppen zuzurechnen (vgl. Weisbrot Sandoval 2009) und ist damit im lateinamerikanischen Vergleich am höchsten. Es herrscht ein hohes Bewusstsein um die eigene Identität und der gewachsene Kultur der Menschen Boliviens (vgl. Pachner Schmid 2004:59-62) Die größten der dreißig indigenen Gruppen sind Aymara (Hochland um La Paz, Oruro, Potosí), Quechua (Cochabamba, Sucre), Guaraní und Chiquitano (Tiefland, Chaco) (vgl. Schwarzbauer 2005:81). Eine weitere Besonderheit stellt die Verteilung der indigenen Bevölkerung in den einzelnen Departamentos dar. Abbildung 7 zeigt diese Verteilung.
nialen Herrschaftsideologie. Sie sind keine präzise Kennzeichnung für bestimmte Kulturen, sondern charakterisieren vielmehr ein politische und soziales Konstrukt seitens der europäischen Eroberer. Der indigenen Landbevölkerung wurde der niedrigste Status zugewiesen. In den Meisten unabhängigen Ländern unterlag die Indio-Bevölkerung einem gesonderten rechtlichen Status, der sie auf allen gesellschaftlichen Ebenen benachteiligte (vgl. Ströbe- le-Gregor 2006:5f.). Diese Benachteiligung führt zu Armut und extreme Armut. Die Lebensumstände der Mehrheit der indigenen Völker Lateinamerikas, wie Studien, z.B. der Interamerikanischen Entwicklungsbank, belegen sind von Armut gekennzeichnet. Armut ist zudem nicht nur am Einkommen zu messen. Sie bedeutet auch mangelnde Schulbildung und Gesundheitsversorgung, weitgehend Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe an Entscheidungen über Ressourcenverteilung und -nutzung (vgl. Ströbele-Gregor 2006:7). In Bolivien leben nach den Zahlen von 2001 62 Prozent der Bevölkerung in gemäßigter Armut, 36 Prozent in extremer Armut (vgl. Schwarzbauer 2005:81) Nach den aktuellsten Zahlen von 2008 hat sich diese Situation sogar noch verschlechtert. So leben in Bolivien ca. 38 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut (nach Marmon 2005b von unter zwei Dollar pro Tag). Darunter versteht man, dass die Betroffenen keinen regelmäßigen Zugang zu grundlegenden, überlebensnotwendigen Gütern haben: Beispielsweise haben etwa 28 Prozent kein Trinkwasser und ca. 24 Prozent der Kinder unter 3 Jahren sind unterernährt. In ländlichen Gegenden ist die Armut noch viel stärker verbreitet, dort beträgt die Quote durchschnittlich 76,5 Prozent (vgl. Weisbrot Sandoval 2009).
Weisbrot Sandoval (2009) kritisieren:
"Dies ist eindeutig eine große demographische Lücke in einem Land mit einer indigenen Mehrheit, die jahrhundertelang diskriminiert wurde. Heute ist der Anteil der indigenen Bolivianer an den Armen, extrem Armen, Analphabeten und Unterernährten viel höher als der Anteil der nicht indigenen. Das Arbeitseinkommen der Nichtindigenen ist etwa 2,2 mal höher als das der Indigenen, und nicht indigene Bolivianer besuchen die Schule etwa 9,6 Jahre, während indigene nur 5,9 Jahre zur Schule gehen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch bei der Armut tritt wieder eine räumlich ungleiche Verteilung auf, welche auch auf die Verteilung der indigenen Bevölkerung zurück geht, jedoch auch auf den unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand (vgl. Abschnitt 2.7). Abbildung 8 verdeutlicht dies.
Quelle: Eigener Entwurf, Daten Weisbrot Sandoval 2009
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was wird in dieser Arbeit unter „eigener Entwicklung“ Boliviens verstanden?
Es bezeichnet die Bestrebungen Boliviens, insbesondere unter Evo Morales, eine eigenständige wirtschaftliche und soziokulturelle Entwicklung zu forcieren, die die indigene Bevölkerung einbezieht.
Wer ist Evo Morales und warum ist seine Wahl historisch?
Evo Morales wurde 2005 zum ersten indigenen Präsidenten Boliviens gewählt, was einen Wendepunkt für die politische Teilhabe der indigenen Mehrheit darstellte.
Welche Rolle spielt der „Media Luna“ für die Wirtschaft Boliviens?
Der Media Luna bezeichnet die rohstoffreichen Tieflandregionen im Osten, die für die Erdgas- und Erdölproduktion sowie die großflächige Landwirtschaft von zentraler Bedeutung sind.
Was sind die wichtigsten naturräumlichen Einheiten Boliviens?
Bolivien gliedert sich grob in das Hochland der Anden (Altiplano), die Gebirgstäler (Valles) und das tropische Tiefland (Oriente).
Wie wird der Entwicklungsstand Boliviens im Vergleich bewertet?
Gemessen am Human Development Index (HDI) galt Bolivien lange als eines der am wenigsten entwickelten Länder Südamerikas, trotz seines Reichtums an Kultur und Landschaften.
Was war das Ziel der Neugründung des Landes unter Morales?
Ziel war eine neue Verfassung und eine staatliche Struktur, die die ethnische Vielfalt anerkennt und die natürlichen Ressourcen zum Wohle der gesamten Bevölkerung nationalisiert.
- Quote paper
- Diplom Geograph univ. Michael List (Author), 2010, Bolivien auf dem Weg zu eigener Entwicklung? Eine Betrachtung aktueller politischer Ereignisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/194833