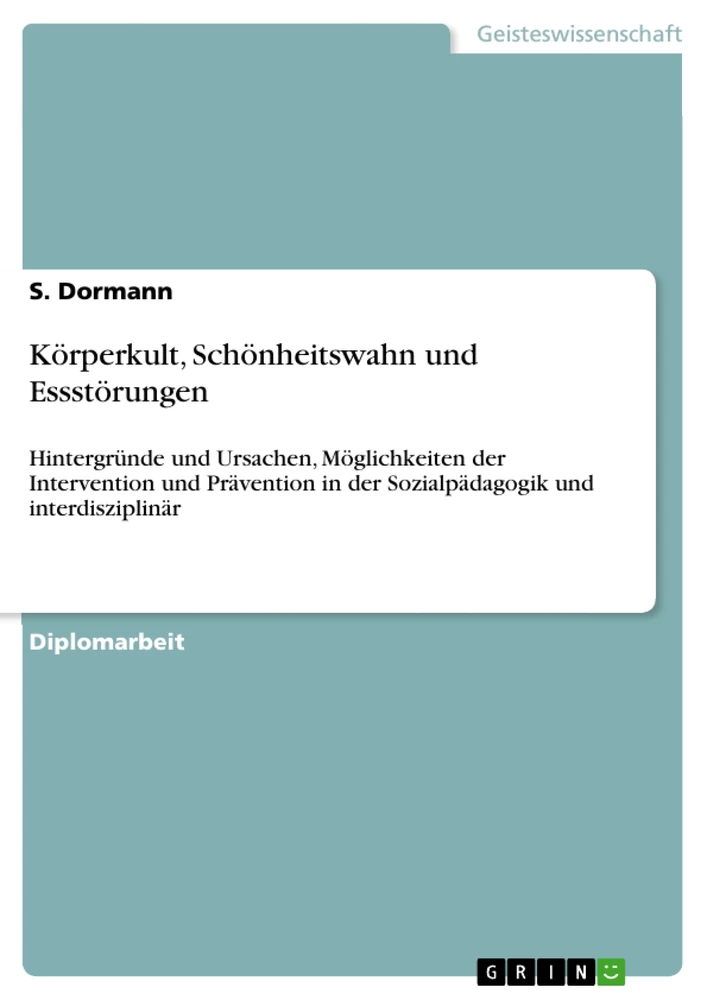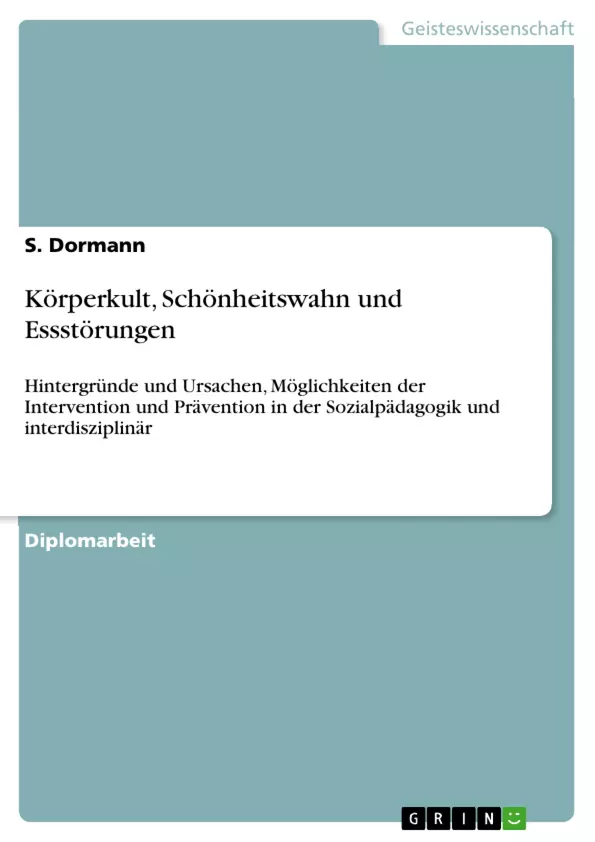Die amerikanischen Psychologen Feingold und Mazzella wiesen anhand von 222 Einzelstudien nach, dass sich die Körper-Unzufriedenheit bei Frauen innerhalb von 50 Jahren nach Kriegsende dramatisch gesteigert hat. Auch Ess-Störungen nahmen rapide zu. Kaum eine Kultur ist so stark körperfixiert wie die westliche. Der Körper soll Selbstzufriedenheit ermöglichen, Sympathie und Liebe erwirken, er soll zu Erfolg und Ansehen verhelfen und als Lustobjekt taugen. Dabei soll er fit und gesund sein, aber in erster Linie schön. Dies betrifft insbesondere Frauen, jedoch zeigt sich zunehmend auch bei Männern eine steigende Unzufriedenheit mit ihrem Körper. Ein Psychiater-Team an der Harvard Medical-School untersuchte die zunehmende Körper-Verzweiflung der Männer in den USA und in Europa und stieß immer wieder auf das auch bei Männern weit verbreitete Eingeständnis: „Ich hasse meinen Körper”. Was bei Frauen schon lange nachgewiesen ist, nämlich dass ihre Körperunzufriedenheit in den letzten Jahrzehnten anstieg, wird jetzt auch bei Männern festgestellt. 1972 waren nach einer amerikanischen Studie nur 15 % der männlichen Probanden mit ihrer Gesamterscheinung unzufrieden. 1997 dagegen hatte sich dieser Anteil schon verdreifacht. Bei den weiblichen Probanden war ein Anstieg von 25 % im Jahr 1972 auf 56 % im Jahr 1997 festzustellen. Außerdem zeigte die Studie auch, dass 40 % der befragten Männer mindestens die Hälfte ihrer Freizeit damit zubrachten, ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten, 58 % hatten bereits eine Diät hinter sich und 4 % brachten sich zum Erbrechen, um nicht zuzunehmen. Das Auftreten von Körperverachtung und -ablehnung und das Phänomen der Körperschemastörung, bei gleichzeitiger exzessiver Beschäftigung mit dem Körper, ist in dieser Form historisch einmalig. Nicht-westliche Kulturen kennen sie nicht in dieser Weise und in Entwicklungsländern ist Magersucht rar, bei schwarzen Amerikanerinnen selten, und auch in der ehemaligen DDR kam sie kaum vor. Dies legt nahe, dass diese Störungen mit den sozialen Lebensformen zusammenhängen. Während in nicht-westlichen Gesellschaften die Beschaffenheit des Körpers kaum ein Thema ist, stehen die Menschen in den Industrienationen unter dem Diktat, schlank sein zu müssen. Will man zu einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft gehören, setzt das nicht selten intensive Arbeit am Körper voraus. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Schönheitsideale
- 1.1 Erklärungsansätze für Schönheit
- 1.1.1 Der philosophische Bezugspunkt
- 1.1.2 Ist Schönheit messbar?
- 1.1.3 Welchen Sinn hat Schönheit?
- 1.2 Schönheitsideale des Körpers im Wandel der Zeit
- 1.3 Resümee
- 1.1 Erklärungsansätze für Schönheit
- 2. Körperkult und Schönheitswahn
- 2.1 Körpermanipulationen und Körpermodifikationen
- 2.2 Körpermanipulation und -modifikation am Beispiel der kosmetischen Chirurgie
- 2.3 Der Körper als Ware
- 2.4 Körperkult und Schönheitswahn als Ablehnung der Natur
- 2.5 Körperideal und Medienideal
- 3. Essstörungen: Symptomatik, Epidemiologie und Diagnostik
- 3.1 Anorexia nervosa
- 3.2 Bulimia nervosa
- 3.3 Adipositas
- 3.4 Binge-Eating-Störung
- 3.5 Körperschemastörung
- 4. Erklärungsansätze für Essstörungen
- 4.1 Biologisch-genetische Ansätze
- 4.2 Psychoanalytisch-objektbeziehungspsychologische und sozialpsychologische Ansätze
- 4.3 Psychoanalytisch-triebtheoretische Ansätze
- 4.4 Familiendynamische Ansätze
- 4.5 Neo-behavioristische Ansätze
- 4.6 Soziokulturelle Ansätze
- 4.6.1 Feministische Ansätze
- 4.6.2 Kulturtheoretische Ansätze
- 4.6.3 Medien und Essstörungen
- 4.7 Identitätstheoretische Ansätze
- 4.8 Resilienz und protektive Faktoren
- 5. Essstörungen behandeln
- 5.1 Stand der Therapieforschung
- 5.2 Verhaltenstherapien
- 5.3 Gesprächspsychotherapien und Psychoanalyse
- 5.4 Familientherapien
- 5.5 Gestalt- und Körperpsychotherapien
- 5.6 Feministische Therapie
- 5.7 Beratung und Selbsthilfe
- 5.8 Inhalt und Ziele der interdisziplinären Essstörungstherapie
- 5.8.1 Motivationsarbeit
- 5.8.2 Anamnese
- 5.8.3 ANAD Intensivtherapeutische Wohngruppen
- 5.9 Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung bei Essstörungen
- 5.10 Beispiel für ein sozialpädagogisches Behandlungsmodell
- 5.11 Prävention von Essstörungen
- 5.11.1 PriMA - Primärprävention Magersucht bei Mädchen ab der 6. Klasse
- 5.11.2 TOPP – Teenager ohne pfundige Probleme
- 5.11.3 Torera – Gemeinsam gegen den Stier
- 5.11.4 Evaluation von PriMa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen soziokulturellen Faktoren und Essstörungen. Ziel ist es, die Entwicklung und Verbreitung von Essstörungen im Kontext gesellschaftlicher Schönheitsideale und des Körperkults zu beleuchten. Die Arbeit analysiert verschiedene Behandlungs- und Präventionsansätze, mit besonderem Fokus auf sozialpädagogische Interventionen.
- Der Wandel von Schönheitsidealen im Laufe der Zeit
- Der Einfluss der Medien auf das Körperbild und die Entstehung von Essstörungen
- Die verschiedenen Arten von Essstörungen und ihre Symptomatik
- Therapiemöglichkeiten und Behandlungsansätze bei Essstörungen
- Präventionsstrategien im Umgang mit Essstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den dramatischen Anstieg von Körperunzufriedenheit und Essstörungen in der westlichen Gesellschaft, insbesondere bei Frauen, aber zunehmend auch bei Männern. Sie verweist auf Studien, die den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Druck, dem Ideal des schlanken Körpers und dem Auftreten von Essstörungen belegen und leitet zum Thema der Arbeit über.
1. Schönheitsideale: Dieses Kapitel untersucht den Begriff „Schönheit“ und hinterfragt dessen Messbarkeit und kulturelle Bedingtheit. Es analysiert verschiedene Erklärungsansätze für Schönheit und Attraktivität und beleuchtet den Wandel von Schönheitsidealen über die Jahrhunderte. Der Fokus liegt auf der Relativität und der kulturellen Abhängigkeit von Schönheitsvorstellungen.
2. Körperkult und Schönheitswahn: Das Kapitel beleuchtet die vielfältigen Praktiken der Körpermanipulation und -modifikation in der modernen Gesellschaft, insbesondere am Beispiel der kosmetischen Chirurgie. Es analysiert den Körperkult als Ausdruck gesellschaftlicher Normen und den Einfluss von Medien auf das Körperbild. Der Körper wird als Ware betrachtet und die Ablehnung der natürlichen Körperlichkeit wird als wichtiges Merkmal des Schönheitswahns herausgestellt.
3. Essstörungen: Symptomatik, Epidemiologie und Diagnostik: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Störung, Körperschemastörung), ihre Symptomatik, Epidemiologie und Diagnostik. Es liefert eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Krankheitsbilder und ihre charakteristischen Merkmale.
4. Erklärungsansätze für Essstörungen: Dieses Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Erklärungsansätzen für Essstörungen. Es werden biologisch-genetische, psychoanalytische, sozialpsychologische, familiendynamische, neo-behavioristische und soziokulturelle Ansätze beleuchtet, die einen vielschichtigen Blick auf die Entstehung von Essstörungen ermöglichen und die komplexen Ursachen verdeutlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Interaktion verschiedener Faktoren.
5. Essstörungen behandeln: Das Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über verschiedene Therapieansätze bei Essstörungen, darunter Verhaltenstherapien, Gesprächspsychotherapien, Familientherapien, Gestalt- und Körperpsychotherapien sowie feministische Therapieansätze. Besondere Aufmerksamkeit erhält die interdisziplinäre Essstörungstherapie, inklusive sozialpädagogischer Begleitung und Präventionsprogramme wie PriMA, TOPP und Torera.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Körperbild, Schönheitsideale, Körperkult, Medien, Soziokultur, Prävention, Therapie, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Störung, Körperschemastörung, Sozialpädagogik, Primärprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Zusammenhang zwischen soziokulturellen Faktoren und Essstörungen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen soziokulturellen Faktoren und Essstörungen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Verbreitung von Essstörungen im Kontext gesellschaftlicher Schönheitsideale und des Körperkults. Die Arbeit analysiert verschiedene Behandlungs- und Präventionsansätze, insbesondere sozialpädagogische Interventionen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel von Schönheitsidealen, den Einfluss der Medien auf das Körperbild und die Entstehung von Essstörungen, die verschiedenen Arten von Essstörungen und ihre Symptomatik, Therapiemöglichkeiten und Behandlungsansätze sowie Präventionsstrategien im Umgang mit Essstörungen.
Welche Arten von Essstörungen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Störung und Körperschemastörung, inklusive ihrer Symptomatik, Epidemiologie und Diagnostik.
Welche Erklärungsansätze für Essstörungen werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet biologisch-genetische, psychoanalytische, sozialpsychologische, familiendynamische, neo-behavioristische und soziokulturelle Ansätze (inkl. feministischer und kulturtheoretischer Ansätze sowie den Einfluss der Medien). Der Schwerpunkt liegt auf der Interaktion verschiedener Faktoren.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über Verhaltenstherapien, Gesprächspsychotherapien, Psychoanalyse, Familientherapien, Gestalt- und Körperpsychotherapien, feministische Therapieansätze und die interdisziplinäre Essstörungstherapie. Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung werden ebenfalls detailliert behandelt.
Welche Präventionsprogramme werden erwähnt?
Die Arbeit nennt und beschreibt die Präventionsprogramme PriMA (Primärprävention Magersucht), TOPP (Teenager ohne pfundige Probleme) und Torera (Gemeinsam gegen den Stier) sowie deren Evaluation (im Falle von PriMA).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Schönheitsideale, Körperkult und Schönheitswahn, Essstörungen: Symptomatik, Epidemiologie und Diagnostik, und Essstörungen behandeln. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Essstörungen, Körperbild, Schönheitsideale, Körperkult, Medien, Soziokultur, Prävention, Therapie, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Adipositas, Binge-Eating-Störung, Körperschemastörung, Sozialpädagogik und Primärprävention.
- Arbeit zitieren
- S. Dormann (Autor:in), 2012, Körperkult, Schönheitswahn und Essstörungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/194725