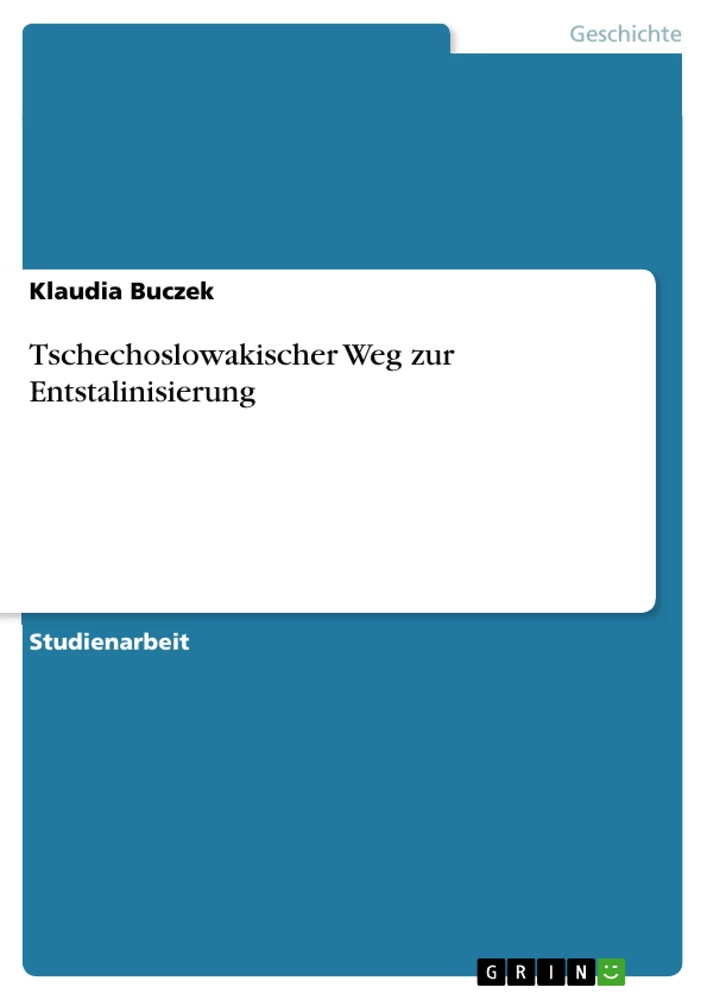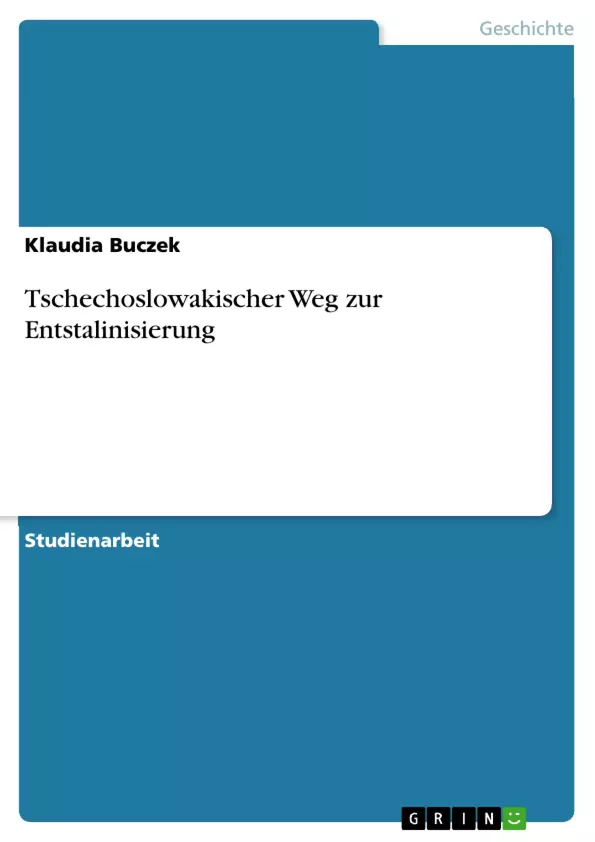Der Prager Frühling ist einer der wohl bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte des Ostblocks. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 marschierten Truppen der Warschauer Pakt-Staaten - der UdSSR, Polens, der DDR, Ungarns und Bulgariens - in die CSSR ein. Sie beendeten damit gewaltsam die Reformbewegung des tschechoslowakischen KP-Chefs Alexander Dubcek, der sich für einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ eingesetzt hatte. Man kann den Prager Frühling nicht verstehen, ohne sich mit dem schleichenden Auflösungsprozess des sowjetischen Sozialismus zu beschäftigen. Mit diesem Prozess werde ich mich in meiner Hausarbeit beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tschechoslowakische Weg zur Entstalinisierung – Gründe für die lange Existenz des Stalinismus in der Tschechoslowakei und die starke Unterordnung dieser gegenüber der UdSSR.
- Was waren die Schwierigkeiten der Entstalinisierung?
- Probleme des Dualismus. Der Dualismus der kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei.
- Das tschechische - slowakische Verhältnis als Auslöser des Prager Frühlings?
- Fazit.
- Literaturverzeichnis.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Prozess der Entstalinisierung in der Tschechoslowakei im Kontext des Ostblocks und beleuchtet die Faktoren, die zur langwierigen Präsenz des Stalinismus und der engen Abhängigkeit von der UdSSR führten. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten, die die Entstalinisierung in der Tschechoslowakei erfuhr, und beleuchtet den Dualismus innerhalb der kommunistischen Partei als einen Schlüsselfaktor in der politischen Entwicklung.
- Die Gründe für die lange Existenz des Stalinismus in der Tschechoslowakei und ihre starke Unterordnung gegenüber der UdSSR.
- Die Herausforderungen und Hindernisse bei der Entstalinisierung in der Tschechoslowakei.
- Der Dualismus innerhalb der kommunistischen Partei und seine Rolle bei der Entstalinisierung.
- Das tschechisch-slowakische Verhältnis und seine mögliche Rolle als Auslöser des Prager Frühlings.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Prager Frühling als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte des Ostblocks vor und erläutert die Notwendigkeit, sich mit dem Auflösungsprozess des sowjetischen Sozialismus zu befassen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Verhältnisses zwischen dem importierten Stalinismus und den eigenen politischen Traditionen der Tschechoslowakei.
- Das zweite Kapitel behandelt die Gründe für die lange Existenz des Stalinismus in der Tschechoslowakei und ihre enge Abhängigkeit von der UdSSR. Es beleuchtet die historischen Wurzeln des tschechischen Kommunismus, die starke Identifikation mit der sowjetischen Ideologie und die Bedeutung des tschechoslowakischen Nationalismus im Verhältnis zu Russland.
- Das dritte Kapitel untersucht die Schwierigkeiten der Entstalinisierung in der Tschechoslowakei. Es analysiert den Mangel an revolutionärer Tradition, das Fehlen einer Feindschaft zu Russland, die Folgen des stalinistischen Terrors und die Abwesenheit von starken Führungspersönlichkeiten, die zur Herausbildung einer Reformbewegung hätten beitragen können.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Dualismus der kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei. Es untersucht die Wurzeln dieses Dualismus, seine Rolle bei der Entstalinisierung und die Frage, ob das tschechisch-slowakische Verhältnis als einer der Auslöser des Prager Frühlings anzusehen ist.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Entstalinisierung, Tschechoslowakei, Stalinismus, UdSSR, Dualismus, kommunistische Partei, Prager Frühling, tschechisch-slowakisches Verhältnis, historische Traditionen, Nationalismus, sowjetische Ideologie, politische Entwicklung, Reformbewegung.
- Quote paper
- Klaudia Buczek (Author), 2010, Tschechoslowakischer Weg zur Entstalinisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/193045