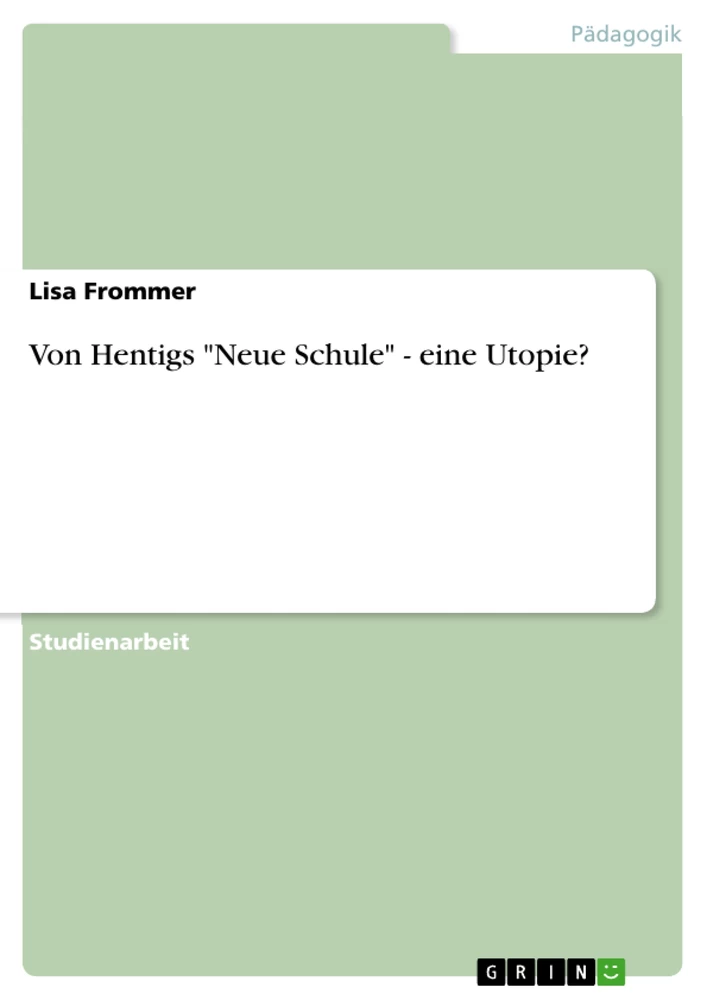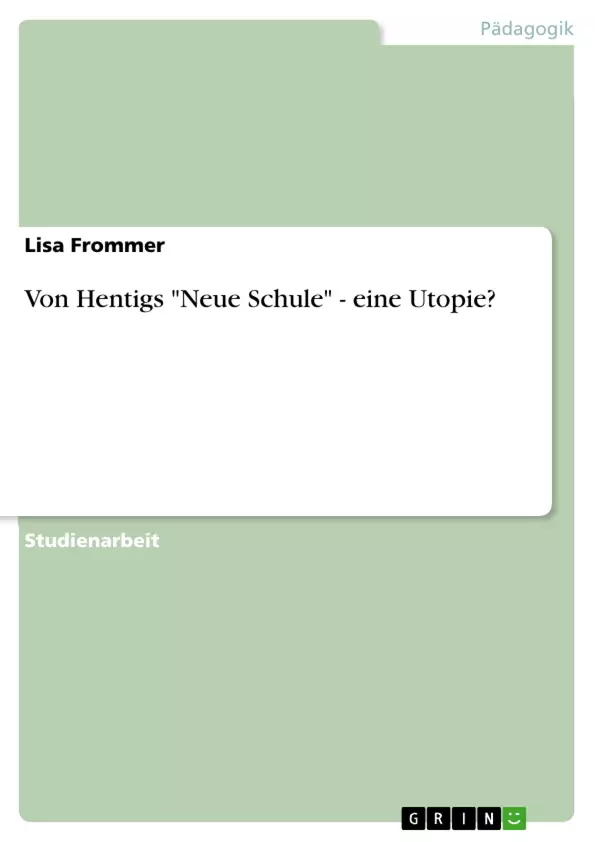Anlässlich einer sich ständig verändernden Gesellschaft kann die Schule nicht gleich bleiben. Sie
muss Stellung nehmen zu aktuellen Verhältnissen, wie steigende Gewalt unter Jugendlichen
(Amokläufe, Killerspiele etc.), neue Medien (Fernsehen, Computer, insbesondere das Internet), eine
multikulturelle Gesellschaft sowie steigende Arbeitslosigkeit und zunehmendes Altern der
Gesellschaft.
Von Hentig zeigte bereits 1993 die bedrohlichen Auswirkungen dieser Trends auf die Schule auf
und stellte die These auf, dass man Schule völlig neu denken müsse. Verbessern und verändern der
bestehenden Strukturen reiche nicht mehr aus, man müsse eine neue Form von Schule erfinden, in
der Schule eine andere Rolle spielt als bisher. Sein Buch erfuhr wohl solch große Resonanz, dass es
regelmäßig in neuen Auflagen erscheint.
Doch ist diese Art von Schule, die von Hentig sich wünscht, überhaupt realisierbar? Ist sie in Teilen
bereits realisiert? Im Folgenden werde ich seine Idee einer Neuen Schule darstellen und kritisch
untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schule neu denken
- Fünf Grundvorstellungen von Schule
- Die Schule als Lebens- und Erfahrungsraum
- Minima Paedagogica
- These
- These
- These
- These
- These
- These
- Wie realistisch ist die Neue Schule?
- Gedanken zur ersten These
- Gedanken zur zweiten These
- Gedanken zur dritten These
- Gedanken zur vierten These
- Gedanken zur fünften These
- Gedanken zur sechsten These
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob von Hentigs Konzept der „Neuen Schule“ eine realistische Utopie darstellt. Ziel ist es, die zentralen Elemente von Hentigs Vision zu analysieren und kritisch zu hinterfragen, ob diese in der heutigen Gesellschaft umsetzbar sind.
- Relevanz der Schule in einer sich wandelnden Gesellschaft
- Kritik an traditionellen Schultypen und deren Ineffizienz
- Die Bedeutung der Schule als Lebens- und Erfahrungsraum
- Die Rolle von Erziehung und Bildung in der neuen Schule
- Die Integration von Lebenswelt und Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik der Schule in einer sich wandelnden Gesellschaft und stellt von Hentigs Idee der „Neuen Schule“ als Lösungsansatz vor. Kapitel 2 analysiert die verschiedenen Schultypen, die von Hentig unterscheidet, und verdeutlicht die Notwendigkeit eines neuen Schulkonzepts, das die Lebenswelt der Schüler in den Mittelpunkt stellt.
Kapitel 3 geht näher auf die sechs Thesen von Hentigs „Minima Paedagogica“ ein und diskutiert deren Realisierbarkeit. Die Autorin untersucht, inwiefern die von Hentig vorgelegte Vision in der Realität umsetzbar ist.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen „Neue Schule“, „von Hentig“, „Lebenswelt“, „Erziehung“, „Bildung“, „Minima Paedagogica“ und „Schule als Lebensraum“. Sie analysiert die Vision einer Schule, die die Lebensinteressen der Schüler in den Vordergrund stellt und sich gleichzeitig den Herausforderungen der modernen Gesellschaft stellt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Vision von Hartmut von Hentigs „Neuer Schule“?
Von Hentig fordert, Schule völlig neu zu denken und sie als Lebens- und Erfahrungsraum zu gestalten, der sich an der Lebenswelt der Schüler orientiert.
Was sind die „Minima Paedagogica“?
Dies sind sechs Thesen von Hentigs, die als pädagogische Grundbausteine für eine neue Form von Schule dienen.
Warum hält von Hentig herkömmliche Schulen für unzureichend?
Er argumentiert, dass die Schule auf gesellschaftliche Veränderungen wie Gewalt, neue Medien und Multikulturalität mit neuen Strukturen reagieren muss, statt alte nur zu verbessern.
Wird in der Arbeit die Realisierbarkeit des Konzepts untersucht?
Ja, die Hausarbeit prüft kritisch, wie realistisch von Hentigs Forderungen sind und ob Teile davon bereits umgesetzt wurden.
Wann stellte von Hentig seine Thesen erstmals auf?
Von Hentig zeigte die bedrohlichen Trends für die Schule bereits im Jahr 1993 auf.
Welche Rolle spielt die Schule als „Lebensraum“?
In der neuen Schule soll das Lernen nicht isoliert stattfinden, sondern in einen ganzheitlichen Erfahrungsraum eingebettet sein, der Erziehung und Bildung vereint.
- Quote paper
- Dipl. Päd. Lisa Frommer (Author), 2009, Von Hentigs "Neue Schule" - eine Utopie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/192162