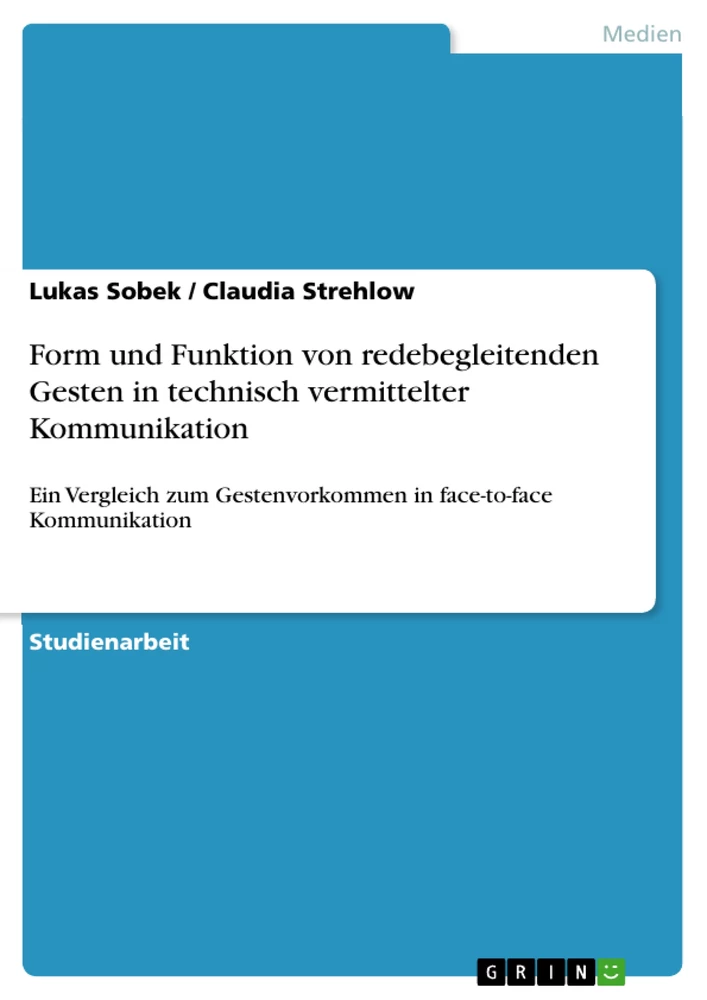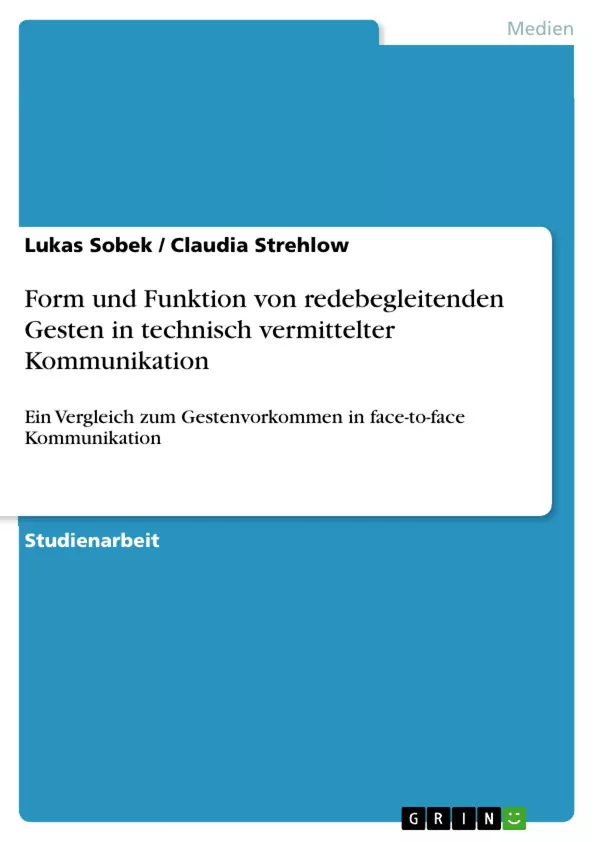Redebegleitende Gesten erfüllen in der Kommunikation unterschiedliche Zwecke: Sie nehmen Bezug auf Gegenstände der Rede, strukturieren das Gesagte, lenken die Aufmerksamkeit der Zuhörer, fordern zu Aktionen auf und wirken an der Erschaffung und am Wechsel von Gesprächsrollen mit. Sie sind „verkörperte“ und daher visuell wahrnehmbare Informationen, die den Gehalt der akustisch-sprachlichen Kommunikationsdimension ergänzen, wiederholen, bestärken oder ersetzen. Multimodale Kommunikation rückt die Verständigung der Menschen ab vom sterilen mathematisch-funktionalistischen Modell der Informationsübertragung und akzentuiert die Möglichkeit von sinnlicher, anschaulicher und kreativer Erzeugung (Produktion: auf der Seite des Sprechers) und Anteilnahme (Reproduktion und Empathie auf der Seite des Adressaten) von Erfahrungen, Kenntnissen und Emotionen. Zahlreiche Gesten nehmen typische Form- und Bewegungsparameter aus praktischen Kontexten an, in denen die Hände eingesetzt werden, und werden zur körperlichen Ausdrucksseite eines metaphorischen Ausdrucks: Argumente werden „weggewischt“, wie die Krümel von der Tischplatte; Positionen werden „ergriffen und festgehalten“, wie eine Fernbedienung; eine Sache wird wie mit einem Stift „nachgezeichnet“. Der leiblich-direkte Bezug zur Vorstellungswelt des Sprechers zeigt sich auch in den Darstellungsmöglichkeiten der Hände: Bedeutung kann über zeichnende, agierende, modellierende und repräsentierende Hände/Finger dargestellt werden (Bavelas et. al 1995: 394-405, Fehrmann 2010: 18-36, Ladewig 2010: 89-111, Müller 1998: 110-119, Müller 2010: 37-68).
Weil redebegleitende Gesten oftmals in einem face-to-face Gespräch aufkommen, könnte man meinen, dass sie primär ausgeführt werden, um die Verständnisleistung des Adressaten zu unterstützen. In der Tat wird bei der Interpretation von Gesten oft die Perspektive des Rezipienten eingenommen, um ihre Funktion zu deuten. Methodologisch wird so automatisch der Adressatenbezug der Gesten in die Ergebnisse eingeschleust. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, Form und Funktion von Gesten zu untersuchen, die in einer Situation produziert werden, in der es keinen unmittelbar-visuellen Adressatenbezug gibt. Diese Gesten können nicht produziert worden sein, um dem Rezipienten das Verstehen zu erleichtern, weil der Sprecher sich der Abwesenheit seines Gesprächspartners vollkommen bewusst ist. Die Untersuchung ermöglicht damit einen Einblick in die Funktionsleistung von Gesten für den Sprecher.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Analytisches Rüstzeug
- II.1 Notationskonventionen für Gesten
- II.2 Kategorisierungen
- III Auswertung und Ergebnisse des Datenmaterials
- III.1 Qualitative Merkmale der Gesten während des Telefonates
- III.2 Variationsmöglichkeiten für den ausgestreckten Zeigefinger
- III.3 Linguistische Eigenschaft von Gesten: Textur
- IV Diskussion
- V Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der Untersuchung ist es, die Form und Funktion von redebegleitenden Gesten in einer technischen Kommunikationssituation (Telefonat) zu analysieren und mit Gesten in face-to-face Kommunikation zu vergleichen. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob die Abwesenheit eines direkt-visuellen Adressaten die Gestenproduktion beeinflusst, welche Gestentypen bevorzugt werden und wie sich die An- bzw. Abwesenheit des Adressaten auf die Produktion interaktiver Gesten auswirkt.
- Form und Funktion von Gesten in technisch vermittelter Kommunikation im Vergleich zu face-to-face Kommunikation
- Einfluss der Abwesenheit eines visuellen Adressaten auf die Gestenproduktion
- Bevorzugte Gestentypen in unterschiedlichen Kommunikationssituationen
- Die Rolle interaktiver Gesten in der Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- I Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der redebegleitenden Gesten ein und erläutert ihre Funktion und Bedeutung in der Kommunikation. Sie hebt die Vielseitigkeit von Gesten hervor und stellt den Bezug zur multimodalen Kommunikation her. Zudem wird das Erkenntnisinteresse der Untersuchung dargelegt: die Analyse von Gesten in einer technischen Kommunikationssituation, in der kein direkter Adressatenbezug besteht.
- II Analytisches Rüstzeug: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Untersuchung. Es werden die Notationskonventionen für Gesten nach Jana Bressem (2008) vorgestellt und die Transkriptions- und Annotationsmethoden erläutert.
- III Auswertung und Ergebnisse des Datenmaterials: Das Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die qualitativen Merkmale der Gesten im Telefonat analysiert, die Variationsmöglichkeiten des ausgestreckten Zeigefingers untersucht und die linguistische Eigenschaft von Gesten, die Textur, betrachtet.
Schlüsselwörter
Redebegleitende Gesten, technisch vermittelte Kommunikation, face-to-face Kommunikation, Gestenproduktion, Adressatenbezug, Gestenraum, Notationskonventionen, Transkription, Annotation, Textur.
- Arbeit zitieren
- Lukas Sobek (Autor:in), Claudia Strehlow (Autor:in), 2011, Form und Funktion von redebegleitenden Gesten in technisch vermittelter Kommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/190250