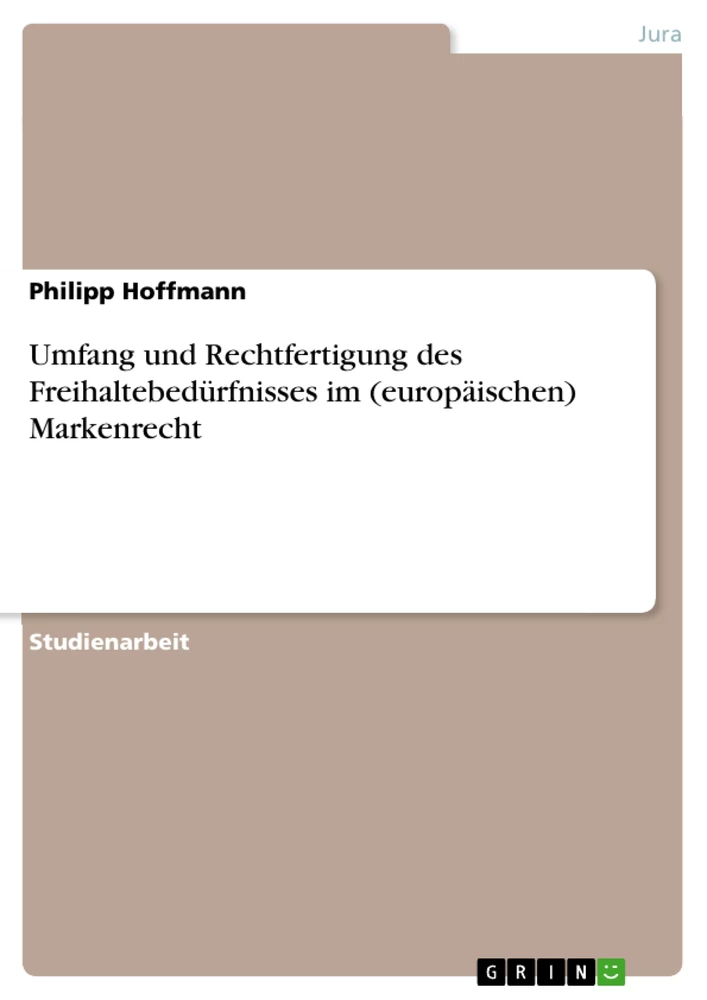Das europäische Recht hat sich das Freihaltebedürfnis, wie es in 100-jähriger Praxis in Deutschland entwickelt wurde, einverleibt, verarbeitet und etwas Neues hervor gebracht. Das „neue“ FHB dient dem Ziel des unverfälschten Wettbewerbs und schützt mittelbar die Mitbewerber, die ihrerseits häufig als Begründung für die Freihaltung eines Zeichens herangezogen werden.
Dem neuen Freihaltebedürfnis wird durch die große Anzahl von Markenformen auf unterschiedlichsten Ebenen Rechnung getragen, während es kaum beschränkt ist. Die Europäisierung des Markenrechts hat die deutsche Entwicklung finalisiert und das Freihaltebedürfnis endlich konkretisiert. Die Rechtsprechung des EuGH entwickelt die dazu gehörige deutliche Linie im praktischen Umgang.
Somit ist die Problematik von 1874 endlich gelöst und die beschreibenden Zeichen werden anhand nachprüfbarer Kriterien hinsichtlich Begründung, Rechtfertigung und Umfang freigehalten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung und Problematik
- 1. Entstehung des FHB
- a) 101 Jahre FHB nach WBG und WZG
- aa) Der Polyestra-Entscheidung vorangehend
- bb) Die Polymar-/Polyestra-Entscheidungsfolge
- cc) Der Polyestra-Entscheidung nachfolgend.......
- b) Entwicklung des FHB ab 1995
- 2. Bestimmung und Abgrenzung des Begriffs des FHB
- a) Verwendung als Synonym.....
- b) Verwendung als Schranke
- c) Verwendung zur Bezeichnung eines allgemeinen Rechtsgedankens............
- d) Festlegung des im Folgenden verwendeten Begriffs
- 3. Zusammenfassung
- II. Rechtfertigung des FHB
- 1. Funktionen der Marke
- 2. Schutzzweck des FHB
- a) Abgrenzung von § 8 II Nr. 1 MarkenG
- b) Abgrenzung von § 3 II MarkenG
- 3. Aspekte der Rechtfertigung ...
- a) Freie Kommunikation und Schranken des Markenrechts
- b) Spezieller: Schutz der beteiligten Verkehrskreise..
- c) Schutz der Mitbewerber im MarkenG
- d) Garantie des unverfälschten Wettbewerbs
- 4. Zusammenfassung
- III. Umfang des FHB
- 1. Auslegung des § 8 II Nr. 2 ........
- a) Eigenschaften und Merkmale iSv. § 8 II Nr. 2
- b) Beschreibung der beanspruchten Waren / DL
- c) Verkehr
- aa) Literaturmeinungen
- bb) BGH-Rechtsprechung..
- cc) EuGH-/EuG-Rechtsprechung
- dd) Zusammenfassung und Stellungnahme .
- d) Zu betrachtendes Zeichen....
- e),,zur Bezeichnung dienen können“
- aa) Subjektiver Tatbestand: das Inverbindungbringen
- bb) Objektiver Tatbestand: „zukünftiges FHB“
- cc) Bezeichnung nur wesentlicher Merkmale
- dd) Erforderlichkeit eines unmittelbaren Warenbezugs
- f) Merkmal der Ausschließlichkeit..
- 2. Veranschaulichung anhand einzelner Zeichenarten
- a) Wortmarken
- aa) Wortmarken, die keine Kombinationen darstellen
- bb) Neuschöpfungen / Kombinationen.....
- cc) Buchstaben- und Zahlenmarken
- b) Dreidimensionale Warenformen
- aa) Vorgabe des EuGH
- bb) Nationale Rechtsprechung nach Linde/Winward/Rado
- cc) Überblick über die Literaturmeinungen.......
- dd) Zusammenfassung und Stellungnahme .
- c) Abstrakte Farbmarken
- 3. Grenzen und Schranken des Umfangs
- a) Angelehnte Zeichen..
- b) Verkehrsdurchsetzung..
- c) Schranke des § 23 Nr. 2 .....
- d) Relevanz von Ausweichmöglichkeiten
- 4. Zusammenfassung
- IV. Endergebnis und Schluss....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Funktionen der Marke im (europäischen) Markenrecht und beleuchtet insbesondere die Rechtfertigung und den Umfang des Freihaltebedürfnisses. Dabei wird die historische Entwicklung des Freihaltebedürfnisses (FHB) betrachtet und die verschiedenen Begriffsbedeutungen abgegrenzt.
- Funktionen der Marke im Markenrecht
- Rechtfertigung des Freihaltebedürfnisses
- Umfang des Freihaltebedürfnisses
- Auslegung des § 8 II Nr. 2 MarkenG
- Grenzen und Schranken des Umfangs des Freihaltebedürfnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Freihaltebedürfnisses im deutschen Markenrecht. Es werden die wichtigsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Thematik beleuchtet, wobei insbesondere die Polyestra-Entscheidung im Zentrum steht. Außerdem wird der Begriff des FHB definiert und abgegrenzt.
Im zweiten Kapitel wird die Rechtfertigung des Freihaltebedürfnisses anhand der Funktionen der Marke und des Schutzzwecks des Markenrechts untersucht. Es wird dargelegt, warum das Freihaltebedürfnis im Markenrecht notwendig ist, um eine freie Kommunikation und einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Umfang des Freihaltebedürfnisses. Hierbei wird die Auslegung des § 8 II Nr. 2 MarkenG im Mittelpunkt stehen, wobei insbesondere die Aspekte Verkehr, Zu betrachtendes Zeichen und Merkmal der Ausschließlichkeit behandelt werden. Es werden verschiedene Zeichenarten und deren Schutz durch das Freihaltebedürfnis betrachtet, darunter Wortmarken, dreidimensionale Warenformen und abstrakte Farbmarken. Abschließend werden die Grenzen und Schranken des Umfangs des Freihaltebedürfnisses erläutert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen des Markenrechts, insbesondere dem Freihaltebedürfnis, den Funktionen der Marke, dem Schutz von Zeichen, der Auslegung von § 8 II Nr. 2 MarkenG, der Bedeutung von Verkehr und der Abgrenzung von Wort-, Farb- und Formmarken. Sie beleuchtet die aktuelle Rechtsprechung des BGH und des EuGH sowie relevante Literaturmeinungen.
- Quote paper
- Philipp Hoffmann (Author), 2011, Umfang und Rechtfertigung des Freihaltebedürfnisses im (europäischen) Markenrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/189580