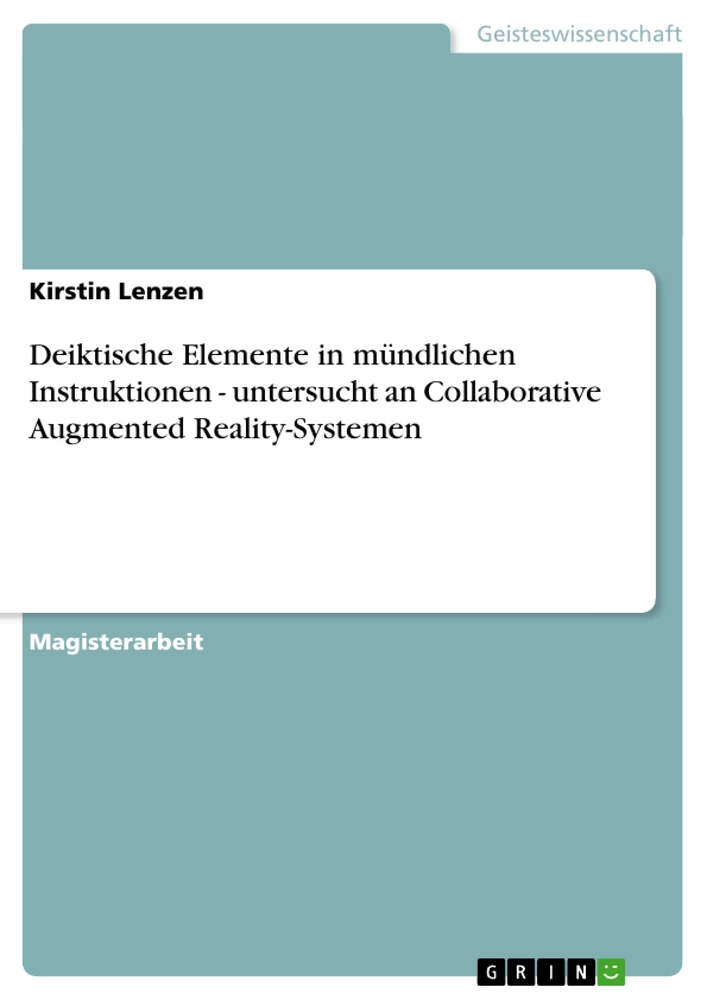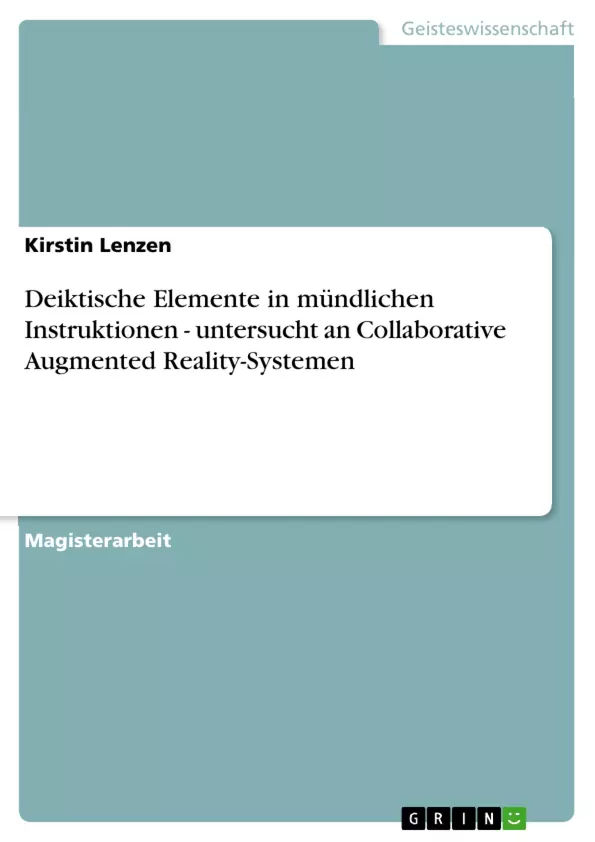Vor zehn Jahren galt die Augmented Reality als und vielversprechende, junge Technologie, der man eine Vielzahl innovativer Anwendungen zutraute. Zu diesem Zeitpunkt stellte die linguistische Beschäftigung mit kommunikativen Aspekten dieser Technologie eine Pionierarbeit dar. In der Zwischenzeit ist viel passiert, und man könnte meinen, die Arbeit sei seit ihrem Erscheinen längst überholt. In der Tat ist der Verlauf der Augmented Reality Technologie gekennzeichnet durch zahlreiche Höhen und Tiefen sowie kritische Ereignisse, die ihr immer wieder eine neue, zum Teil unvorhergesehene Richtung verliehen. So brachte Apple beispielsweise das neue IPhone 3GS heraus, woraufhin sich die Zahl der Anwendungen (Apps) für dieses SmartPhone nahezu explosionsartig vervielfältigte. Und genau in dieser Nische feierte auch die Augmented Reality Technologie ihr neues Revival: Augmented Reality-Apps ermöglichen heute die genaue begriffliche Bestimmung von Berggipfeln („Peaks“), zeigen mir, wo ich die nächste Filiale einer großen Fast-Food-Kette finde („AR Germany“, „Layar“, „Wikitude“) und helfen mir bei der Einrichtung meines Wohnzimmers, indem sie die in Frage kommenden Möbel schon mal probehalber virtuell in den einzurichtenden Raum projezieren („iLiving“) während die durch die Buchungsplattform betriebene App „Hotels now“ mir hilft, schnell vor Ort ein Hotel zu finden und zu buchen. Besonderes Aufsehen erregte die Anwendung „Recognizer“, welche mittels Gesichtserkennung die Identifizierung unbekannter Personen in sozialen Netzwerken ermöglicht und dadurch Datenschützer alamierte.
Trotz dieser bemerkenswerten Erfolgsgeschichte hat sich ein Sachverhalt nicht geändert: Bislang existieren nachwievor kaum Untersuchungen der Augmented Reality Technologie aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Das ist umso erstaunlicher, als diese Technologie ein außerordentliches hohes Potential birgt und bereits jetzt das soziale Miteinander verändert und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in naher Zukunft auch als Interaktionsmedium etablieren wird. Aus diesem Grund scheinen vor allem auch Analysen über die Auswirkungen dieser Technologie auf Interaktion und Kommunikation nötig. Die vorliegende Studie hat sich als eine der ersten oder vielleicht als die erste intensiv mit der durch Augmented-Reality-Systeme vermittelten Kommunikation beschäftigt und ihre Effizienz untersucht, aber auch Schwachstellen und Handlungsbedarf identifiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur ersten Auflage 2012
- 1. Einleitung
- 2. Kommunikation als Grundlage menschlicher Zusammenarbeit
- 2.1 Kommunikationsmodelle
- 2.1.1 Kommunikation als Transportmodell
- 2.1.2 Kommunikation als Zeichenmodell
- 2.1.3 Kommunikation als Verhaltensmodell
- 2.1.4 Kommunikation als Handlungsmodell
- 2.1.5 Kommunikation als Gesprächsmodell
- 2.2 Kommunikationskanäle
- 2.1 Kommunikationsmodelle
- 3. Medial vermittelte Kommunikation
- 3.1 Oralität und Literalität
- 3.2 Die zerdehnte Sprechsituation als Ausgangspunkt medial vermittelter Kommunikation
- 3.3 Theorien zur Medienwahl und -verwendung
- 3.3.1 Interaktion als regelgeleitetes Geschehen
- 3.3.2 Theorie der sozialen Präsenz
- 3.3.3 Media Symbolism und Media Richness Theorie
- 3.3.4 Modell der aufgabenorientierten Medienwahl
- 4. Collaborative Augmented Reality
- 4.1 Virtual Reality und Collaborative Augmented Reality
- 4.2 Collaborative Augmented Reality in der Instandhaltung
- 4.3 Linguistische und medienspezifische Einordnung von Collaborative Augmented Reality
- 4.3.1 Oralität und Literalität
- 4.3.2 Theorien zur Medienwahl und -verwendung
- 4.3.3 Fachsprache
- 4.3.4 Text, Textmuster und Textsorte
- 5. Deixis als Mittel der Verständigung
- 5.1 Verständigung als Ziel der Kommunikation
- 5.2 Mentale Modelle und räumliche Repräsentationen als Ausgangspunkt von Verstehensleistungen in Instruktionen
- 5.3 Deiktische Elemente als Grundlage adäquater räumlicher Repräsentationen
- 5.3.1 Verbale deiktische Zeigehandlungen
- 5.3.2 Nonverbale deiktische Zeigehandlungen
- 5.3.3 Computer-unterstützte Deixis
- 6. Untersuchungsteil
- 6.1 Einführung
- 6.2 Beschreibung der Remote-Unterstützungsmedien
- 6.3 Untersuchte Kriterien
- 6.4 Zusätzliche Untersuchungen
- 6.5 Störvariablen
- 6.5.1 Individuelle Störvariablen
- 6.5.2 Umgebungsbedingte Störvariablen
- 6.6 Versuchspersonen
- 6.7 Versuchsbeschreibung
- 6.7.1 Versuchsaufbau
- 6.7.2 Versuchsaufgabe
- 6.7.3 Versuchsablauf
- 6.8 Auswertungsmethode
- 6.9 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse
- 6.10 Darstellung und Auswertung der zusätzlichen Untersuchungen
- 6.11 Diskussion der Ergebnisse
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle deiktischer Elemente in der medial vermittelten Interaktion mit Augmented Reality (AR) Systemen. Ziel ist es, die Bedeutung der Deixis für die Verständigung in Remote-Unterstützungssituationen zu analysieren und die Möglichkeiten der computer-unterstützten Deixis zu beleuchten.
- Kommunikationsmodelle und Kommunikationskanäle in der Mensch-Maschine-Interaktion
- Theorien zur Medienwahl und -verwendung in der Mensch-Maschine-Kommunikation
- Deiktische Elemente als Grundlage räumlicher Repräsentationen
- Collaborative Augmented Reality in der Instandhaltung
- Linguistische und medienspezifische Einordnung von Collaborative Augmented Reality
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die Entwicklung der Augmented Reality Technologie und ihren Stellenwert in der heutigen Gesellschaft. Kapitel 1 gibt eine Einleitung in das Thema der Arbeit, während Kapitel 2 grundlegende Kommunikationsmodelle und -kanäle im Kontext der Mensch-Maschine-Kommunikation behandelt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit medial vermittelter Kommunikation, wobei die Oralität und Literalität sowie Theorien zur Medienwahl und -verwendung im Vordergrund stehen.
Kapitel 4 widmet sich dem Bereich Collaborative Augmented Reality, wobei insbesondere die Einsatzmöglichkeiten in der Instandhaltung sowie linguistische und medienspezifische Aspekte beleuchtet werden.
Kapitel 5 befasst sich mit der Deixis als Mittel der Verständigung und analysiert die Rolle deiktischer Elemente in Instruktionen.
Kapitel 6 beschreibt die Untersuchungsteil, wobei die Beschreibung der Remote-Unterstützungsmedien, die untersuchten Kriterien und die Durchführung des Versuchs im Detail beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Deixis, Augmented Reality, Collaborative Augmented Reality, Remote-Unterstützung, Mensch-Maschine-Interaktion, Medienwahl, Verständigung, Instruktionen, räumliche Repräsentationen, Fachsprache
- Arbeit zitieren
- Kirstin Lenzen (Autor:in), 2001, Deiktische Elemente in mündlichen Instruktionen - untersucht an Collaborative Augmented Reality-Systemen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188949