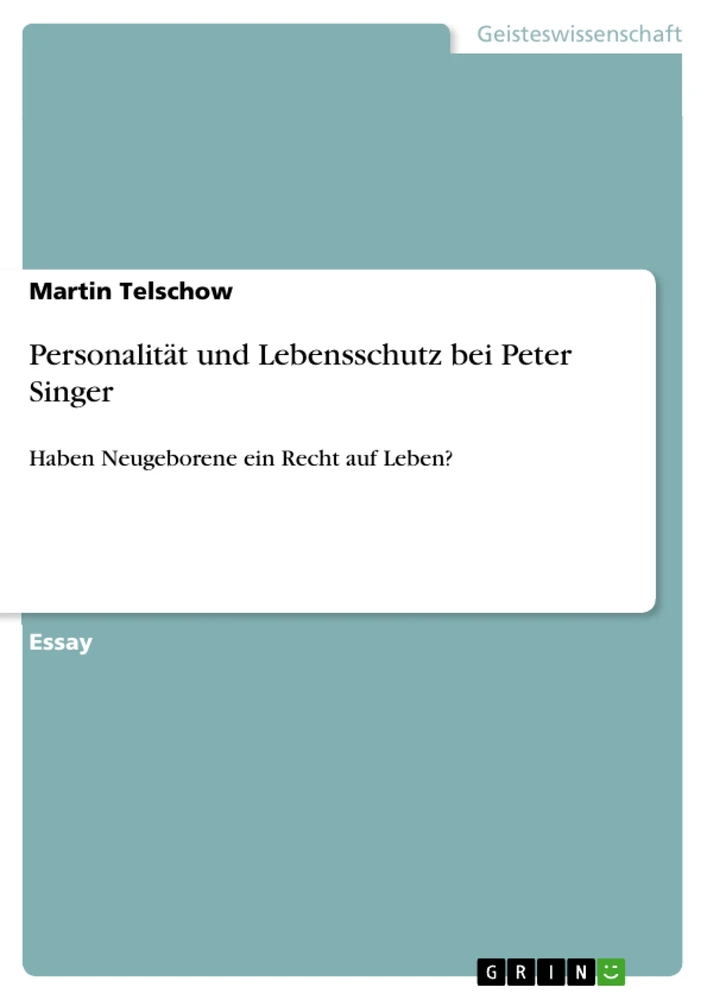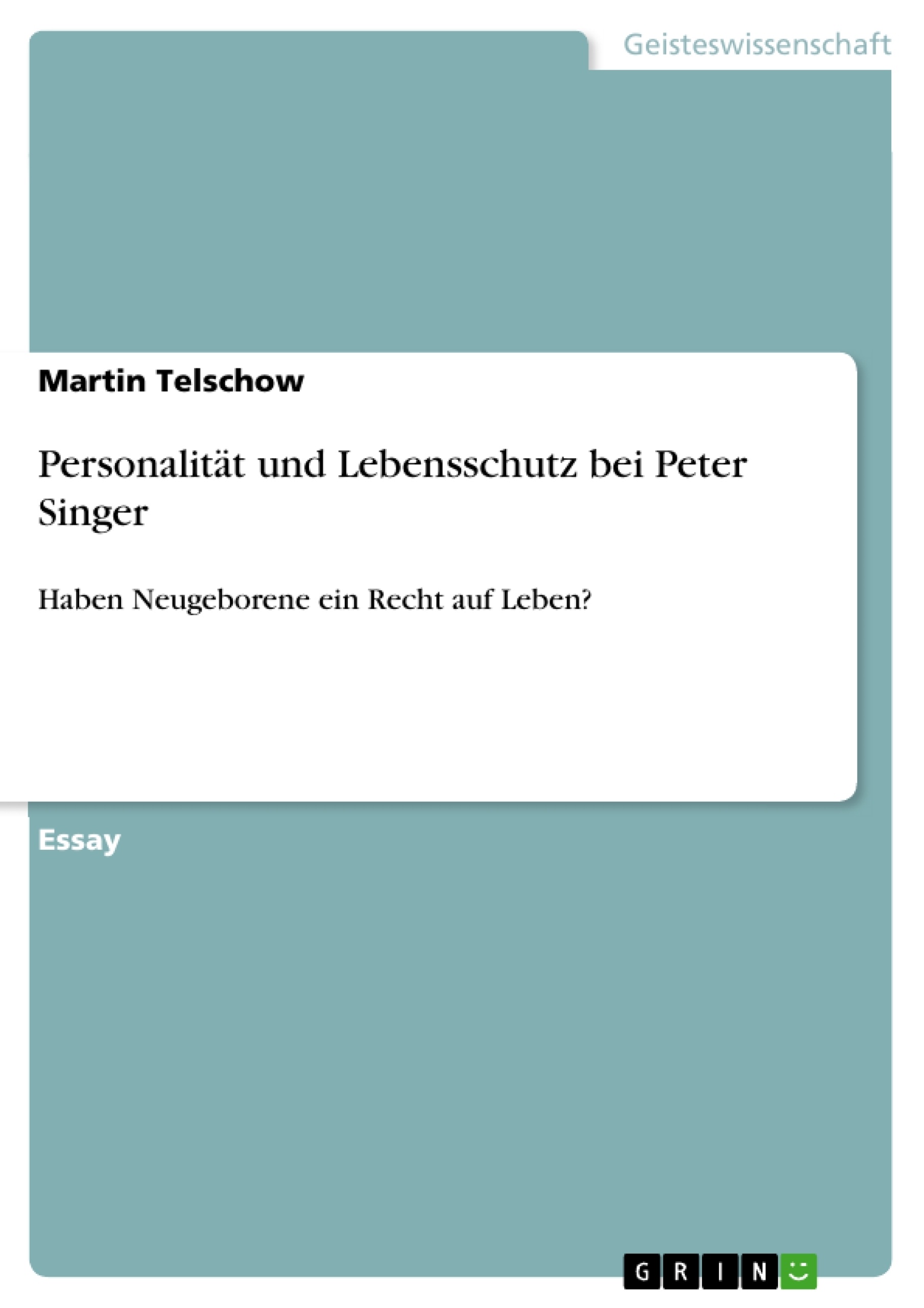Person sein, heißt sich selbst in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit wahrnehmen zu können. Personen haben Interessen, die sie autonom umsetzen können. Nicht-Personen können dies nicht. Ergo, haben Personen ein Lebensrecht und Nicht-Personen haben keines. Dies ist die weit möglichst reduzierte Grundaussage der praktischen Ethik von Peter Singer. Daraus ergeben sich Konsequenzen. Überspitzt dargestellt diese: Wenn Singer bei Veganern vorbeischaut, gibt es Jubelfeier und Konfetti. Wenn Singer bei Behindertenverbänden vorbeischaut, bereitet man sich alle auf eine Diskussion mit dem Beelzebub vor.
Warum? Die Konsequenz Singers ist, dass nicht nur Menschen als Personen angesehen werden können, sondern zumindest auch einige höher entwickelten Säugetiere. Hat ihr Hund Persönlichkeit mit einem Sinn für Vergangenes und die Zukunft? Wenn sie dem Zustimmen, so ist ihr Hund Person mit einem Lebensrecht.
Aber kann das ein Neugeborenes von sich auch behaupten? Was macht den Unterschied zwischen Abtreibung vor der Entbindung (Das Kind ist Behindert, niemand will es) und Abtreibung, sagen wir 24 Stunden nach Geburt (Das Kind wurde durch die Geburt schwerstbehindert, niemand will es)?
DIESE FRAGEN SIND "STARKER TOBAK!" Diese wissenschaftliche Arbeit(!) widmet sich dem Thema durch neutrale Analyse. Singers Argumente werden denen von Pöltner (Bioethiker) gegenübergestellt, der sehr wohl (behinderten) Neugeborenen ein Lebensrecht anerkennt. Dabei bekommt der Leser ein allgemeines Verständnis für die Argumentationslinien beider Autoren, die unabhängig voneinander betrachtet werden. Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt im letzten Teil des Essays. Mit Pöltners Argumenten und eigenen Überlegungen wird deutlich, dass der Personenbezug für das Recht auf Lebensschutz kein Ausschlusskriterium für das Lebensrecht Neugeborener sein kann, egal ob sie jemand will oder nicht. Damit komme ich trotz der Nutzung von Singers Prämissen zu einer anderen Schlussfolgerung als Singer selbst.
Inhaltsverzeichnis
- Neue Fragen und schwierige Antworten
- Ein kurzes Wort zum Gedanken der Menschenwürde
- Lebensschutz bei Peter Singer
- Neugeborene als ersetzbar
- Argumente gegen einen Lebensschutz als alleiniges Personenrecht
- Der Zeitpunkt des Existenzbeginns
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit der Frage, ob Neugeborene ein Recht auf Leben haben und untersucht die Position von Peter Singer in Bezug auf Lebensschutz und die ethische Vertretbarkeit des Töten von Neugeborenen. Er analysiert Singers Argumente im Kontext seiner präferenz-utilitaristischen Ethik und stellt diese kritisch in den Mittelpunkt der Diskussion.
- Das Konzept des Lebensschutzes und seine Anwendung auf Neugeborene
- Die ethische Vertretbarkeit des Töten von Neugeborenen unter bestimmten Bedingungen
- Die Frage nach dem Zeitpunkt des Existenzbeginns und der Entwicklung der Persönlichkeit
- Kritik an Singers Ethik und die Auseinandersetzung mit alternativen Positionen
- Der Einfluss von medizinischem Fortschritt auf die Debatte um Lebensschutz und die ethischen Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Neue Fragen und schwierige Antworten
Dieses Kapitel stellt einleitend die zentralen Fragen des Essays vor: Besitzen Neugeborene eine geringere Wertigkeit als Erwachsene? Wiegt das Töten von Neugeborenen genauso schwer wie das Töten von Erwachsenen? Ist das Töten von behinderten Neugeborenen vielleicht überhaupt kein Unrecht? Es wird Peter Singers Position im Kontext seiner präferenz-utilitaristischen Ethik vorgestellt und die Relevanz seiner Argumente für die aktuelle Debatte um Lebensschutz und ethische Fragen im medizinischen Bereich hervorgehoben.
Ein kurzes Wort zum Gedanken der Menschenwürde
Dieser Abschnitt analysiert den Gedanken der Menschenwürde als Grundlage für die Diskussion um Lebensschutz. Es wird die Bedeutung der Menschenwürde als Grundprinzip im deutschen Rechtssystem und ihre Schutzfunktion gegenüber Diskriminierung und Objektbehandlung betont. Die Problematik der Vereinbarkeit von Singers Ethik mit dem Gedanken der Menschenwürde wird angesprochen, jedoch ohne eine definitive Antwort zu liefern.
Lebensschutz bei Peter Singer
In diesem Kapitel wird Singers Position zum Thema Lebensrecht und Lebensschutz von Neugeborenen dargestellt. Seine Kernaussage, dass es unter bestimmten Voraussetzungen ethisch vertretbar ist, Neugeborene zu töten, wird anhand von Zitaten aus seinen Werken „praktische Ethik“ und „Should the Baby Live?“ verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Der Essay beschäftigt sich mit den zentralen Themen Lebensschutz, Neugeborenen, Ethik, Präferenz-Utilitarismus, Menschenwürde, medizinischer Fortschritt, Behinderung, und den Argumenten von Peter Singer. Die Auseinandersetzung mit Singers Ethik und die Frage nach dem Zeitpunkt des Existenzbeginns stehen im Fokus der Diskussion.
- Quote paper
- Martin Telschow (Author), 2011, Personalität und Lebensschutz bei Peter Singer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188667