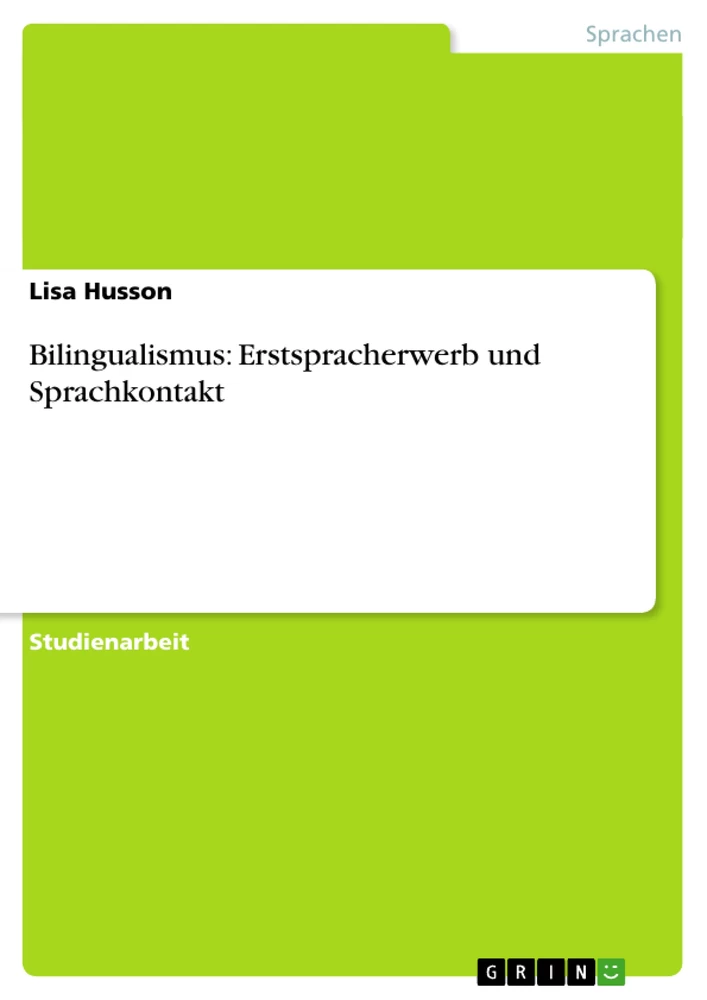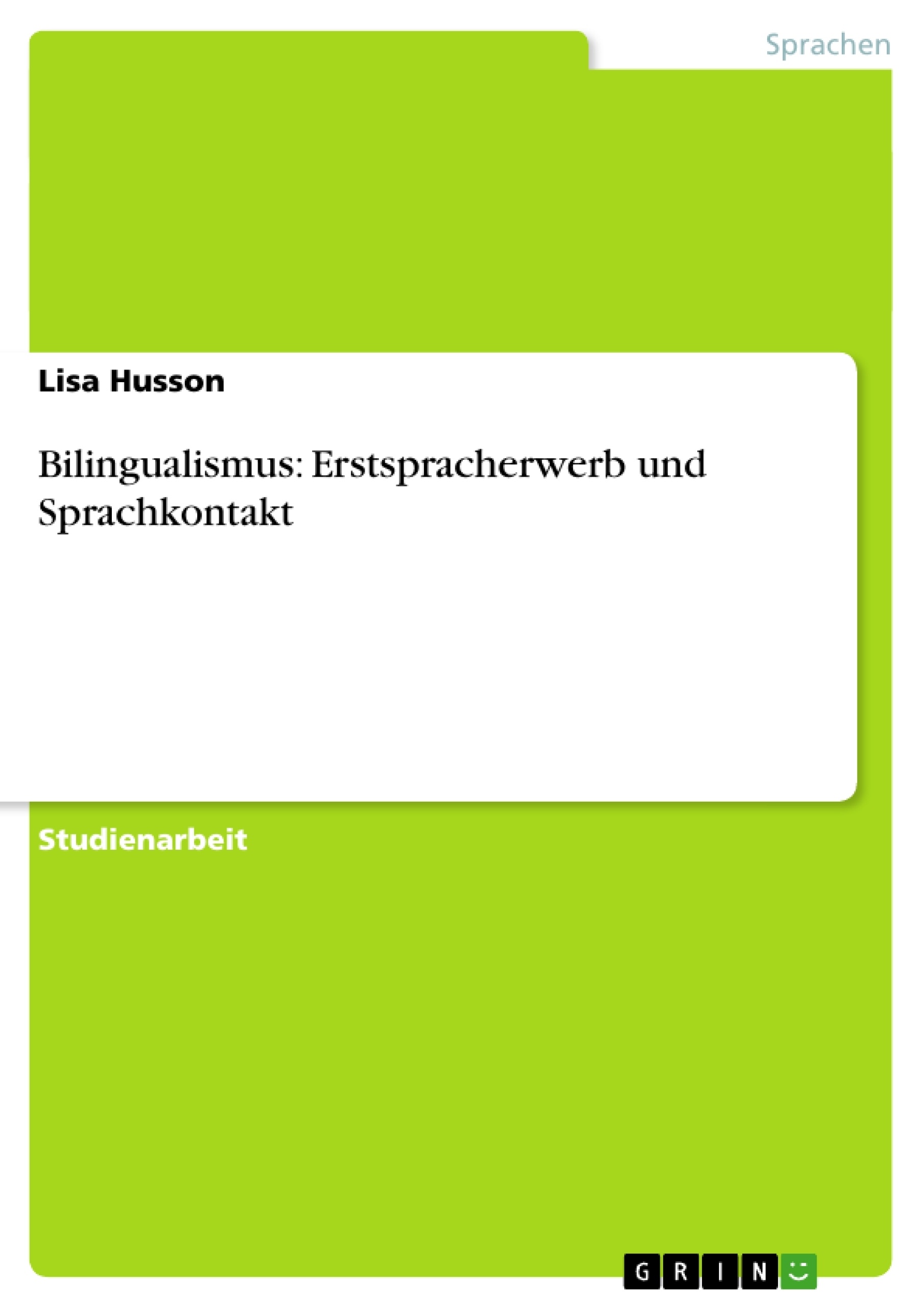Bis in die 1950er Jahre war zweisprachige Kindererziehung noch stark mit vielen Vorurteilen bis hin zu regelrechter Feindseligkeit belastet. Heutzutage möchten viele Eltern, dass ihre Kinder zweisprachig aufwachsen, auch wenn beide Eltern die gleiche Sprache sprechen und schicken ihre Kinder folglich in bilinguale Kindergärten, stellen ein ausländisches Kindermädchen ein oder sprechen selbst mit dem Kind eine Sprache, welche nicht ihre Muttersprache ist.
In der modernen Forschung wird Zweisprachigkeit inzwischen normalisiert. Bilinguismus sei die Regel, Monolinguismus eine Ausnahmeerscheinung. Bhatia und Ritchie (2006) proklamieren in ihrem „Handbook of Bilingualism“, dass Bilinguismus heutzutage die Norm sei. Es wird geschätzt, dass es 5000 Sprachen auf der Welt gibt, die sich nun auf 200 Staaten verteilen müssten: daraus folgern die Autoren, dass die Kommunikation mehrsprachig sein müsse, wenn weltweit durchschnittlich 25 Sprachen in einem Land gesprochen würden.
„Obwohl in Europa alle Staaten mit Ausnahme von Liechtenstein und Island anerkannte Sprachminderheiten aufweisen, heißt das doch nicht, dass die meisten Bewohner dieser Länder tatsächlich bilingual sind. […] Man kann also nicht einfach die Zahl der Sprachen auf der Welt durch die Zahl der Länder dividieren und dann daraus schließen, des gebe im Schnitt 25 Sprachen pro Land und damit sei jeder Mensch bilingual, wie es die Autoren des Bilingualism-Handbuchs tun: Das ist eine grobe Vereinfachung und eine Manipulation.“ (Lippert 2010: 57)
Mit der Normalisierung des Bilinguismus verändert sich auch die Sichtweise auf den bilingualen Spracherwerb. Dieser wird generell als ein Kinderspiel dargestellt, es sei viel einfacher und unbeschwerter zwei Sprachen im Kleinkindalter zu lernen, als sich später in der Schule oder sogar im Erwachsenenalter damit herumschlagen zu müssen.
Wie hat sich diese Veränderung, dieser Wandel von dem einen zum anderen Extrem gewandelt?
Wie hat sich der Forschungsstand zum Thema Zweisprachigkeit weiterentwickelt?
Wie unterscheidet sich monolingualer von bilingualem Erstspracherwerb? Und wie beeinflussen sich zwei simultan gelernte Sprachen gegenseitig?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Erstspracherwerb
- Monolingualer Erstspracherwerb
- Erstspracherwerb und die Entwicklung von Kompetenzen
- Universalgrammatik
- Bilingualer Erstspracherwerb
- Das Drei-Phasen-Modell
- Sprachdominanz
- Formen der Zweisprachigkeit
- Typen zweisprachiger Erziehung
- Monolingualer Erstspracherwerb
- Lingue in contatto: Spracheneinfluss und Sprachmischungen
- Code-mixing bzw. language-mixing
- Sprachmischungen und Interferenzen am Beispiel einer deutsch-französischen Fallstudie (Jonekeit)
- Sprachmischungen und kindliches code-switching am Beispiel einer deutsch-italienischen Fallstudie (Cantone)
- Transfer und Sprachveränderung
- Code-switching
- Warum switchen Menschen zwischen Sprachen?
- Präferenzbezogenes code-switching
- Nicht-funktionales code-switching
- Spracherhalt und Sprachumstellung
- Code-mixing bzw. language-mixing
- Sprachenpolitik heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Prozess des bilingualen Spracherwerbs und beleuchtet den Einfluss von Sprachkontakt auf die Sprachentwicklung. Dabei werden sowohl die verschiedenen Formen des bilingualen Erwerbs als auch die Phänomene des Code-mixing und Code-switching analysiert. Die Arbeit zeigt auf, wie sich die Sichtweise auf Zweisprachigkeit in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat und welche Herausforderungen und Chancen mit dem bilingualen Spracherwerb verbunden sind.
- Entwicklung des bilingualen Spracherwerbs
- Code-mixing und Code-switching in verschiedenen Kontexten
- Sprachdominanz und -beeinflussung im bilingualen Umfeld
- Spracherhalt und Sprachumstellung im Kontext der Sprachenpolitik
- Theorien zum Spracherwerb im monolingualen und bilingualen Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des bilingualen Spracherwerbs und stellt den aktuellen Forschungsstand vor. Das zweite Kapitel behandelt den monolingualen Erstspracherwerb und die Entwicklung von Kompetenzen, inklusive der Universalgrammatik. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem bilingualen Erstspracherwerb und seinen verschiedenen Facetten, z.B. dem Drei-Phasen-Modell und den Formen der Zweisprachigkeit.
Kapitel 4 analysiert verschiedene Aspekte des Sprachkontakts, darunter Code-mixing, Code-switching und Sprachveränderung. Das Kapitel beinhaltet Fallstudien, die den Einfluss von Sprachkontakt auf die Sprachentwicklung von Kindern verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Bilingualismus, Erstspracherwerb, Sprachkontakt, Code-mixing, Code-switching, Sprachdominanz, Sprachveränderung, Universalgrammatik, Sprachenpolitik, Sprachminderheiten, Sprachentwicklung, Interferenz.
- Arbeit zitieren
- Lisa Husson (Autor:in), 2011, Bilingualismus: Erstspracherwerb und Sprachkontakt, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/188249