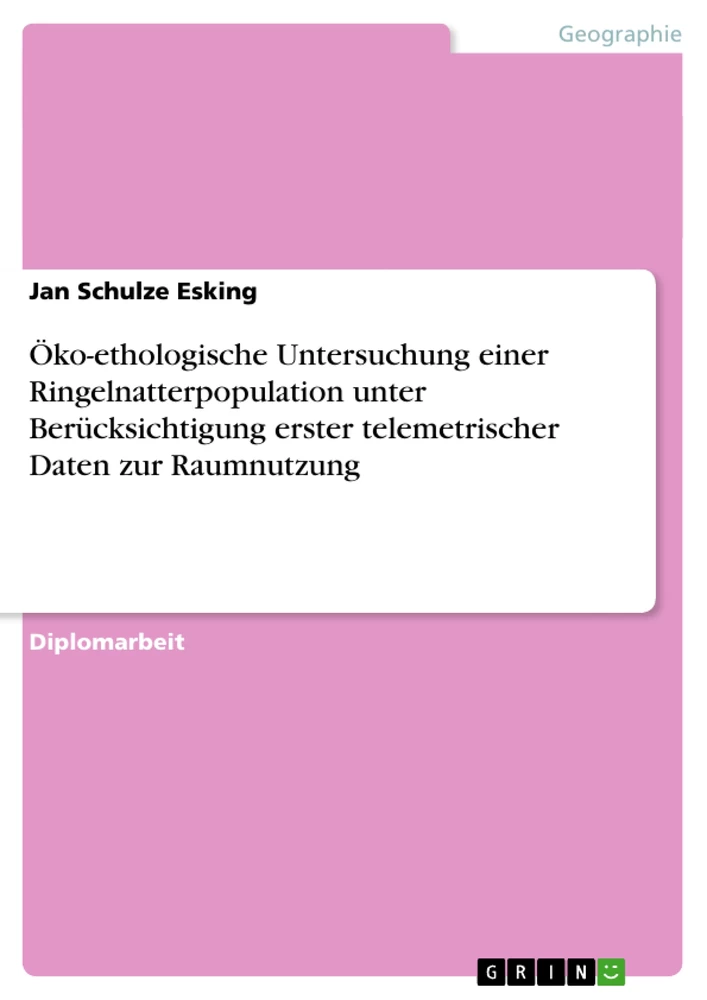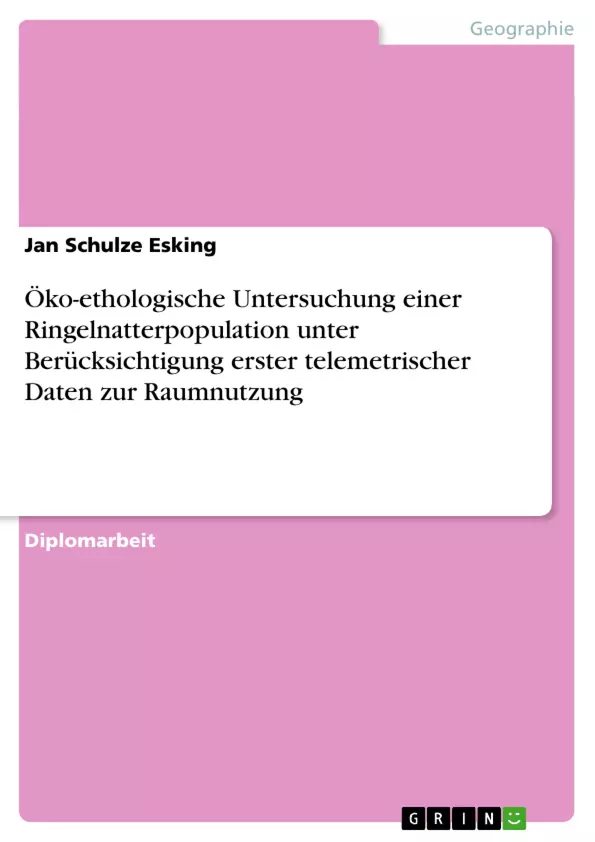Das weltweite Artensterben betrifft auch in einem großen Umfang unsere heimischen Amphibien und Reptilien. Die negativen Folgen zunehmender Urbanisierung in Deutschland betreffen direkt eine große Anzahl von diesen Tierarten. Durch eine großflächige Lebensraumzerstörung, dem immer weiter zunehmenden Straßenverkehr und das Einbringen von Umweltgiften werden die Bestände der Amphibien und Reptilien immer weiter reduziert. Dabei sind diese Tierarten oft wichtige Bestandteile funktionierender Ökosysteme und deren Nahrungsnetzen. Auch die Ringelnatter (Natrix natrix) bildet da keine Ausnahme. Da Amphibien ihre Hauptnahrungsquelle darstellen, ist sie nicht nur durch die Zerstörung ihres eigenen Lebensraumes, sondern auch durch die Bestandrückgänge ihrer bevorzugten Beute stark betroffen.
Die Ringelnatter gehört zur Familie der Nattern und zur Gattung der europäischen Wassernattern. Zu den 3 Vertretern dieser Gattung zählen ebenfalls die in Deutschland vorkommende Würfelnatter (Natrix tessellata) sowie die Vipernnatter (Natrix maura). Natrix natrix ist in ganz Europa – ohne die Länder Irland und Großbritannien, das nördliche Skandinavien sowie einige Mittelmeerinseln (Kreta, Malta und die Balearen) – und dazu noch in Teilen Nordwestafrikas, Kleinasiens und Westrusslands zu finden. In diesem Gebiet ist sie mit 13 Unterarten vertreten.
Das Untersuchungsgebiet Davert liegt in einem Übergangsbereich der beiden Unterarten Natrix natrix natrix (Nominatform) und Natrix natrix helvetica (Barrenringelnatter), so dass Mischformen der beiden Subspecies in dieser Hybridisationszone anzutreffen sind (ECKSTEIN 1993).
Die Ringelnatter bewohnt hauptsächlich feuchte Biotope in Gewässernähe (Seen, Teiche und langsam fließende Flüsse), aber auch weit davon entfernte Wälder, Moorgebiete und Parkanlagen. Voraussetzung für die Besiedlung eines Gebietes ist das Vorhandensein entsprechender Teilhabitate wie Jagdgebiete mit einer ausreichenden Anzahl an Amphibien, geeignete Sonn- und Eiablageplätze, sowie trockene und frostfreie Überwinterungs- und Ruheplätze bzw. Versteckmöglichkeiten. Diese verschiedenen Strukturen werden zwar im Tages- bzw. Jahresverlauf unterschiedlich stark und häufig frequentiert, bilden jedoch die Grundlage für jede lebens- und fortpflanzungsfähige Ringelnatterpopulation.
Die Ringelnatter ist mit Abstand die häufigste Schlangenart im Bundesgebiet.
Das Ziel war es, mehr Informationen zur Ökologie und den Verhaltensweisen dieser Reptilienart zu generieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Untersuchungsgebiet
- 3 Material und Methoden
- 3.1 Künstliche Verstecke
- 3.1.1 Biometrie
- 3.1.2 Geschlecht und Alter
- 3.1.3 Temperaturen
- 3.1.4 Individuelle Identifizierung
- 3.1.5 Ermittlung des Beutespektrums
- 3.1.6 Populationsuntersuchung
- 3.1.6.1 LINCOLN-PETERSEN-Index
- 3.1.6.2 SCHNABEL-Methode
- 3.1.7 Warn- und Abwehrverhalten
- 3.2 Radiotelemetrie
- 3.2.1 Ausrüstung
- 3.2.2 Senderimplantation
- 3.2.3 Versuchstiere
- 3.2.4 Ortung und Datenaufnahme
- 3.2.5 Ermittlung der home ranges
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Fangresultate
- 4.1.1 Fangzahlen des Jahres 2009
- 4.1.2 Temperaturmessungen
- 4.1.3 Effizienz der Untersuchungsmethode
- 4.1.4 Häutung
- 4.1.5 Populationsstruktur
- 4.1.5.1 Altersstruktur und Größenklassen
- 4.1.5.2 Geschlechterverhältnis
- 4.1.6 Populationsuntersuchungen
- 4.1.6.1 Wiederfanghäufigkeit
- 4.1.6.2 Populationsgröße
- 4.1.6.3 Habitatgröße und Bestandsdichte
- 4.1.7 Reproduktionsnachweis
- 4.1.8 Beutespektrum
- 4.1.9 Proaposematische Verhaltensweisen
- 4.2 Radiotelemetrie
- 4.2.1 Habitatnutzung
- 4.2.2 Home ranges
- 4.2.3 Überwinterungsplätze
- 5 Diskussion
- 6 Zusammenfassung
- Anhang A: Aufnahmebögen
- Anhang B: Fotos
- Literaturverzeichnis
- Nutzung von Habitaten und home ranges
- Verhaltensweisen in Stresssituationen
- Gesamtpopulationsgröße
- Nahrungsspektrum
- Thermoregulation und Habitatpräferenzen
- Kapitel 1 stellt die Ringelnatter als Art vor und skizziert die Herausforderungen beim Schutz dieser Tierart. Es wird auf die Gefährdung durch Habitatverlust und die Schwierigkeit der Untersuchung aufgrund ihrer scheuen Lebensweise hingewiesen.
- Kapitel 2 beschreibt das Untersuchungsgebiet, den Davert-Wald, und analysiert die besonderen geografischen, geologischen und klimatischen Bedingungen, die das Gebiet für die Ringelnatter attraktiv machen.
- Kapitel 3 erläutert die angewandten Methoden: Künstliche Verstecke (KV) und Radiotelemetrie. Es werden die Vorgehensweisen bei der Datenaufnahme und -auswertung sowie die verschiedenen Untersuchungsparameter dargestellt.
- Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die Fangresultate, die Temperaturmessungen, die Populationsstruktur, das Geschlechterverhältnis, die Populationsgrößenberechnung sowie das Nahrungsspektrum der Ringelnatter analysiert. Außerdem werden die gewonnenen Daten zur Habitatnutzung und home ranges aus der Radiotelemetrie vorgestellt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht eine Ringelnatterpopulation in Hinblick auf ihre ethologischen und ökologischen Aspekte. Im Fokus der Untersuchung stehen die Nutzung von Habitaten und deren Größe (home ranges), die Verhaltensweisen in Stresssituationen, die Gesamtpopulationsgröße sowie das Nahrungsspektrum der Tiere.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden zentralen Begriffen und Themen: Ringelnatter, Ökoethologie, Habitatnutzung, home ranges, Populationsuntersuchung, Radiotelemetrie, künstliche Verstecke, Verhaltensweisen, Abwehrverhalten, Nahrungsspektrum, Thermoregulation, Erdkröte.
- Arbeit zitieren
- Jan Schulze Esking (Autor:in), 2010, Öko-ethologische Untersuchung einer Ringelnatterpopulation unter Berücksichtigung erster telemetrischer Daten zur Raumnutzung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187989