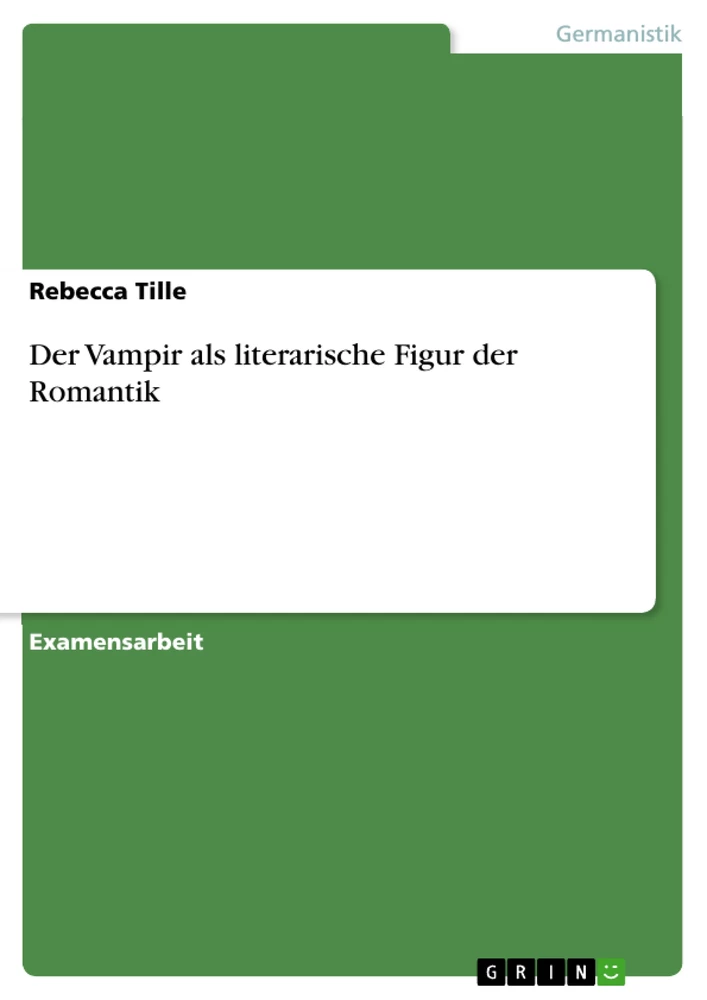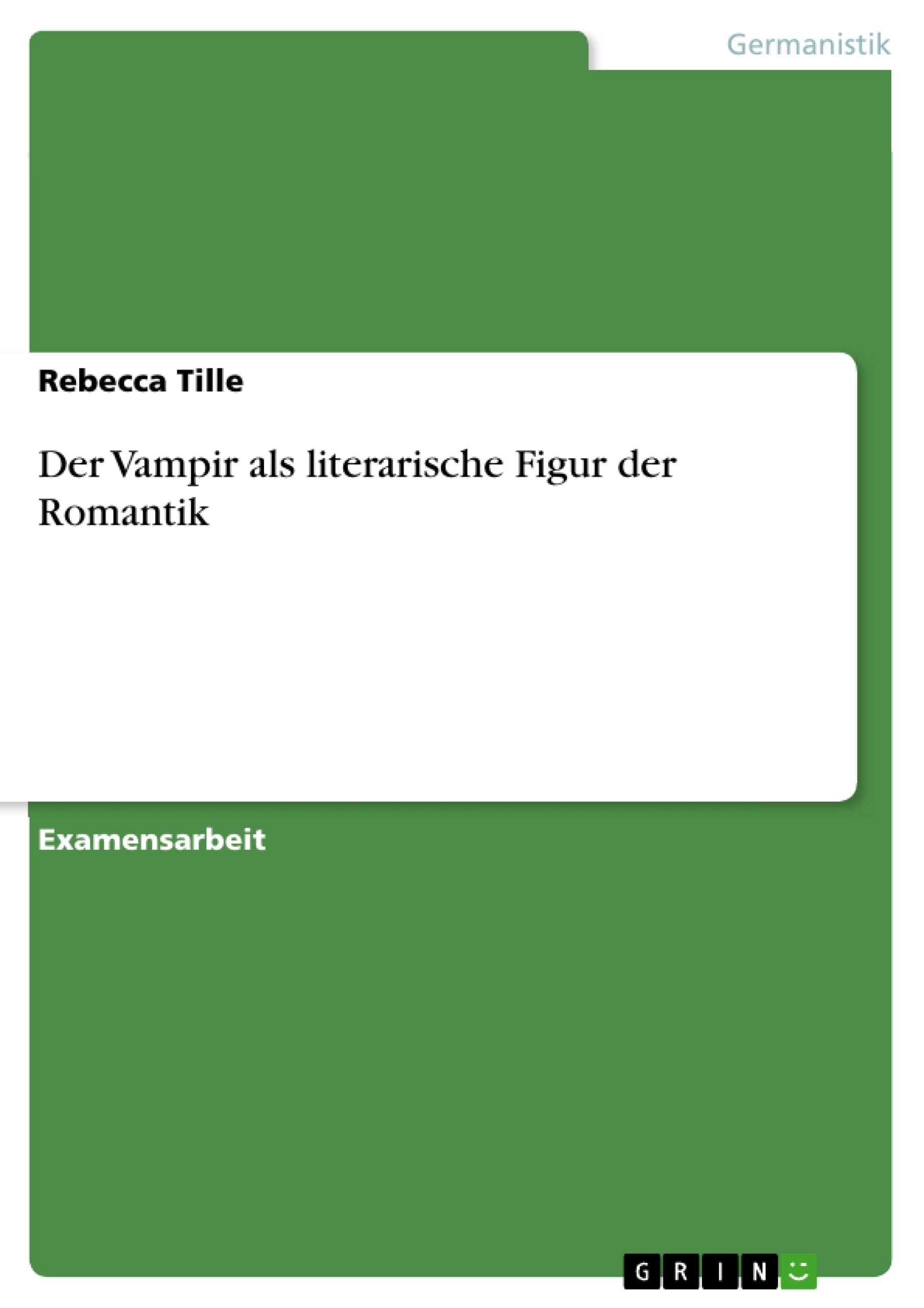„Es ist Nacht. Eine dunkle Gestalt, nur schemenhaft zu erkennen, schleicht sich im Dunkeln unbemerkt an einen Menschen heran. Im Mondlicht kann man nur die spitzen, scharfen Zähne erkennen…“ Unweigerlich handelt es sich hierbei um die Schilderung eines Vampirangriffs. Doch woher stammt diese? Sie könnte aus einer Erzählung eines antiken Geschichtenerzählers aus Homers Zeiten entnommen oder von einem Romanautor des 19. Jahrhunderts verfasst worden sein oder aber gleichfalls aus einem Kinofilm des letzten Sommers hervorgehen. Es treffen viele Möglichkeiten zu, welche die Annahme verstärken, dass das Motiv des Vampirs die Jahrhunderte überdauert hat.
Die Gestalt des blutsaugenden Wiedergängers hat sich zu einem beliebten literarischen Motiv entwickelt. Als angsteinflößendes Monster, erotisches Ungeheuer oder auch bleiche Gestalt, die seine Opfer zähnefletschend verfolgt, wandelt es durch zahlreiche Filme, Gruselgeschichten, Lieder, Comics, Werbungen oder PC-Spiele. Doch worin fundiert sich eine solche Faszination des Vampirmythos? Die Gesellschaft nimmt den Urglauben des Wiedergängers als gegeben hin, doch stellt sich dabei die Frage, was ein Vampir überhaupt ist und wie sich der Glaube an solche Wesen erst entwickeln konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Vampir als Phänomen des Volksglaubens
- 2.1 Definition und Etymologie des Vampirs
- 2.2 Vorläufer und verwandte Phänomene
- 2.3 Die Historie des Vampirmythos
- 2.3.1 Der Ursprung des Vampirglaubens
- 2.3.2 Christliche Einflüsse
- 2.3.3 Die Vampirhysterie und ihre Folgen
- 3. Der literarische Ursprung des Vampirgenres
- 4. Die Behandlung des Vampirstoffs im Zeitalter der Aufklärung
- 5. Die Romantik als Blütezeit des Vampirs
- 5.1 Die Schwarze Romantik und ihre Schauerliteratur
- 5.2 Das Vampirmotiv in der Epoche der Romantik
- 5.3 Die Darstellung der literarischen Vampirfigur im 19. Jahrhundert
- 5.4 Die sexualpsychologische Dimension des Vampirs
- 5.4.1 Der männliche Vampir
- 5.4.2 Der weibliche Vampir
- 6. Eine Suche nach vampiristischen Motiven in Goethes Braut von Korinth
- 6.1 Antike Quellen der Ballade
- 6.2 Der Vampir in der Braut von Korinth
- 6.3 Kontrastierende Interpretationsansätze
- 7. The Vampyre von John William Polidori oder Lord Byron?
- 7.1 Eine schwarzromantische Entstehungsgeschichte
- 7.2 Der byroneske Vampir in Polidoris Erzählung
- 7.3 Der Vampir als gesellschaftskritisches Instrument
- 7.4 Der Vampir in der romantischen Oper
- 8. Der Upyr von Alexej Konstantinowitsch Tolstoi
- 8.1 Analyse des Vampirischen und Unheimlichen in Tolstois Upyr
- 9. Die Entwicklung der Vampirliteratur im 20. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Vampirs als literarische Figur, insbesondere im Kontext der Romantik. Ziel ist es, die Faszination des Vampirmythos zu beleuchten und seine Darstellung in verschiedenen literarischen Werken zu analysieren. Die Arbeit verfolgt dabei einen diachronen Ansatz, der die Entwicklung des Vampirmotivs von seinen volkstümlichen Wurzeln bis in die Romantik nachzeichnet.
- Der Vampir im Volksglauben und seine historische Entwicklung
- Der literarische Ursprung des Vampirgenres und seine Behandlung in der Aufklärung
- Der Vampir in der Romantik als Ausdruck der "Schwarzen Romantik" und seiner gesellschaftlichen Bedeutung
- Die sexualpsychologische Dimension des Vampirs in der Literatur des 19. Jahrhunderts
- Analyse ausgewählter Werke der Romantik (Goethe, Polidori, Tolstoi)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Vampirs als überdauerndes literarisches Motiv ein. Sie stellt die Relevanz des Themas heraus und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Entwicklung des Vampirmotivs von seinen volkstümlichen Ursprüngen bis in die Romantik verfolgt. Die Einleitung hebt die Vielschichtigkeit des Vampirbildes hervor – von angsteinflößendem Monster bis hin zu erotischer Gestalt – und stellt die Frage nach den Gründen für die anhaltende Faszination dieses Mythos.
2. Der Vampir als Phänomen des Volksglaubens: Dieses Kapitel beleuchtet den Vampir aus der Perspektive des Volksglaubens. Es untersucht die Etymologie und Definition des Begriffs „Vampir“, analysiert verwandte Phänomene und zeichnet die historische Entwicklung des Vampirmythos nach. Dabei werden die Ursprünge des Glaubens, christliche Einflüsse und die Folgen der „Vampirhysterie“ beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis für die kulturellen Wurzeln des Mythos zu schaffen. Das Kapitel bildet die Grundlage für das Verständnis der literarischen Adaptionen des Themas.
3. Der literarische Ursprung des Vampirgenres: Kapitel 3 untersucht die frühen literarischen Darstellungen des Vampirmotivs und die Frage nach seinem tatsächlichen Ursprung. Es wird analysiert, ob die antike Dichtung tatsächlich als Ursprung gilt oder ob es bereits früher literarische Werke mit vampirischen Motiven gab. Dieses Kapitel legt den Fokus auf die frühen literarischen Ausprägungen des Motivs und bildet den Übergang zur Betrachtung der Romantik.
4. Die Behandlung des Vampirstoffs im Zeitalter der Aufklärung: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Vampirs in der Aufklärung. Es beleuchtet, wie das Thema in der Belletristik und Wissenschaft behandelt wurde und welche Rolle es in der Gesellschaft spielte. Das Kapitel hebt hervor, dass der Vampir in der Aufklärung im Gegensatz zur Romantik eine untergeordnete Rolle spielte, was für das weitere Verständnis seiner Popularisierung in der Romantik wichtig ist. Die Ausnahme bildet Heinrich August Ossenfelders Gedicht „Der Vampyr“.
5. Die Romantik als Blütezeit des Vampirs: Dieses Kapitel widmet sich der intensiven Auseinandersetzung mit dem Vampirmotiv in der Romantik, insbesondere im Kontext der Schwarzen Romantik. Es beschreibt die Darstellung der literarischen Vampirfigur im 19. Jahrhundert und untersucht die sexualpsychologische Dimension des Vampirs, wobei sowohl männliche als auch weibliche Vampire differenziert betrachtet werden. Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Gründe für den Aufstieg des Vampirs als bedeutendes literarisches Motiv der Epoche.
6. Eine Suche nach vampiristischen Motiven in Goethes Braut von Korinth: Dieses Kapitel analysiert Goethes „Braut von Korinth“ im Hinblick auf vampirische Motive. Es untersucht die antiken Quellen der Ballade und beleuchtet den literaturwissenschaftlichen Diskurs um das vampirische Sujet in diesem Werk. Die unterschiedlichen Interpretationsansätze werden präsentiert und diskutiert.
7. The Vampyre von John William Polidori oder Lord Byron?: Dieses Kapitel befasst sich mit Polidoris „The Vampyre“, beleuchtet seine Entstehungsgeschichte und analysiert das Werk unter gesellschaftskritischen Gesichtspunkten. Es wird der Einfluss des Werkes auf die romantische Oper sowie die Rolle des "byronesken" Vampirs untersucht.
8. Der Upyr von Alexej Konstantinowitsch Tolstoi: Das Kapitel widmet sich Tolstois „Upyr“ und analysiert seine komplexe Erzählweise und das Spiel mit dem vampirischen Thema, welches sich mit Elementen des Horrorgenres vermischt. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Vampirischen und Unheimlichen.
9. Die Entwicklung der Vampirliteratur im 20. Jahrhundert: Kapitel 9 bietet einen Überblick über die Entwicklung der Vampirliteratur im 20. Jahrhundert. Es wird beleuchtet, wie sich die Figur des Vampirs weiterentwickelt hat und welche Rolle er in der Horrorliteratur einnimmt.
Schlüsselwörter
Vampir, Romantik, Schwarze Romantik, Volksglaube, Literaturgeschichte, Vampirmythos, Goethe, Polidori, Tolstoi, Sexualpsychologie, gesellschaftskritische Literatur, Schauerliteratur, literarische Figur.
Häufig gestellte Fragen zu: Entwicklung des Vampirmotivs in der Literatur
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Vampirmotivs in der Literatur, insbesondere im Kontext der Romantik. Sie verfolgt einen diachronen Ansatz, der die Entwicklung des Motivs von seinen volkstümlichen Wurzeln bis in das 20. Jahrhundert nachzeichnet. Die Arbeit analysiert die Darstellung des Vampirs in verschiedenen literarischen Werken und beleuchtet die Faszination des Vampirmythos.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Vampir im Volksglauben und seine historische Entwicklung, den literarischen Ursprung des Vampirgenres und seine Behandlung in der Aufklärung, den Vampir in der Romantik als Ausdruck der "Schwarzen Romantik" und seine gesellschaftliche Bedeutung, die sexualpsychologische Dimension des Vampirs in der Literatur des 19. Jahrhunderts und Analysen ausgewählter Werke der Romantik (Goethe, Polidori, Tolstoi).
Welche Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert unter anderem Goethes „Braut von Korinth“, Polidoris „The Vampyre“ und Tolstois „Upyr“. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung des Vampirmotivs und seiner Interpretation in diesen Werken.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Der Vampir als Phänomen des Volksglaubens, Der literarische Ursprung des Vampirgenres, Die Behandlung des Vampirstoffs im Zeitalter der Aufklärung, Die Romantik als Blütezeit des Vampirs, Eine Suche nach vampiristischen Motiven in Goethes Braut von Korinth, The Vampyre von John William Polidori oder Lord Byron?, Der Upyr von Alexej Konstantinowitsch Tolstoi und Die Entwicklung der Vampirliteratur im 20. Jahrhundert. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Aspekts des Vampirmotivs.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Faszination des Vampirmythos zu beleuchten und seine Darstellung in verschiedenen literarischen Werken zu analysieren. Die Arbeit möchte ein umfassendes Verständnis der Entwicklung und Bedeutung des Vampirmotivs in der Literatur schaffen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Vampir, Romantik, Schwarze Romantik, Volksglaube, Literaturgeschichte, Vampirmythos, Goethe, Polidori, Tolstoi, Sexualpsychologie, gesellschaftskritische Literatur, Schauerliteratur, literarische Figur.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Abschnitts beschreibt.
Welche Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit nimmt einen diachronen Ansatz ein und verfolgt die Entwicklung des Vampirmotivs über verschiedene Epochen und literarische Strömungen hinweg. Sie berücksichtigt dabei sowohl volkstümliche als auch literarische Quellen.
- Quote paper
- Rebecca Tille (Author), 2011, Der Vampir als literarische Figur der Romantik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187356