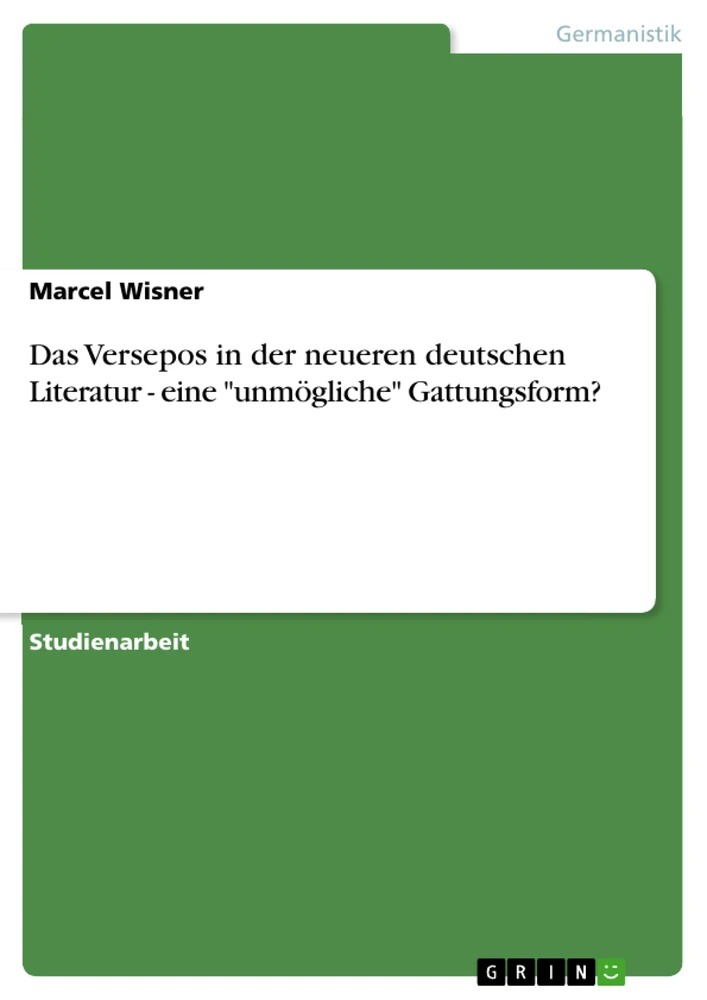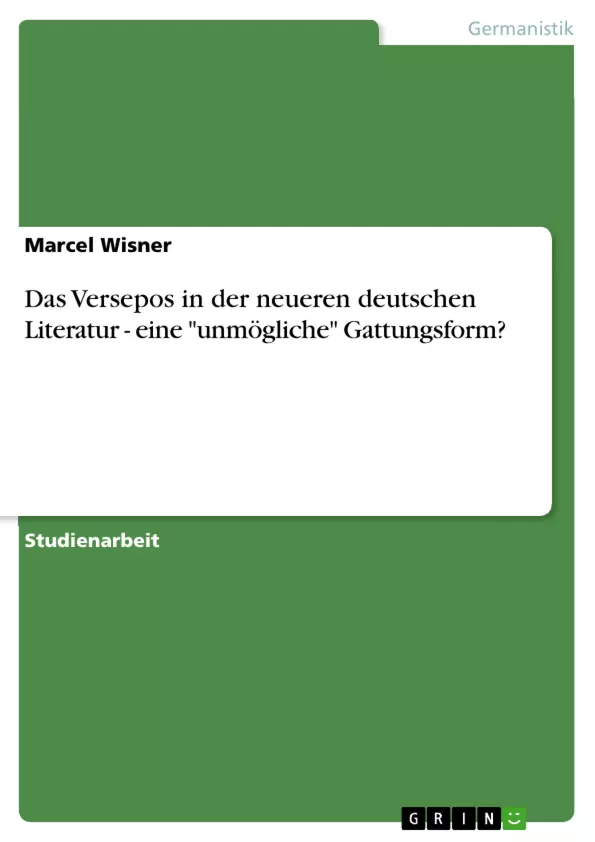Das Versepos, oft als höchste Form literarischen Schaffens bezeichnet, hat in der deutschen
Literatur eine gewisse Sonderstellung inne und stellt den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dar, wobei die Frage nach einer tatsächlichen „Unmöglichkeit“ des hohen Epos im Mittelpunkt der Argumentation stehen soll. Zunächst sollen allgemeine Theorien zum Versepos, insbesondere die Betrachtungen der Philosophen J. G. Sulzer
und G. F. W. Hegel, die sich intensiv mit dieser Gattungform auseinander gesetzt haben, die
Grundlage für eine weitere Bearbeitung bilden. Anschließend sollen vier Versepen der deutschen
Literatur, Wielands Oberon, Goethes Hermann und Dorothea, Heines Atta Troll und von Droste-
Hülshoffs Das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard, in Bezug auf ihre gattungsspezifischen
Eigenheiten untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der „,Charakter des Epischen“ - theoretische Betrachtungen zum Versepos
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- Johann Georg Sulzer
- Die Transposition ins Märchenhafte - Oberon von Christoph Martin Wieland
- Epos vs. Idylle - Goethes Hermann und Dorothea
- Heinrich Heines Atta Troll - ein humoristisches Epos
- Anette von Droste-Hülshoffs Das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard - eine Rückkehr zur Ernsthaftigkeit ?
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Frage, ob das Versepos als eine „unmögliche“ Gattungsform in der neueren deutschen Literatur betrachtet werden kann. Die Autorin analysiert verschiedene Werke des 18. und 19. Jahrhunderts, die sich mit der epischen Tradition auseinandersetzen und zeigt, wie Autoren das Genre in ihre Zeit übertragen. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die gattungsspezifischen Eigenheiten der Werke und beleuchtet, wie die Autoren mit der Tradition des klassischen Epos umgehen.
- Die Sonderstellung des Versepos in der deutschen Literatur
- Theoretische Betrachtungen zum Versepos von Hegel und Sulzer
- Die Adaption des Epos in der neueren deutschen Literatur
- Die Rezeption der antiken Epen in modernen Werken
- Die gattungsspezifischen Eigenheiten des Versepos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Versepos in der neueren deutschen Literatur ein und stellt die Relevanz der Gattung sowie die Problematik ihrer Adaption in der modernen Welt dar. Sie beleuchtet auch die spezifischen Herausforderungen, die sich für die Autoren ergeben, wenn sie die Tradition des Epos fortführen wollen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit theoretischen Betrachtungen zum Versepos und analysiert die Ansichten von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Johann Georg Sulzer. Hegel betrachtet das Epos als Ausdruck eines „Volksgeistes“ und bezweifelt die Möglichkeit eines Epos in der modernen Welt. Sulzer hingegen versucht, die Entstehung von „Heldengedichten“ im Kontext ihrer historischen und gesellschaftlichen Bedingungen zu erklären.
Die Kapitel drei bis sechs analysieren vier Versepen der neueren deutschen Literatur: Wielands Oberon, Goethes Hermann und Dorothea, Heines Atta Troll und von Droste-Hülshoffs Das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard. Jedes Kapitel beleuchtet die gattungsspezifischen Eigenheiten des jeweiligen Epos und setzt es in Bezug zu den theoretischen Ansätzen von Hegel und Sulzer.
Schlüsselwörter
Versepos, deutsche Literatur, Gattungsform, Tradition, Moderne, Hegel, Sulzer, Oberon, Hermann und Dorothea, Atta Troll, Das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard, antike Epen, „Volksgeist“
- Quote paper
- Marcel Wisner (Author), 2011, Das Versepos in der neueren deutschen Literatur - eine "unmögliche" Gattungsform?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/187111