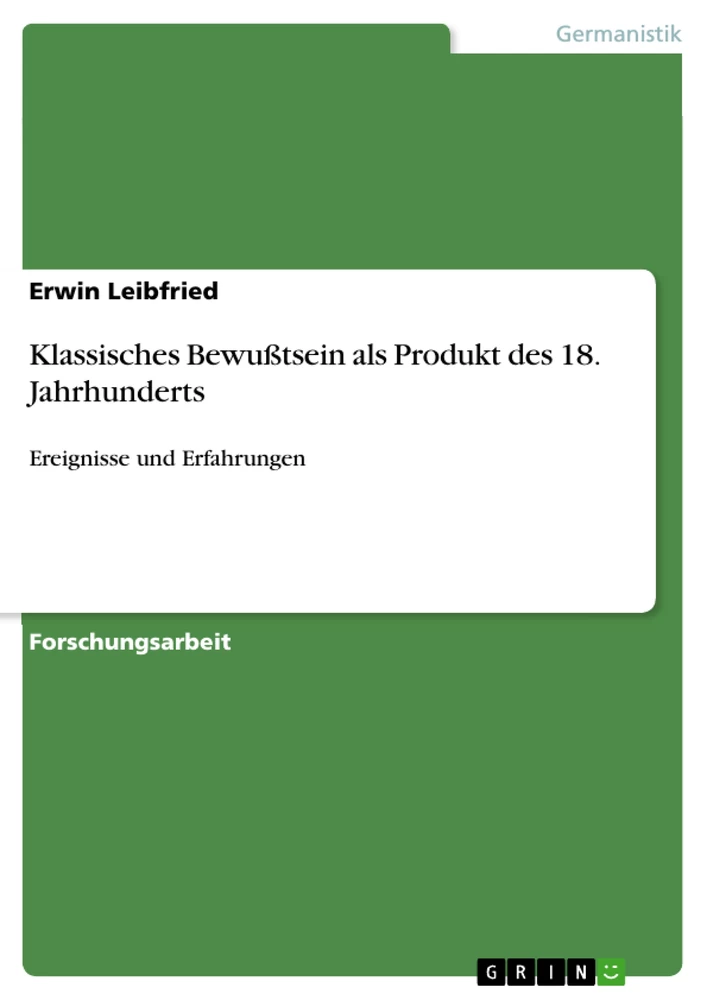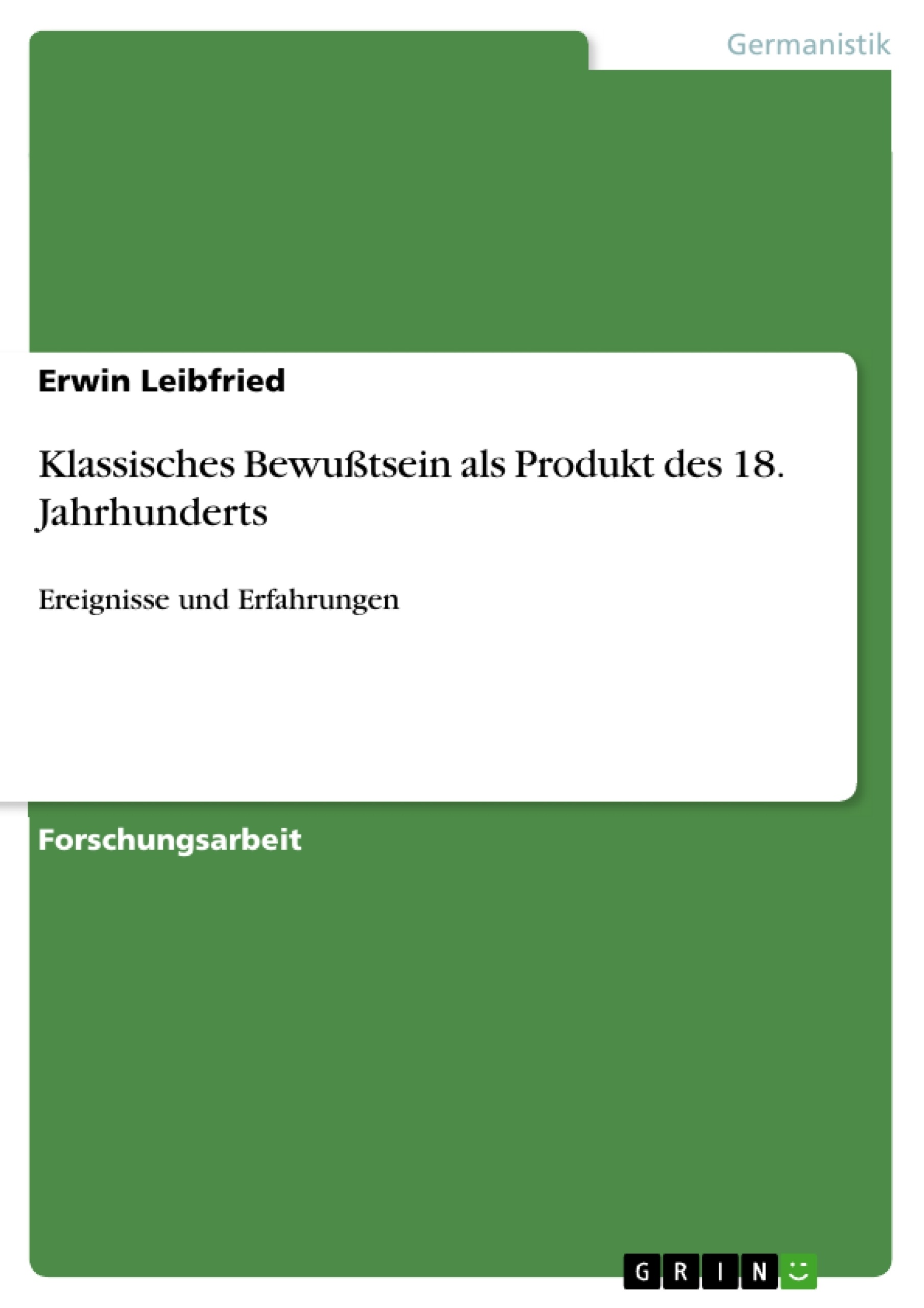Die Arbeit entwickelt die klassische deutsche Literatur aus den Bedingungen des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung. Gezeigt wird, wie bestimmte Ereignisse – etwa das Erdbeben von Lissabon – zu Erfahrungen werden.
Dabei werden immer Strukturhomologien zu unserer Gegenwart deutlich - Lissabon ist Fukushima, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung als Kampt für Freiheit und demokratisch-republikanische Selbstbestimmung findet ihre Parallele in philosophischer Perspektive in dem, was man Arabellion, Arabischen Frühling nennt, als Versuch muslimischer, unterdrückter Menschen demokratische Staatsformen zu verwirklichen.
Im modernen Wutbürger ereignet sich mental das, was im 128. Jahrhundert als Prozeß der Moral gegen den Staat inszeniert wird. Die Vergangenheit kann und muß als nicht vergangen erkannt werden, ihre Probleme sind, verkleidet, noch immer unsere.
Inhaltsverzeichnis
- Notwendigkeit
- Klassik als historische Epoche
- Der Bürger und der Staat
- Das Ziel des aufklärerisch-klassischen Programms
- Die beiden Problemfelder
- Dichter und Umwelt
- Literatur als Ausdruck und als Antipode ihrer Zeit
- Schiller - zentrale Strukturen eines klassischen Bewußtseins
- Wahrheit in der Poesie
- Rolle der Frau
- Opposionen
- Schiller Lob und Tadel
- Sinnvoll konzeptualisiert ergibt sich die Deutsche oder Weimarer Klassik als Produkt des 18. Jahrhunderts
- Die Zerstörung von Lissabon durch das Erdbeben (1755)
- Die amerikanischeUnabhängigkeitserklärung (1776)
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die klassische deutsche Literatur im Kontext des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung. Sie analysiert, wie bestimmte Ereignisse, wie das Erdbeben von Lissabon, zu prägenden Erfahrungen wurden und wie diese Erfahrungen die Denkweise der Klassiker beeinflussten. Die Arbeit zeigt auch die Relevanz dieser Erfahrungen für die Gegenwart auf, indem sie Parallelen zu aktuellen Ereignissen und Problemen zieht.
- Die Entstehung des klassischen Bewußtseins im 18. Jahrhundert
- Die Rolle von Ereignissen und Erfahrungen in der Literatur
- Die Bedeutung der Aufklärung für die deutsche Klassik
- Die Beziehung zwischen Literatur und Gesellschaft
- Die Herausforderungen der modernen Welt im Spiegel der klassischen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit einer geschichtsphilosophischen Interpretation der deutschen Klassik. Es werden drei zentrale Ereignisse des 18. Jahrhunderts - das Erdbeben von Lissabon, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Französische Revolution - als prägende Erfahrungen für die Klassiker vorgestellt.
Das zweite Kapitel analysiert die Rolle des Bürgertums und des Staates in der deutschen Klassik. Es wird die Entwicklung einer bürgerlichen Moral gegen den feudalabsolutistischen Staat und die Bedeutung der bürgerlichen Öffentlichkeit für die Kritik an der Politik dargestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Ziel des aufklärerisch-klassischen Programms, das auf das mundane Glück des Einzelnen ausgerichtet war. Es werden die Geschichtsauffassungen von Schiller und Kant sowie die Bedeutung der Natur und der Gesellschaft für die Klassiker beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die subjektiven Erfahrungen der Klassiker, insbesondere Goethes Erfahrungen als Weimarer Verwaltungsbeamter und Schillers Erfahrungen mit repressiver Erziehung, Geldnot und Krankheit.
Das fünfte Kapitel analysiert die Beziehung zwischen den Dichtern und ihrer Umwelt, insbesondere die Rolle des Bürgertums und des Adels. Es wird Schillers Haltung gegenüber dem Fürsten als Vaterfigur dargestellt.
Das sechste Kapitel befasst sich mit der Literatur als Ausdruck und Antipode ihrer Zeit. Es werden die Aversion der Fürsten gegen die neuere Literatur, die Übermacht der Prosa, die Separation der Kunst von der Wirklichkeit und die kritische Funktion der Literatur diskutiert.
Das siebte Kapitel analysiert Schillers zentrale Strukturen eines klassischen Bewußtseins. Es werden die Themen Wahrheit in der Poesie, die Rolle der Frau, die Oppositionen zwischen Geschichte und Barbarei sowie Schillers Lob und Tadel untersucht.
Das achte Kapitel beleuchtet die Entstehung der deutschen oder Weimarer Klassik als Produkt des 18. Jahrhunderts. Es wird die Überwindung der rationalistischen Aufklärung, der Anakreontik, des Rokoko, der Empfindsamkeit, des Sturm und Drang und der Frühformen der Romantik dargestellt.
Das neunte Kapitel analysiert die Zerstörung von Lissabon durch das Erdbeben von 1755 als ein Ereignis, das den aufklärerischen Optimismus erschütterte und die Natur als feindlich erkannte. Es wird die Reaktion von Kant und Goethe auf das Erdbeben sowie die Bedeutung dieses Ereignisses für die Entwicklung der Naturwissenschaften dargestellt.
Das zehnte Kapitel befasst sich mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 als ein Ereignis, das die deutsche Klassik beeinflusste. Es werden die Reaktionen von Goethe und Schiller auf die amerikanische Revolution sowie die Bedeutung dieses Ereignisses für die Entwicklung des Nationalismus dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die deutsche Klassik, das 18. Jahrhundert, die Aufklärung, das Erdbeben von Lissabon, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die Französische Revolution, die Rolle des Bürgertums, die bürgerliche Moral, die bürgerliche Öffentlichkeit, die Natur, die Gesellschaft, die subjektiven Erfahrungen der Klassiker, die Literatur als Ausdruck und Antipode ihrer Zeit, die kritische Funktion der Literatur, Schillers zentrale Strukturen eines klassischen Bewußtseins, die Wahrheit in der Poesie, die Rolle der Frau, die Oppositionen zwischen Geschichte und Barbarei, Schillers Lob und Tadel, die Überwindung der rationalistischen Aufklärung, die Empfindsamkeit, der Sturm und Drang, die Frühformen der Romantik, die Entwicklung des Nationalismus.
- Arbeit zitieren
- Prof. Dr. Erwin Leibfried (Autor:in), 1985, Klassisches Bewußtsein als Produkt des 18. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/184860