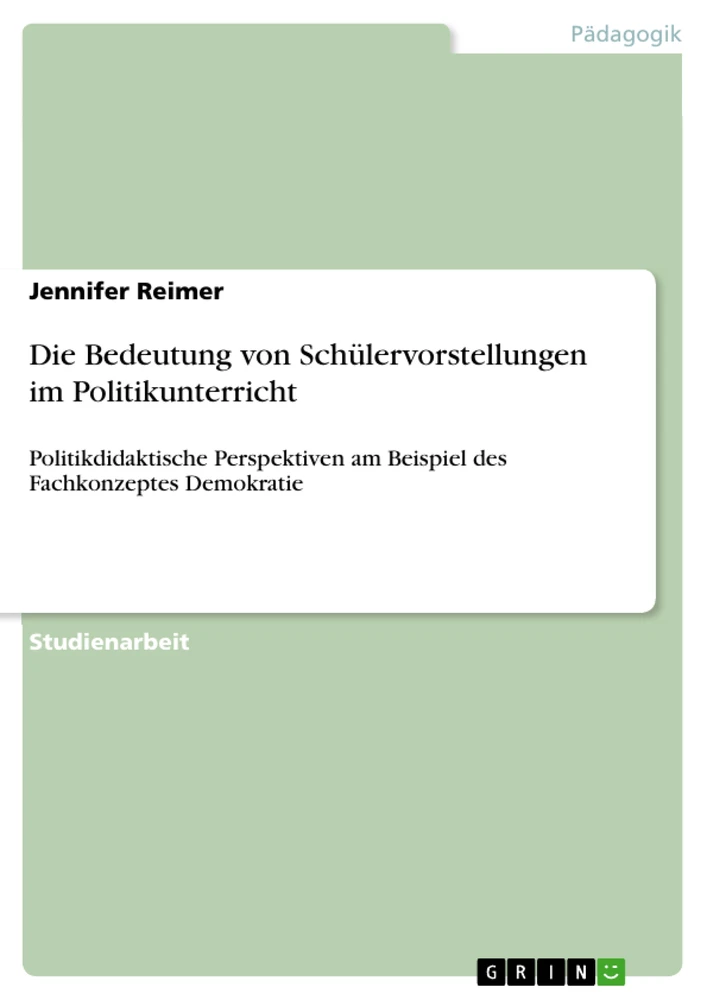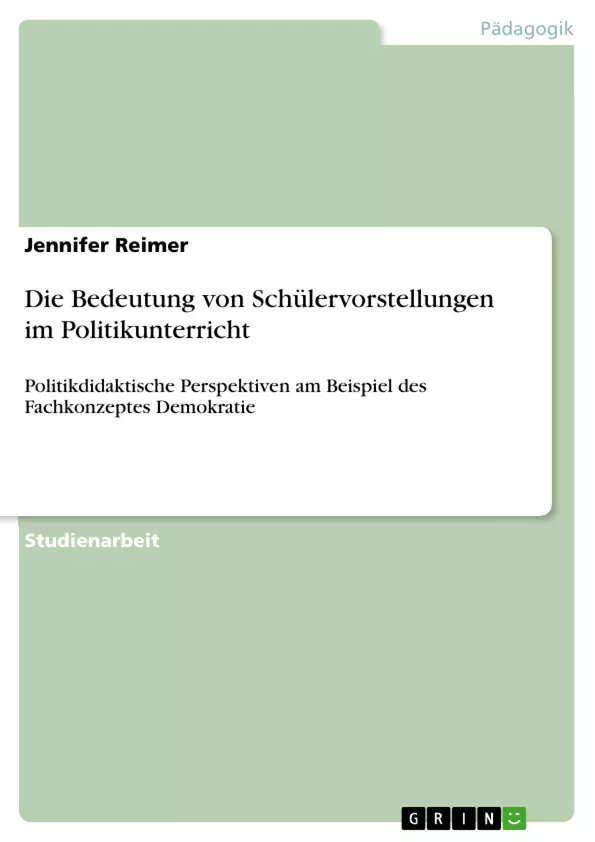1. Einleitung
Der aktuelle Politikunterricht zielt auf soziales und politisches Lernen ab. Es gehört zum Prozess der Sozialisation und „[...] der Einführung von Kindern in die kulturellen Selbstverständlichkeiten einer Gesellschaft [...]“ Werthaltungen, Einstellungen und Überzeugungen zu betrachten, die für eine politische Sozialisation nötig sind. Die Grundintension ist, dass ein Verständnis von Demokratie entsteht und die Lernenden zu mündigen Bürgern erzogen werden. Es ist entscheidend, dass im Unterricht demokratische Grundlagen geschaffen werden, die die Schüler und Schülerinnen in ihrem gesellschaftlichen Alltag gebrauchen können.
Lernende bringen eine Reihe von Konzepten und Vorstellungen mit in den Unterricht. Die Berücksichtigung der Lebens- und Verständniswelten der Schüler und Schülerinnen können in den Politikunterricht integriert werden und sollen dabei helfen, das Verständnis von Politik und Demokratie zu fördern.
Hauptziel dieser Hausarbeit ist, zu analysieren, wie Schülervorstellungen erfasst werden können und welche Rolle sie für den langfristigen Lernerfolg spielen.
Zunächst werden allgemeine Ziele des Politikunterrichts und politikdidaktische Konzeptionen erläutert, um die Aufgaben und das Verständnis vom politischen Lernen zusammenzufassen. Danach wird es einen Überblick über die Inhalte von Basiskonzepten und Fachkonzepten geben, um danach auf das Fachkonzept Demokratie einzugehen, das im späteren Verlauf der Arbeit auf das Anwendungsbeispiel zur Erfassung von Schülervorstellungen bezogen wird. Im Hauptteil dieser Arbeit wird es zunächst darum gehen, welche Bedeutung Schülervorstellungen (in Bezug auf das Fachkonzept Demokratie) für den Lernerfolg im Unterricht haben und welche Rolle sie für die Planung von Unterricht darstellen. Als Anwendungsbeispiel wird das Modell der Didaktischen Rekonstruktion auszughaft vorgestellt, um eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie die Vorstellungen und Konzepte von Lernenden mit den Curricula des Politikunterrichts verknüpft werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Allgemeine Ziele des Politikunterrichts
- 2.2. Politikdidaktische Konzeptionen
- 2.3. Basiskonzepte und Fachkonzepte des politischen Unterrichts
- 2.4. Das Fachkonzept Demokratie
- 3. Didaktische Perspektiven: Was bedeuten die lebensweltlichen Schülervorstellungen (in Bezug auf „Demokratie“) für die Planung von Unterricht?
- 4. Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion zur Erfassung und Verarbeitung von Schülervorstellungen
- 5. Anwendungsbeispiel: Wie Schülervorstellungen für den Unterricht erfasst werden und verwendet werden können für das Fachkonzept Demokratie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung von Schülervorstellungen im Politikunterricht, insbesondere im Hinblick auf das Fachkonzept Demokratie. Es wird untersucht, wie Schülervorstellungen erfasst und in den Unterricht integriert werden können, um den Lernerfolg zu optimieren.
- Allgemeine Ziele des Politikunterrichts und die Förderung von Mündigkeit
- Politikdidaktische Konzeptionen und ihre Relevanz für die Gestaltung von Unterricht
- Die Rolle von Basiskonzepten und Fachkonzepten im Politikunterricht, insbesondere des Fachkonzepts Demokratie
- Die Bedeutung von Schülervorstellungen für das Verständnis von Demokratie und die Planung von Unterricht
- Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als Beispiel für die Integration von Schülervorstellungen in den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von politischer Sozialisation im Kontext des aktuellen Politikunterrichts. Sie stellt die zentrale Frage nach der Rolle von Schülervorstellungen für den Lernerfolg im Politikunterricht.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen des Politikunterrichts behandelt. Es werden die allgemeinen Ziele des Politikunterrichts und politikdidaktische Konzeptionen erläutert. Darüber hinaus wird ein Überblick über Basiskonzepte und Fachkonzepte im politischen Unterricht gegeben, wobei das Fachkonzept Demokratie besonders hervorgehoben wird.
- Kapitel 3: Didaktische Perspektiven: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Schülervorstellungen für die Planung von Unterricht untersucht. Es wird die Frage gestellt, welche Rolle die Lebenswelten und Vorstellungen von Schülern für das Verständnis von Demokratie im Politikunterricht spielen.
- Kapitel 4: Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion: Dieses Kapitel stellt das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als ein Werkzeug zur Erfassung und Verarbeitung von Schülervorstellungen vor. Es wird gezeigt, wie dieses Modell die Verknüpfung von Lernendenvorstellungen mit den Curricula des Politikunterrichts ermöglicht.
- Kapitel 5: Anwendungsbeispiel: In diesem Kapitel wird anhand eines konkreten Beispiels gezeigt, wie Schülervorstellungen für den Unterricht erfasst werden und wie sie für das Fachkonzept Demokratie genutzt werden können.
Schlüsselwörter
Politikunterricht, politische Sozialisation, Schülervorstellungen, Demokratie, Fachkonzept, Didaktische Rekonstruktion, Lernziele, Politikdidaktik, Kompetenzen, Unterricht, Methoden, Medien
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Schülervorstellungen im Politikunterricht wichtig?
Schüler bringen eigene Konzepte und Lebenswelten mit. Diese zu berücksichtigen, fördert das Verständnis von Demokratie und sichert den langfristigen Lernerfolg.
Was ist das Modell der Didaktischen Rekonstruktion?
Es ist ein wissenschaftliches Modell, das Schülervorstellungen erfasst und systematisch mit den fachlichen Inhalten der Curricula verknüpft.
Was sind Basiskonzepte und Fachkonzepte im Politikunterricht?
Dies sind strukturierende Lerninhalte, die politisches Wissen ordnen. Ein zentrales Fachkonzept in dieser Arbeit ist die "Demokratie".
Wie trägt Politikunterricht zur politischen Sozialisation bei?
Er führt Kinder in kulturelle Selbstverständlichkeiten ein und fördert Werthaltungen, die für die Erziehung zu mündigen Bürgern notwendig sind.
Wie können Lehrer Schülervorstellungen konkret erfassen?
Die Arbeit zeigt am Anwendungsbeispiel "Demokratie", wie Vorstellungen durch gezielte Methoden erhoben und für die Unterrichtsplanung genutzt werden können.
- Quote paper
- Jennifer Reimer (Author), 2011, Die Bedeutung von Schülervorstellungen im Politikunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/183653