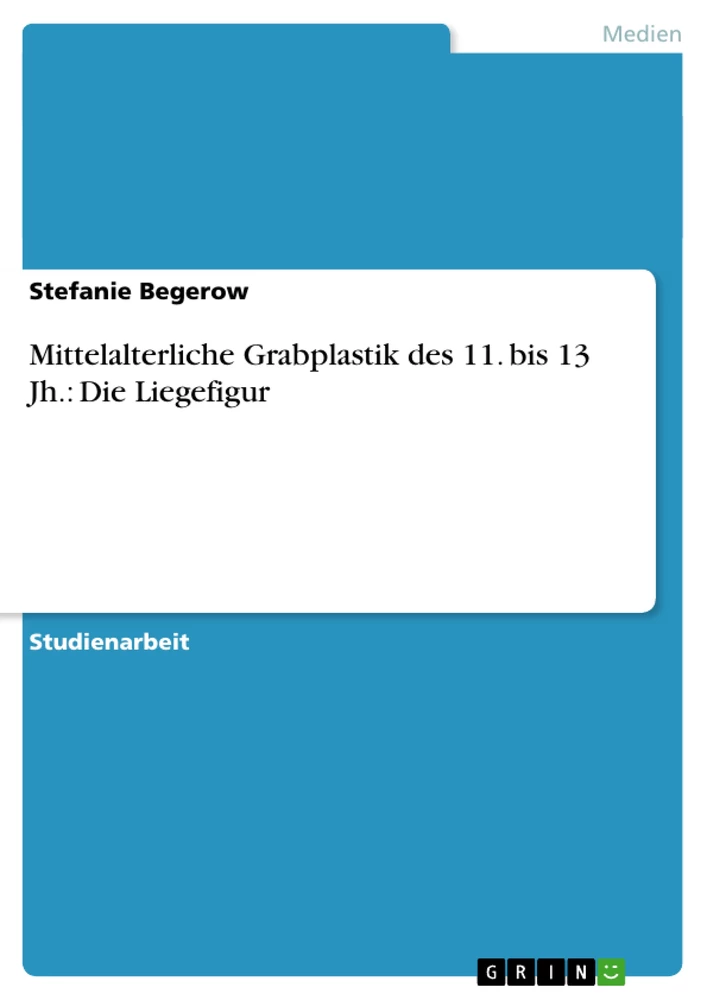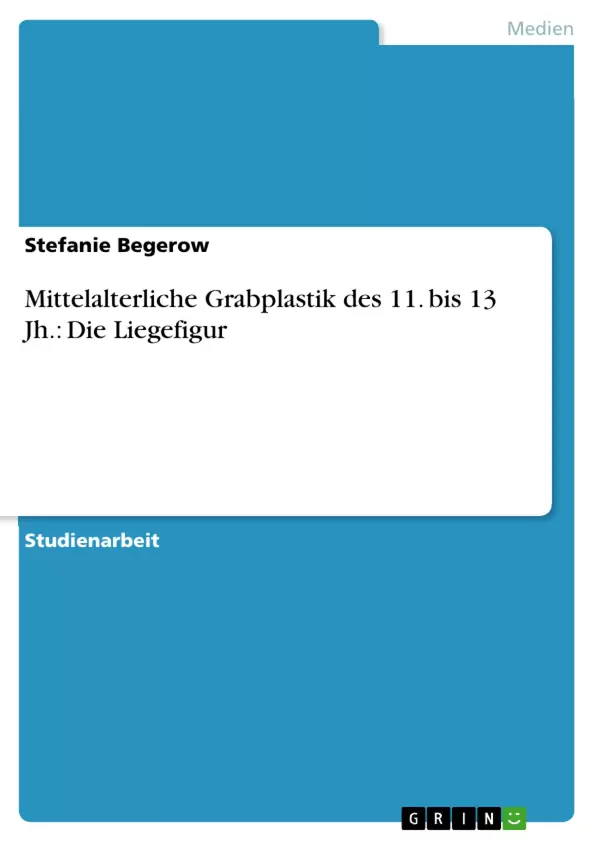„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! […]“ (Ex 20,4-20,5)
Im frühen Mittelalter wurde das zweite Gebot des Alten Testaments als Verurteilung der heidnischen Götzenanbetung gesehen, damit einher ging eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Ablehnung naturalistischer, vor allem plastischer Darstellungen des menschlichen Körpers . Ab dem späten 11. Jh. vollzog sich jedoch ein Wandel dieses Verständnisses, der nicht zuletzt in der neuartigen Verwendung der Grabplastik, zum Ausdruck kam . In vielen Kirchen Europas wurden Grabplatten mit dem Abbild des Verstorbenen horizontal, teilweise direkt über seiner eigentlichen Begräbnisstätte, angebracht. Diese in etwa lebensgroßen Liegefiguren werfen für die moderne Forschung ganz neue Fragen nach den Vorstellungen der Menschen in der Zeit des Mittelalters auf, besonders in Bezug auf das Verständnis von Tod und Jenseits. Mit den lebensgroßen Liegefiguren konnten geistliche und weltliche Herrscher sich ein Andenken für die Ewigkeit schaffen, welches sie bis in die heutige Zeit gegenwärtig scheinen lässt. Besucht ein Mensch des 21. Jh. beispielsweise den Braunschweiger Dom, wird ihm kaum das Grabmal Heinrichs des Löwen entgehen, im besten Fall hat er nun die Person Heinrichs in seinem Gedächtnis verewigt. Ohne das steinerne Bildnis auf der Grabplatte wäre das kaum denkbar.
Nach einer kurzen Ausführung über die Entstehung der Liegefigur, möchte ich die Entwicklung vom 11. bis zum 13. Jh. anhand von vier bezeichnenden Grabmälern nachzeichnen und anschließend erläutern, welche Konflikte sich daraus in kunstgeschichtlicher Hinsicht ergeben, sowie, inwiefern diese mit den im Mittelalter vorherrschenden Vorstellungen des irdischen und jenseitigen Lebens zu klären sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Ursprünge
- Der Weg zur Grabplatte
- Vom Relief zur Skulptur
- Vorbilder der Liegefigur
- Darstellungsformen
- Rudolf von Schwaben im Merseburger Dom
- Friedrich von Wettin
- Heinrich der Löwe
- Siegried III. von Eppstein
- Formkonflikte und Jenseitsvorstellungen
- Was bleibt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung der mittelalterlichen Grabplastik vom 11. bis 13. Jahrhundert, fokussiert auf die Liegefigur. Ziel ist es, die Entstehung dieser Kunstform nachzuvollziehen, verschiedene Darstellungsformen zu analysieren und die damit verbundenen kunstgeschichtlichen Konflikte sowie die zugrundeliegenden Jenseitsvorstellungen zu erörtern.
- Entstehung und Entwicklung der Liegefigur
- Analyse verschiedener Darstellungsformen anhand ausgewählter Beispiele
- Kunstgeschichtliche Konflikte im Zusammenhang mit der Grabplastik
- Mittelalterliche Jenseitsvorstellungen und ihre Reflexion in der Kunst
- Die Bedeutung der Liegefigur als Andenken und ihre Wirkung bis in die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Bedeutung der Grabplastik im Kontext mittelalterlicher Jenseitsvorstellungen dar. Der Abschnitt "Entstehung und Ursprünge" beleuchtet den Weg von der Tumba zur Grabplatte und die Entwicklung von Reliefs zu figürlichen Skulpturen. Es werden verschiedene Theorien zu den Vorbildern der Liegefigur diskutiert. Der Abschnitt "Darstellungsformen" analysiert ausgewählte Beispiele mittelalterlicher Grabmale. Der Abschnitt "Formkonflikte und Jenseitsvorstellungen" befasst sich mit den kunstgeschichtlichen Herausforderungen und den religiösen Überzeugungen, die die Gestaltung der Liegefiguren beeinflussten.
Schlüsselwörter
Mittelalterliche Grabplastik, Liegefigur, Jenseitsvorstellungen, Kunstgeschichte, Grabmal, Reliefskulptur, Rudolf von Schwaben, Heinrich der Löwe, Formkonflikte, Bildnis, Gottesvorstellung.
- Quote paper
- Stefanie Begerow (Author), 2010, Mittelalterliche Grabplastik des 11. bis 13 Jh.: Die Liegefigur, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/182771