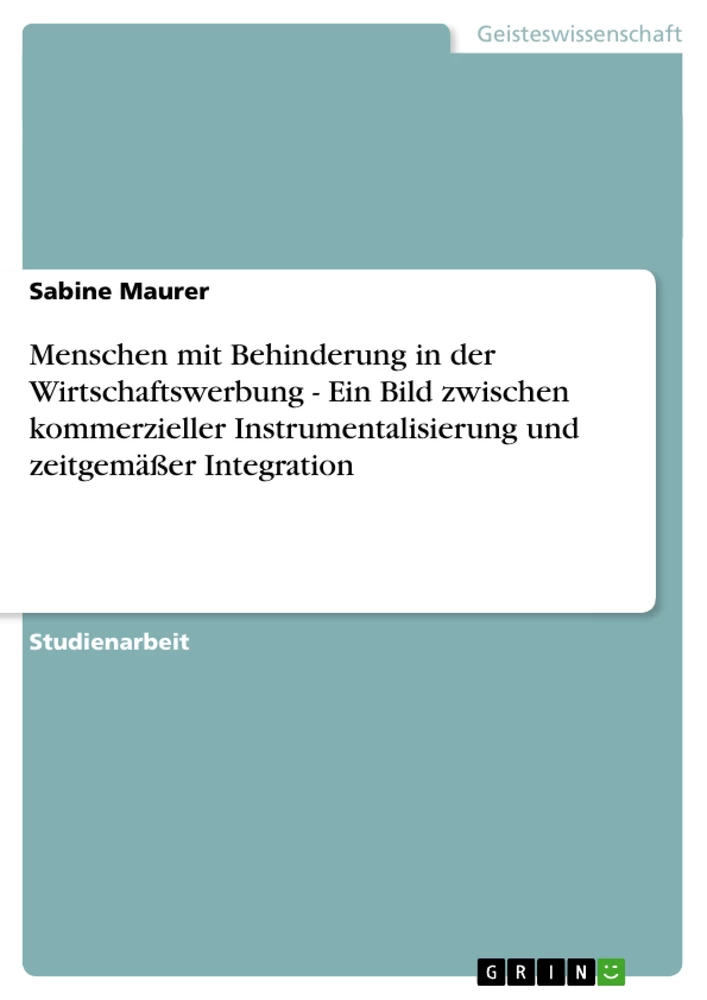- M e n s c h e n m i t B e h i n d e r u n g i n d e r W e r b u n g -Sich mit dem Bild behinderter Menschen in der Werbung zu befassen, ist im ersten Schritt nicht ganz leicht: Zunächst einmal müssen behinderte Menschen in der Werbung gefunden werden.
Da gibt es zum einen natürlich zahlreiche Körperschaften und Vereine in Deutschland wie z.B. die Lebenshilfe oder die Aktion Mensch, die sich für die Interessen behinderter Menschen einsetzen und für ihre Arbeit meist in Verbindung mit Spendenaufrufen auch werben.
Zum anderen sind da die Hersteller von Hilfsmitteln, die Behinderte als Zielgruppe anvisieren, und jüngst startete darüber hinaus beispielsweise das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung die Werbe-Aktion ´50.000 Jobs für Schwerbehinderte`. Die Werbekampagnen dieser Organisationen haben gemeinsam, dass es ihnen tatsächlich um die Belange behinderter Personen geht: Entweder sind Behinderte selbst die Adressaten der Reklame oder aber Menschen, die sich mit Behinderten konkret beschäftigen beziehungsweise ihren Beitrag zur Behindertenarbeit mittels Spenden oder sonstiger Hilfen leisten möchten.
Die Einbeziehung behinderter Menschen in die alltägliche Wirtschaftswerbung ist allerdings eher unüblich und durch ihre Seltenheit etwas Besonderes: Bei meinen Recherchen für diese Arbeit bin ich auf nur zwölf Wirtschaftswerbungen gestoßen, die sich in den letzten zwanzig Jahren die Darbietung behinderter Menschen bzw. das Aufgreifen des Themas Behinderung zu Nutzen gemacht haben. Acht davon wurden von deutschen Unternehmen hervorgebracht. Angesichts der Werbeüberfrachtung in unserer Gesellschaft ist dies eine nahezu unbedeutende Anzahl. Die Darstellungsweisen behinderter Menschen in der Wirtschaftswerbung unterscheiden sich zwar in ihrer Gestaltung, sie beachten jedoch in der Regel die klassischen Beeinflussungsstrategien von Reklame. Werbung mit behinderten Menschen im Bezug auf soziologische Kriterien betrachtet, zeigt oftmals deutliche Kontraste zum Selbstbild Betroffener und steht in einigen Fällen in erkennbarem Gegensatz zum Integrationsgedanken.
Inhaltsverzeichnis
- Menschen mit Behinderung in der Werbung
- 'Lieber zeckengeimpft als gehirngeschädigt' Zu den Werbebildern der 1981er-Kampagne der Österreichischen Apothekenkammer
- 'Die Sonnenblumen' - Models des Herrn Toscani Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der 1998er-Kampagne der italienischen Modefirma Benetton
- Werbung für alle, mit allen
- Hinweise zu den Quellenangaben
- Quellenangaben
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Wirtschaftswerbung. Ziel ist es, die verschiedenen Darstellungsweisen zu analysieren und diese im Hinblick auf kommerzielle Instrumentalisierung und zeitgemäße Integration zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet sowohl positive als auch negative Beispiele aus der Werbepraxis.
- Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Werbung
- Kommerzielle Instrumentalisierung von Behinderung
- Integration von Menschen mit Behinderung in der Werbung
- Analyse von Werbekampagnen
- Soziologische Betrachtung der Werbebotschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Menschen mit Behinderung in der Werbung: Der einleitende Abschnitt untersucht die Präsenz von Menschen mit Behinderung in der Werbung. Es wird festgestellt, dass die Einbeziehung behinderter Menschen in die alltägliche Wirtschaftswerbung selten ist. Die Arbeit konzentriert sich auf zwölf Wirtschaftswerbungen der letzten zwanzig Jahre, wobei acht von deutschen Unternehmen stammen. Es wird darauf hingewiesen, dass die wenigen Beispiele die klassischen Beeinflussungsstrategien der Werbung nutzen, jedoch oft Kontraste zum Selbstbild Betroffener und zum Integrationsgedanken aufzeigen.
'Lieber zeckengeimpft als gehirngeschädigt' Zu den Werbebildern der 1981er-Kampagne der Österreichischen Apothekenkammer: Dieses Kapitel analysiert die 1981er Kampagne der Österreichischen Apothekenkammer mit dem Slogan "Lieber zeckengeimpft als gehirngeschädigt". Die Kampagne nutzte schockierende Bilder, um die Notwendigkeit der Zeckenimpfung zu verdeutlichen, wobei die Assoziation mit Behinderung als negative Konsequenz von Zeckenbissen eingesetzt wurde. Die hohe Dramaturgie der Kampagne wird hervorgehoben, aber auch die Gefahr, dass der negative emotionale Appell beim Betrachter zu einer Abneigung gegen das beworbene Produkt (die Impfung) führt, diskutiert. Die Kampagne wird kritisch im Kontext der Darstellung von Behinderung betrachtet.
'Die Sonnenblumen' - Models des Herrn Toscani Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der 1998er-Kampagne der italienischen Modefirma Benetton: (Anmerkung: Da der Text nur Bruchstücke der Beschreibung dieser Kampagne enthält, kann hier nur eine sehr allgemeine Zusammenfassung gegeben werden). Dieses Kapitel stellt die Benetton-Kampagne "Die Sonnenblumen" als Gegenbeispiel zur vorherigen Kampagne dar. Sie repräsentiert eine positive und integrative Darstellung von Menschen mit Behinderung. Im Gegensatz zur negativen Kampagne wird hier die inklusive Darstellung von Behinderung im Kontext der Werbung beleuchtet und im Vergleich zu der vorherigen Kampagne analysiert. Die genauen Aspekte dieser Kampagne und deren Auswirkungen werden aufgrund des fehlenden Textes nicht weiter detailliert.
Schlüsselwörter
Menschen mit Behinderung, Wirtschaftswerbung, Integrationsgedanken, Werbekampagnen, Negative und positive Darstellung, Kommerzielle Instrumentalisierung, Soziologische Analyse, Behinderung, Reklame, Marketing.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Werbung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Wirtschaftswerbung. Sie untersucht verschiedene Darstellungsweisen und bewertet diese hinsichtlich kommerzieller Instrumentalisierung und zeitgemäßer Integration. Sowohl positive als auch negative Beispiele aus der Werbepraxis werden beleuchtet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Darstellungsweisen von Menschen mit Behinderung in der Werbung zu analysieren und im Hinblick auf kommerzielle Ausnutzung und die Frage der zeitgemäßen Integration zu bewerten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Werbung, die kommerzielle Instrumentalisierung von Behinderung, die Integration von Menschen mit Behinderung in der Werbung, die Analyse von Werbekampagnen und eine soziologische Betrachtung der Werbebotschaften.
Welche Werbekampagnen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert im Detail zwei Kampagnen: Die 1981er Kampagne der Österreichischen Apothekenkammer mit dem Slogan "Lieber zeckengeimpft als gehirngeschädigt" und die 1998er Benetton-Kampagne "Die Sonnenblumen". Zusätzlich werden weitere, nicht näher spezifizierte Beispiele aus den letzten zwanzig Jahren untersucht.
Wie wird die Kampagne der Österreichischen Apothekenkammer bewertet?
Die Kampagne wird kritisch bewertet. Die Arbeit hebt die schockierende Bildsprache und die dramaturgische Gestaltung hervor, betont aber gleichzeitig die Gefahr einer Abneigung gegen das beworbene Produkt aufgrund des negativen emotionalen Appells und die problematische Darstellung von Behinderung.
Wie wird die Benetton-Kampagne "Die Sonnenblumen" bewertet?
Im Gegensatz zur Kampagne der Österreichischen Apothekenkammer wird die Benetton-Kampagne als positives Beispiel für eine integrative Darstellung von Menschen mit Behinderung dargestellt. Aufgrund unvollständiger Textinformationen wird die Kampagne jedoch nur oberflächlich zusammengefasst.
Wie viele Werbeanzeigen werden insgesamt untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwölf Wirtschaftswerbungen der letzten zwanzig Jahre, wobei acht von deutschen Unternehmen stammen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt, dass die Einbeziehung behinderter Menschen in die alltägliche Wirtschaftswerbung selten ist. Die wenigen Beispiele nutzen klassische Beeinflussungsstrategien, weisen aber oft Kontraste zum Selbstbild Betroffener und zum Integrationsgedanken auf. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer sensibleren und integrativeren Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Werbung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Menschen mit Behinderung, Wirtschaftswerbung, Integrationsgedanken, Werbekampagnen, Negative und positive Darstellung, Kommerzielle Instrumentalisierung, Soziologische Analyse, Behinderung, Reklame, Marketing.
- Arbeit zitieren
- Sabine Maurer (Autor:in), 2003, Menschen mit Behinderung in der Wirtschaftswerbung - Ein Bild zwischen kommerzieller Instrumentalisierung und zeitgemäßer Integration, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/18189