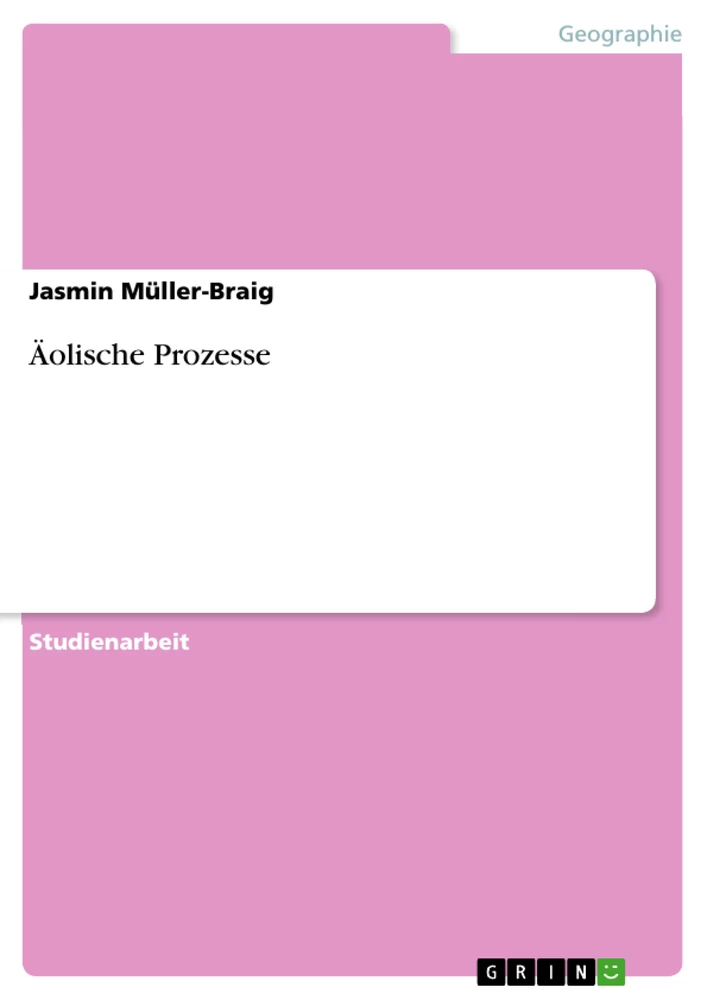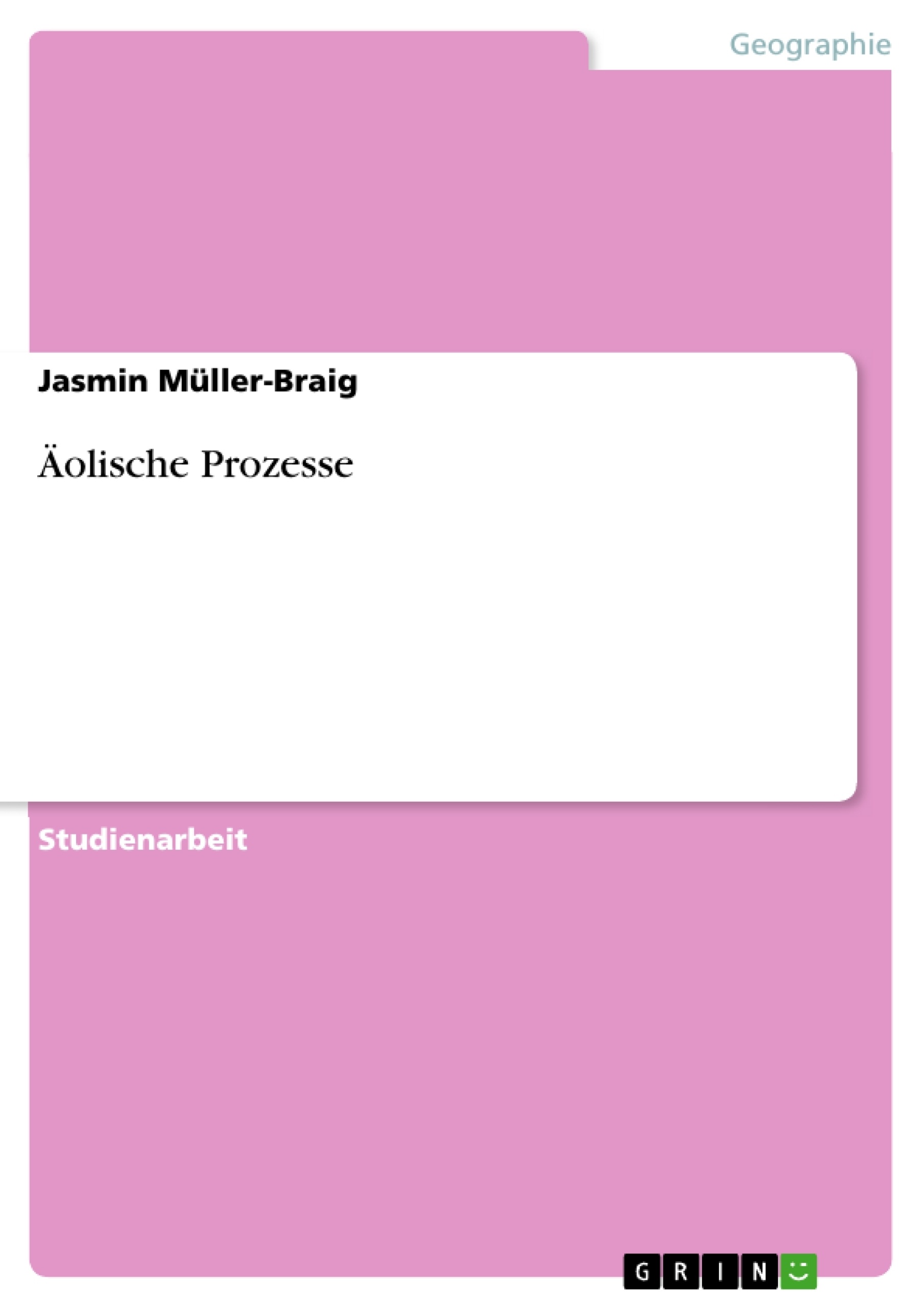Das Wort Äolisch stammt von dem altgriechischem Wort Aeolus ab und bedeutet: Gott des Windes. Folglich handelt es sich bei Äolischen Prozessen um all diejenigen Prozesse, die durch Windkraft gesteuert werden.
Äolische Abtragungen sind auf der ganzen Welt zu finden, seien es Megadünen in der Sahara oder „kleine Dünen“ an den Stränden Südfrankreichs, da vom Wind gesteuerte Prozesse zu jeder Zeit stattfinden und das auf der ganzen Welt. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen für Äolischen Transport, wird im ersten Abschnitt erläutert. Auf die verschiedenen Transportformen des Windes werde ich im zweiten Abschnitt genauer eingehen. Anschließend werde ich die verschiedenen Ablagerungsformen erläutern und meine Hausarbeit mit einem Fazit beenden.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Voraussetzungen
3 Transportformen
4 Äolische Akkumulationsformen
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
7 Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Das Wort Äolisch stammt von dem altgriechischem Wort Aeolus ab und bedeutet: Gott des Windes. Folglich handelt es sich bei Äolischen Prozessen um all diejenigen Prozesse, die durch Windkraft gesteuert werden.
Äolische Abtragungen sind auf der ganzen Welt zu finden, seien es Megadünen in der Sahara oder „kleine Dünen“ an den Stränden Südfrankreichs, da vom Wind gesteuerte Prozesse zu jeder Zeit stattfinden und das auf der ganzen Welt. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen für Äolischen Transport, wird im ersten Abschnitt erläutert. Auf die verschiedenen Transportformen des Windes werde ich im zweiten Abschnitt genauer eingehen. Anschließend werde ich die verschiedenen Ablagerungsformen erläutern und meine Hausarbeit mit einem Fazit beenden.
2. Voraussetzungen
Der Wind ist in der Lage bei bestimmten Voraussetzungen Bodenpartikel aufzunehmen (Deflation1 ), sie über weite Strecken zu transportieren und sie an einem anderen Ort wieder abzulagern (Akkumulation2 ). Ein Kubikkilometer Luft kann beispielsweise im Extremfall bis zu 1000 Tonnen Staub transportieren, dass entspricht dem Volumen eines kleinen Hauses (Bahlberg und Breitkreuz 2008, S. 96). Hierbei spielen vor allem das Klima, die Vegetation, die Windgeschwindigkeit und die Partikelgröße eine Rolle. Im Folgenden werde ich genauer auf die einzelnen Voraussetzungen für Äolischen Transport eingehen.
Wind hat im Vergleich zu Wasser eine sehr geringe Dichte und kann somit nur kleinere Partikel aufnehmen und transportieren. Für die Aufnahme von Partikeln spielt die Windgeschwindigkeit eine Rolle, welche mit wachsender Entfernung von der Oberfläche zunimmt. Je größer die Partikel, desto höher muss die Windgeschwindigkeit sein, um diese zu transportieren (Glawion et al. 2009, S.224).
Lockere Partikel wie Schluffe oder Sande, auf welche ich gleich noch genauer eingehen werde, sind gut geeignet für den Äolischen Transport, da sie feinkörnig und somit leicht sind. Feuchte Sande eignen sich nicht, da sie aufgrund der Adhäsions- und Kohäsionskräfte schwerer sind.
Schluffe und Sande gehören zu den klastischen Sedimenten und „werden nach ihrer Korngröße weiter unterteilt, da die Größe der Teilchen den Transport und die Ablagerung durch Strömungen beeinflußt.“ (Press und Siever 1995s, S. 152). Sie werden unterteilt in grobkörnige Partikel wie Kies, mittelkörnige Partikel wie Sande und Sandsteine und feinkörnige Partikel wie Schluffe und Tone (ebd. 1995, S. 153). Bei Löss handelt es sich um wenig verfestigten Schluff „mit einem Karbonatgehalt von durchschnittlich 20%“ (Bahlberg und Breitkreuz 2008, S.96 ).
Lose aufliegende Partikel findet man vor allem in ariden und semiariden Gebieten wie Wüsten oder Steppen. Ebenfalls zählen Küsten zu den Gebieten, in denen Äolischer Transport stattfindet, da die Strände reichlich Sand bieten (Strahler und Strahler 2009, S.629). Voraussetzung für Gebiete mit Äolischem Transport ist folglich, dass sie trocken sind und zudem wenig Vegetation aufweisen. In diesen Gebieten können Partikel über 1000 Kilometer transportiert werden (Press und Siever 1995s, S. 153). Im nächsten Abschnitt werde ich auf die verschiedenen Transportformen Äolischen Transports eingehen.
3. Transportformen
Abhängig von der Korngröße und der Windgeschwindigkeit werden beispielsweise Sande, Schluffe und Tone auf verschiedene Art und Weise vom Wind transportiert. Die verschiedenen Transportformen heißen Suspension, Saltation und Reptation (Glaser et al. 2010, S. 34).
Wenn Partikel in Suspension transportiert werden, heißt das, dass sie schwebend vom Wind getragen werden. Diese Form des Transports trifft nur auf leichte Partikel wie Tone und Schluffe zu. Größere Partikel werden vom Wind hüpfend und springend bewegt, diese Transportform nennt man Saltation. Werden Partikel am Boden vom Wind gerollt, so spricht man von Reptation. Dies passiert, wenn aufspringende Partikel auf solche treffen, die am Boden liegen und ihre Energie somit übertragen. Folglich werden die Bodenpartikel vorwärts gestoßen (ebd. 2010).
In der Abbildung 1 erkennt man, wie die Korngröße und die Windgeschwindigkeit zusammenhängen und wie sie die Äolische Transportform beeinflussen. Auf der X-Achse wird die Schubspannungsgeschwindigkeit angegeben, also der Druck, der vom Wind auf die Partikel ausgeübt wird. Auf der Y-Achse wird der Durchmesser der Partikel angezeigt. Zu erkennen ist, dass bei zunehmender Partikelgröße eine größere Schubspannungsgeschwindigkeit nötig ist, um diese zu bewegen (Glawion et al. 2009, S. 225 ff.).
Abb.1: Transportformen. Quelle: Bauer et al. 2002, zit. in: Glawion et al. 2009, S. 227.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Äolische Akkumulationsformen
Nachdem erläutert wurde, wie der Wind Material transportieren kann, wird nun erklärt was passiert, wenn das Material wieder abgelagert wird. Den Prozess der Ablagerung nennt man Akkumulation. Man unterscheidet zwischen drei Formen: den Windrippeln, den Dünen (gebundene und freie) und der Draa. Im Folgenden werde ich diese Akkumulationsformen näher erläutern.
Windrippel:
Die kleinste Akkumulationsform sind die Windrippel, welche mit einer maximalen Höhe von 0,5 Metern hauptsächlich durch Reptation entstehen und quer zu der dominierenden Windrichtung verlaufen. Windrippel entstehen primär durch „Reibung und Turbulenzen an Grenzflächen unterschiedlich stark bewegter Substrate“ (Gebhardt et al. 2007, S.297), in diesem Fall zwischen dem Wind und den Sandkörnern.
Dünen:
Bei einer Düne handelt es sich um eine „durch äolische Akkumulation geschaffene Feinsedimentablagerung“ (Leser 2010, S.168), vor allem bestehend aus Sand. Dünen können bis zu 500 Meter hoch sein und diverse Formen annehmen, abhängig von der Windstärke, -richtung und Windrichtungswechsel (ebd.). Sie entstehen hauptsächlich durch Saltation. Die typische Düne besteht aus einer langen flachen Seite, auch Luvhang genannt, und einer hohen steilen Seite, welche Leehang genannt wird. Diese charakteristische Form entsteht aufgrund der natürlichen Böschung3, das heißt, dass loser Sand bis zu einem Grenzneigungswinkel von 30 bis 35° standfest bleibt (Gebhardt et al 2007, S.298). Bei einem größeren Neigungswinkel wirkt die Schwerkraft und der lose Sand wird flexibel und rutscht. Ausnahmen sind sehr feuchte Sande, welche aufgrund der Adhäsions- und Kohäsionskräfte standfester sind auch bei größeren Neigungswinkeln.
Dünen werden unterschieden zwischen freien Dünen, wie Barchane, Transversal- und Longitudinaldünen und gebundenen Dünen, wie Parabeldünen oder Leedünen. Ob eine Düne gebunden oder frei ist hängt davon ab, ob sie an Hindernissen entsteht. Eine gebundene Düne, wie beispielsweise eine Kupste, entsteht, wenn die vom Wind getragenen Partikel an Felsen oder Pflanzen hängen bleiben (Glaser et al. 2010, S. 35). Freie Dünen wie Barchane wiederum entstehen zumeist bei nur mäßiger Sandzufuhr, einer Windrichtungsdrehung bis maximal 20° und auf einem festen, vegetationsfreiem Untergrund (Gebhardt et al. 2007, S. 298).
Draa:
Die größte Äolische Akkumulationsform wird Draa genannt. Diese Megaform von mehr als 500 Metern Höhe entsteht in Gebieten mit sehr großen Sandmengen bei kontinuierlichem Wind mit hoher Geschwindigkeit (Gebhardt et al. 2007, S. 299). Formen wie Stern- oder Querdraa entstehen vermutlich aufgrund von starken Windrichtungsänderungen, jedoch ist die genaue Entstehung noch unklar (ebd. 2007, S.302).
Windschliff:
Wenn das vom Wind getragene Material nicht direkt abgelagert wird, sondern auf exponiertes Gestein trifft, so können die Partikel wie Schleifwerkzeuge wirken und die Gesteinsoberfläche formen (Korrasion4 ). Diesen Vorgang nennt man Windschliff. Es kommt hierbei zu auffälligen Gesteinsformen wie Pilzfelsen oder Windgassen (ebd. 2007, S. 297).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Äolische Akkumulationsformen nicht nur abhängig sind von der Sandmenge, der Windstärke, -richtung und des Windrichtungswechsels, sondern auch von der „Materialart und –zulieferung sowie Untergrundbeschaffenheit […], Vegetationsbedeckung der Umgebung und Struktur des Mikro- und Mesogeoreliefs5 […]“ (Leser 2010, S. 168).
[...]
1 Äolische Aufnahme von Oberflächenlockermaterial
2 Ablagerung von Partikeln
3 Natürlicher Neigungswinkel eines Hanges
4 Form physikalischer Verwitterung
5 Klassifikation der Größenordnung von Reliefformen
- Arbeit zitieren
- Jasmin Müller-Braig (Autor:in), 2011, Äolische Prozesse, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/179214