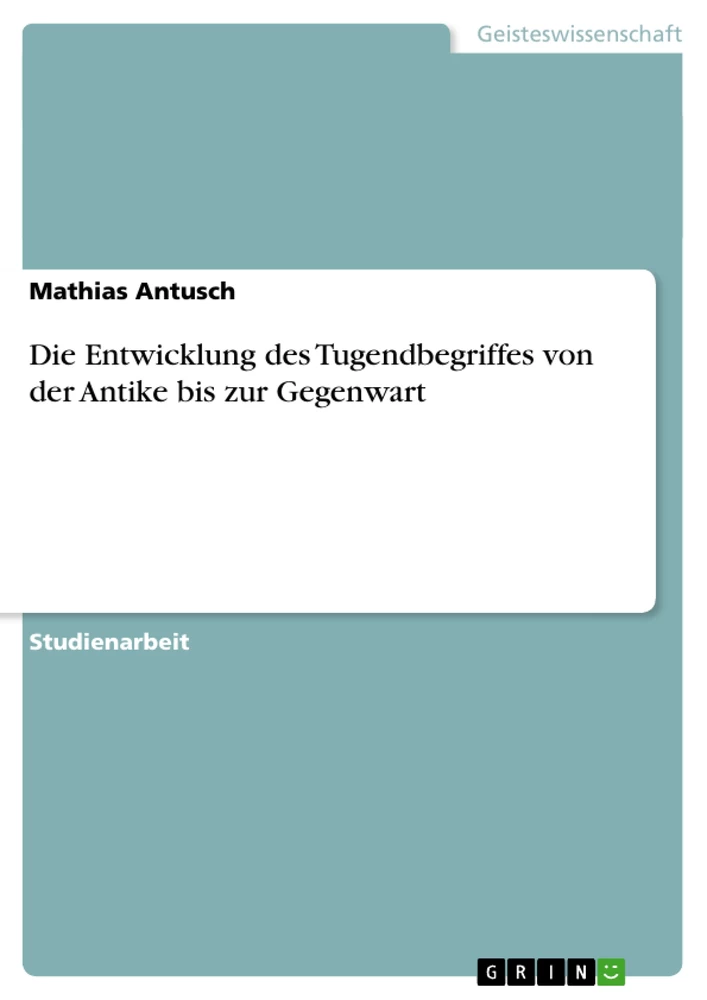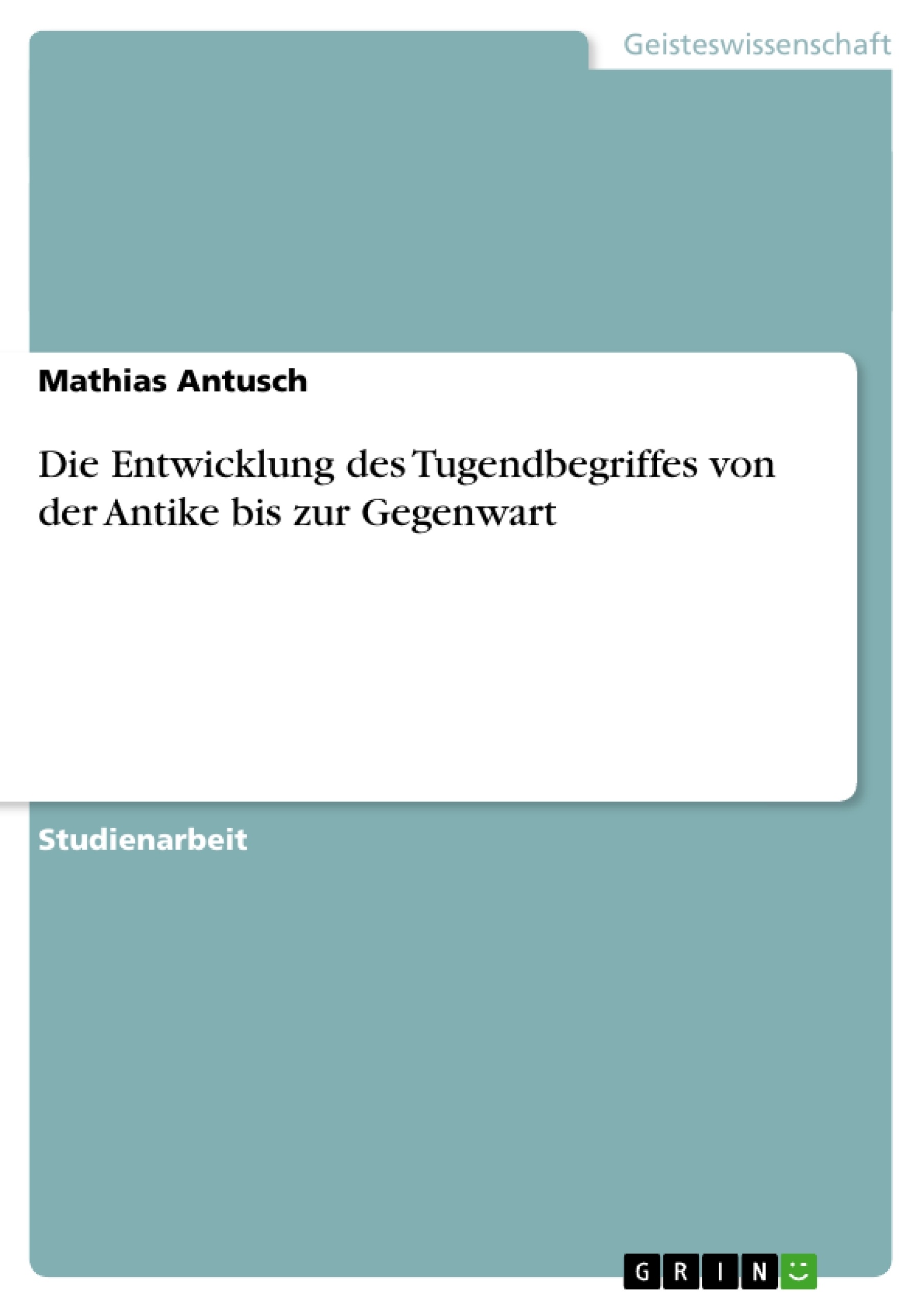[...] Permanent wird uns dabei eine objektive, neutrale
Berichterstattung versprochen. Doch oft bleibt die Wahrheit im dunkeln, die Nachrichten
werden zensiert, mitunter manipuliert, und dienen meist nur zur Beeinflussung der Menschen.
Ihnen wird jeden Tag vorgegeben, was richtig und was falsch, wer gut und wer böse ist. Viele
Menschen können damit leben, ist es doch bequem, sich mit Problemen nicht auseinander
setzten zu müssen, sondern sich vorgefertigten Meinungen anzuschließen. Ist dies auch der
Grund für das mangelnde Interesse an einer Diskussion um den Tugendbegriff? Oder ist die
Ablehnung in dem verstaubtem Image des Begriffes begründet?
Dass es in den letzten Jahren doch ein Interesse an einer Diskussion gibt, zeigt zum Beispiel
die populistische Publikation „Das Buch der Tugenden“ von Ulrich Wickert.1 Beachtung
erhält der Tugendbegriff außerdem durch die neu entstandenen Probleme der Globalisierung.
Gentechnik, Massentierhaltung, Umweltschutz und viele andere Themen erfordern eine
Diskussion der Tugendethik.2
In dieser Seminararbeit soll die Veränderung des Tugendbegriffes, dessen Interpretation und
die Diskussion um ihn, von der Antike bis zur Gegenwart betrachtet werden. Natürlich kann
eine solche Darstellung nicht vollständig sein, zu groß ist die Zahl der Menschen, die sich mit
dem Thema beschäftigt haben.
Für die Bearbeitung der Seminararbeit wurde folgende Literatur verwendet: Zunächst einmal
natürlich die Standardnachschlagewerke der Philosophie, z.B. das „Metzler- Philosophie
Lexikon“ von Prechtl/ Burkhard oder das „Philosophische Wörterbuch“ von Stockhammer.
Auch das „Historisches Wörterbuch“ zur Philosophie von Rotter/ Virt ist sehr ausführlich und
umfangreich. Ein kompaktes Werk zur Ethik allgemein ist Martin Honeckers „Einführung in
die theologische Ethik“. Das Buch „Grundbegriffe der christlichen Ethik“ von Wils/ Mieth ist
sehr ausführlich, aber auch schwer verständlich. Zuletzt möchte ich noch auf 2 unterhaltsame
Werke hinweisen. Zum einen ist dies „Was taugt die Tugend“ von Anselm Winfried Müller,
der in einer interessanten und leicht verständlichen Art und Weise das Thema bearbeitet. Zum
anderen das Buch „Die Biologie der Tugend, warum es sich lohnt, gut zu sein“ von Matt
Ridley, welcher die biologischen Zusammenhänge der Tugendethik erforscht hat.
1 Wickert, Ulrich: Das Buch der Tugenden. Hamburg 1995
2 vor allem natürlich die Forderung der Global Governance Vertreter nach einer „Weltethik“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tugendbegriff in der Antike
- Der vorsokratische Tugendbegriff
- Sokrates und Platon
- Aristoteles
- Die Tugend in der stoischen Lehre
- Der Tugendbegriff in der christlichen Ethik
- Die Tugend in der Bibel
- Die Tugendlehre im Mittelalter
- Neuzeitliche Gesichtspunkte der Tugendlehre
- Der Tugendbegriff in der frühen Neuzeit bis zur französischen Revolution
- Deutscher Rationalismus und Idealismus
- Deutungen des 20. Jahrhunderts
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklung des Tugendbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Ziel ist es, die Veränderungen in der Interpretation und die damit verbundene Diskussion aufzuzeigen. Die Arbeit berücksichtigt dabei die Limitationen einer vollständigen Darstellung aufgrund der umfangreichen Beschäftigung mit dem Thema durch viele Denker.
- Entwicklung des Tugendbegriffs über verschiedene Epochen
- Veränderungen in der Interpretation des Tugendbegriffs
- Die Rolle des Tugendbegriffs im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Der Einfluss unterschiedlicher philosophischer Schulen auf den Tugendbegriff
- Die Bedeutung von Wissen und Erkenntnis für das Verständnis von Tugend
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die aktuelle Relevanz des Tugendbegriffs im Kontext der Informationsflut und der damit verbundenen Herausforderungen. Sie thematisiert die Tendenz zur Meinungsannahme statt kritischer Auseinandersetzung und verweist auf ein wachsendes Interesse an der Tugendethik, insbesondere im Hinblick auf globale Herausforderungen wie Gentechnik und Umweltschutz. Die Arbeit skizziert das Ziel, die Entwicklung des Tugendbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart zu beleuchten und nennt die verwendete Literatur.
Der Tugendbegriff in der Antike: Dieses Kapitel erforscht die Entwicklung des Tugendbegriffs in der Antike, beginnend mit den homerischen Epen, in denen der Begriff "Arete" noch nicht im Sinne moralischer Eigenschaften verwendet wird, sondern eher Stärke und Erfolg bezeichnet. Die vorsokratischen Philosophen zeigen nur einzelne Ausprägungen von Arete, während die Sophistik die Frage nach dem Glücklichsein und dem Weg dorthin ins Zentrum rückt. Sokrates und Platon differenzieren den Tugendbegriff, indem sie ihn mit Wissen und Erkenntnis verbinden. Platon entwickelt einen Tugendkatalog mit Weisheit, Tapferkeit, Maßhaltung und Gerechtigkeit als höchste Tugend, die aus dem harmonischen Zusammenspiel der anderen entsteht. Die Frage nach der Lehrbarkeit von Tugenden wird diskutiert, wobei Platon "Anlagen" als notwendige Voraussetzung sieht.
Der Tugendbegriff in der christlichen Ethik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Integration des Tugendbegriffs in die christliche Ethik. Zunächst wird die Darstellung der Tugend in der Bibel behandelt, gefolgt von einer Untersuchung der Tugendlehre des Mittelalters. Hier wird detailliert untersucht, wie die antiken Konzepte der Tugend in das christliche Weltbild integriert und weiterentwickelt wurden. Die Kapitel befassen sich mit der Verschränkung von christlicher Glaubenslehre und ethischen Prinzipien, sowie den spezifischen Herausforderungen und Interpretationen innerhalb der christlichen Tradition.
Neuzeitliche Gesichtspunkte der Tugendlehre: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Tugendbegriffs in der Neuzeit. Es werden die Veränderungen in der frühen Neuzeit bis zur französischen Revolution, der Einfluss des deutschen Rationalismus und Idealismus, sowie Deutungen des 20. Jahrhunderts untersucht. Die verschiedenen philosophischen Strömungen und ihre jeweiligen Beiträge zum Verständnis von Tugend werden gegenübergestellt und kritisch beleuchtet. Das Kapitel verdeutlicht die Kontinuität und den Wandel im Umgang mit dem Tugendbegriff über die Jahrhunderte hinweg.
Schlüsselwörter
Tugend, Arete, Virtus, Antike, Christentum, Neuzeit, Ethik, Moral, Wissen, Erkenntnis, Glück, Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit, Maßhaltung, Platon, Sokrates, Philosophie, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Entwicklung des Tugendbegriffs
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung des Tugendbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Sie analysiert die Veränderungen in der Interpretation des Begriffs und die damit verbundenen Diskussionen, wobei die Limitationen einer vollständigen Darstellung aufgrund der umfangreichen Beschäftigung mit dem Thema durch viele Denker berücksichtigt werden.
Welche Epochen und philosophischen Strömungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Tugendbegriff in der Antike (vorsokratische Philosophie, Sokrates, Platon, Aristoteles, Stoizismus), in der christlichen Ethik (Bibel, Mittelalter), und in der Neuzeit (frühe Neuzeit bis zur französischen Revolution, deutscher Rationalismus und Idealismus, 20. Jahrhundert). Es werden verschiedene philosophische Schulen und ihre jeweiligen Beiträge zum Verständnis von Tugend gegenübergestellt und kritisch beleuchtet.
Welche zentralen Themen werden untersucht?
Zentrale Themen sind die Entwicklung des Tugendbegriffs über verschiedene Epochen, Veränderungen in seiner Interpretation, seine Rolle im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, der Einfluss unterschiedlicher philosophischer Schulen, und die Bedeutung von Wissen und Erkenntnis für das Verständnis von Tugend.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Entwicklung des Tugendbegriffs in der Antike, in der christlichen Ethik und in der Neuzeit, sowie ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Tugend, Arete, Virtus, Antike, Christentum, Neuzeit, Ethik, Moral, Wissen, Erkenntnis, Glück, Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit, Maßhaltung, Platon, Sokrates, Philosophie und Globalisierung.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung und die Veränderungen in der Interpretation des Tugendbegriffs aufzuzeigen und dessen Bedeutung im Kontext der jeweiligen Epochen und philosophischen Strömungen zu beleuchten. Die Einleitung hebt die aktuelle Relevanz des Tugendbegriffs im Kontext der Informationsflut und der damit verbundenen Herausforderungen hervor.
Welche Limitationen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit erwähnt die Limitationen einer vollständigen Darstellung des Themas aufgrund der umfangreichen Beschäftigung mit dem Tugendbegriff durch viele Denker über die Jahrhunderte hinweg.
Wie wird der Tugendbegriff in der Antike dargestellt?
Das Kapitel zur Antike beschreibt die Entwicklung des Tugendbegriffs von den homerischen Epen bis zu Platon und Aristoteles. Es beleuchtet die verschiedenen Interpretationen von "Arete" und die Verbindung von Tugend mit Wissen und Erkenntnis bei Sokrates und Platon. Die Frage nach der Lehrbarkeit von Tugenden wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird der Tugendbegriff in der christlichen Ethik behandelt?
Das Kapitel zur christlichen Ethik untersucht die Integration des antiken Tugendbegriffs in das christliche Weltbild. Es analysiert die Darstellung der Tugend in der Bibel und die Entwicklung der Tugendlehre im Mittelalter, einschließlich der Verschränkung von christlicher Glaubenslehre und ethischen Prinzipien.
Wie wird der Tugendbegriff in der Neuzeit dargestellt?
Das Kapitel zur Neuzeit analysiert die Entwicklung des Tugendbegriffs von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Es beleuchtet den Einfluss des deutschen Rationalismus und Idealismus und stellt verschiedene philosophische Strömungen und ihre Beiträge zum Verständnis von Tugend gegenüber.
- Quote paper
- Mathias Antusch (Author), 2003, Die Entwicklung des Tugendbegriffes von der Antike bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/17720