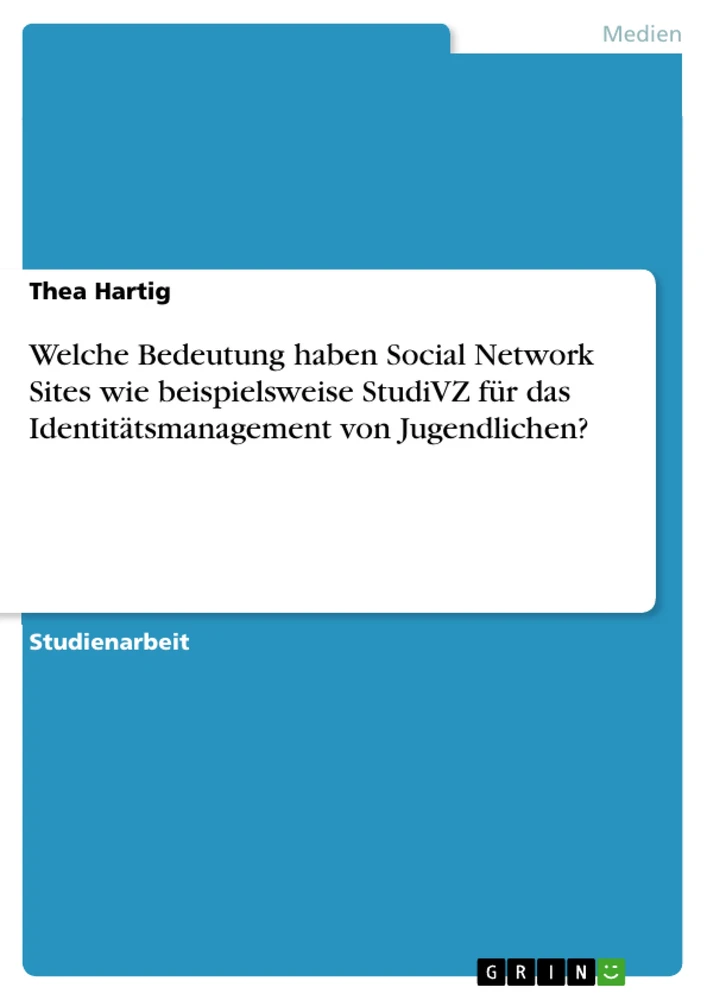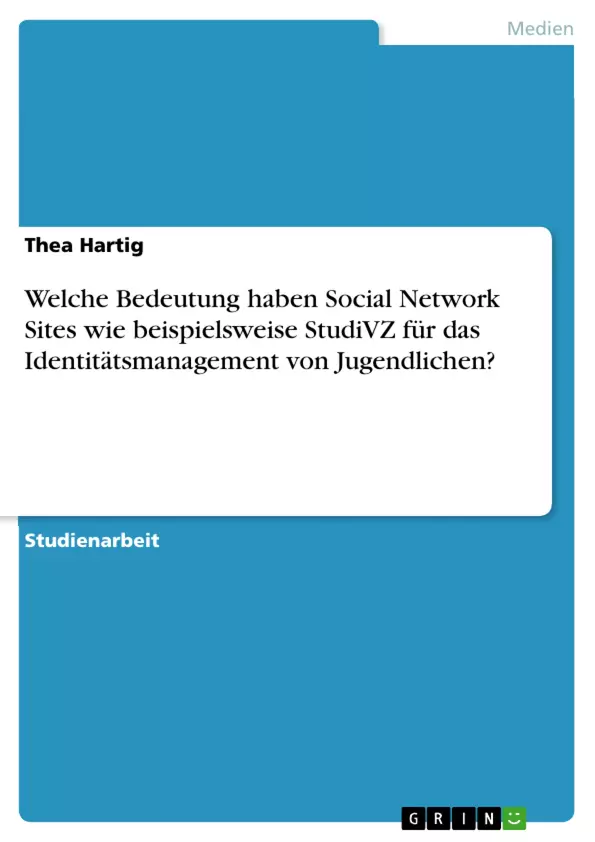Noch bis in das 20. Jahrhundert hinein traten die meisten direkt von der Kindheit in das Arbeitsleben der Erwachsenen über. Nur wenigen jungen Menschen war der „Luxus eines Moratoriums der Jugendzeit“ vergönnt. In den 1950ern konnte sich durch die gestiegene Prosperität eine Jugend für alle durchsetzen, die jedoch je nach Geschlecht und in Abhängigkeit von materiellen und sozialen Ressourcen recht unterschiedlich in Bezug auf Länge, Freiräumen und Möglichkeiten ausgeprägt war. Heutzutage – im Zuge der postadoleszenten Verlängerung – scheint Jugend immer schwerer nach hinten altersspezifisch abgrenzbar, zumal sich Jugendliche heute in Konfrontation mit einer Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen befinden, welche hohen Druck auf die Identitätskonstruktion ausübt. Im heutigen Zeitalter der Cyber-Moderne, geprägt von Mediatisierung und Digitalisierung, ist das Internet präsenter als je zuvor und fest in den Alltag Jugendlicher integriert. Während ältere Formen der Selbstthematisierung, die neben Interaktion konstitutiv für das Identitätsmanagement ist, bereits gut erforscht wurden, sind neue mediale Formen, gerade solche, die sich auf das Web 2.0 beziehen, noch weniger gut aufgearbeitet. In dieser Arbeit wird die Beantwortung der zugrunde gelegten Fragestellung auf erste wissenschaftliche Ergebnisse gestützt.
Ziel dieser Ausarbeitung ist es, die Bedeutung von Social Network Sites (SNS) für das Identitätsmanagement Jugendlicher aufzuzeigen. Dies geschieht exemplarisch am Beispiel des Studentenverzeichnisses (im Folgenden kurz studiVZ genannt).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Digitale Jugendkultur
- 2.1 Jugendbegriff und Herausforderungen für Jugendliche
- 2.2 Jugend und Medien
- 3. Social Network Sites (SNS)
- 3.1 Definition
- 3.2 Was ist studiVZ?
- 3.3 Möglichkeiten des Identitätsmanagement bei studiVZ
- 3.3.1 Identitätsmanagement und Selbstthematisierung
- 3.3.2 Selbstthematisierung durch Profilgestaltung
- 3.3.3 Beeinflussung der Identitätsausbildung durch Kommunikationsfunktionen
- 3.3.4 Authentizität
- 3.4 Fazit: Bedeutung von Social Network Sites anhand des Beispiels
- 4. Diskussion und kritische Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Social Network Sites (SNS) für das Identitätsmanagement Jugendlicher, exemplarisch anhand von StudiVZ. Ziel ist es aufzuzeigen, wie diese Plattformen die Identitätsfindung und -darstellung junger Menschen beeinflussen.
- Der Jugendbegriff und die Herausforderungen der heutigen Jugend.
- Die Rolle des Internets und digitaler Medien im Leben Jugendlicher.
- Definition und Kontextualisierung von Social Network Sites (SNS).
- Möglichkeiten des Identitätsmanagements auf StudiVZ.
- Kritische Betrachtung der Auswirkungen von SNS auf die Identitätsentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Social Network Sites für das Identitätsmanagement Jugendlicher. Sie verortet die Thematik im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der zunehmenden Bedeutung digitaler Medien für die Jugend. Die Arbeit konzentriert sich auf StudiVZ als Beispiel für eine SNS und skizziert den methodischen Ansatz.
2. Digitale Jugendkultur: Dieses Kapitel beleuchtet den Jugendbegriff und die Herausforderungen, denen Jugendliche heute gegenüberstehen. Es werden die spezifischen Sozialisationsaufgaben im Kontext der Identitätsfindung thematisiert, insbesondere vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen und des Drucks auf die Identitätskonstruktion. Unter Einbezug der JIM-Studie 2010 wird die heutige Jugend als "digitale Jugend" charakterisiert, wobei die Bedeutung des Internets und der Handy-Nutzung für den jugendlichen Alltag hervorgehoben wird. Die Konzepte der Mediatisierung und Digitalisierung werden eingeführt, um die zunehmende Bedeutung von Medien für das Identitätsmanagement zu verdeutlichen.
3. Social Network Sites (SNS): Dieses Kapitel definiert den Begriff der Social Network Site im Kontext von Web 2.0. Es gibt einen Überblick über StudiVZ als exemplarisch gewählte SNS. Der Hauptfokus liegt auf den Möglichkeiten des Identitätsmanagements auf StudiVZ, unterteilt in Selbstthematisierung durch Profilgestaltung, die Beeinflussung der Identitätsausbildung durch Kommunikationsfunktionen und den Aspekt der Authentizität. Das Kapitel analysiert, wie Nutzer ihre Identität auf der Plattform gestalten und präsentieren und wie dies ihre Identitätsentwicklung beeinflusst. Der Aspekt der Authentizität wird kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Identitätsmanagement, Jugendliche, Social Network Sites, StudiVZ, Digitale Medien, Mediatisierung, Digitalisierung, Selbstthematisierung, Identitätskonstruktion, Web 2.0, Authentizität, JIM-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Identitätsmanagement Jugendlicher auf Social Network Sites
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Social Network Sites (SNS), insbesondere StudiVZ, für das Identitätsmanagement Jugendlicher. Sie analysiert, wie diese Plattformen die Identitätsfindung und -darstellung junger Menschen beeinflussen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Jugendbegriff und die Herausforderungen der heutigen Jugend, die Rolle digitaler Medien im Leben Jugendlicher, die Definition und Kontextualisierung von SNS, die Möglichkeiten des Identitätsmanagements auf StudiVZ (Selbstthematisierung, Profilgestaltung, Einfluss von Kommunikationsfunktionen, Authentizität) und eine kritische Betrachtung der Auswirkungen von SNS auf die Identitätsentwicklung. Die JIM-Studie 2010 wird als Referenz herangezogen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die genaue Methodik wird nicht explizit im Preview genannt. Jedoch wird eine exemplarische Analyse von StudiVZ als Social Network Site und eine Betrachtung der dort möglichen Identitätsmanagement-Strategien angedeutet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über digitale Jugendkultur, ein Kapitel über Social Network Sites (SNS) mit Fokus auf StudiVZ und ein Kapitel mit Diskussion und kritischen Anmerkungen. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung kurz beschrieben.
Was ist das zentrale Ergebnis der Analyse von StudiVZ?
Das Preview gibt keine konkreten Ergebnisse wieder, sondern skizziert die Analyse der Möglichkeiten des Identitätsmanagements auf StudiVZ. Es wird untersucht, wie Nutzer ihre Identität gestalten und präsentieren und wie dies ihre Identitätsentwicklung beeinflusst, inklusive einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Aspekt der Authentizität.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Identitätsmanagement, Jugendliche, Social Network Sites, StudiVZ, Digitale Medien, Mediatisierung, Digitalisierung, Selbstthematisierung, Identitätskonstruktion, Web 2.0, Authentizität, JIM-Studie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte aufzeigen, wie Social Network Sites die Identitätsfindung und -darstellung junger Menschen beeinflussen. Sie untersucht den Einfluss dieser Plattformen auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher am Beispiel von StudiVZ.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Jugendforschung, Medienwissenschaften, Soziologie und der Nutzung sozialer Medien befassen. Sie ist auch für Pädagogen und alle Interessierten an der Thematik der Identitätsentwicklung im digitalen Kontext relevant.
- Quote paper
- Thea Hartig (Author), 2011, Welche Bedeutung haben Social Network Sites wie beispielsweise StudiVZ für das Identitätsmanagement von Jugendlichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/175843