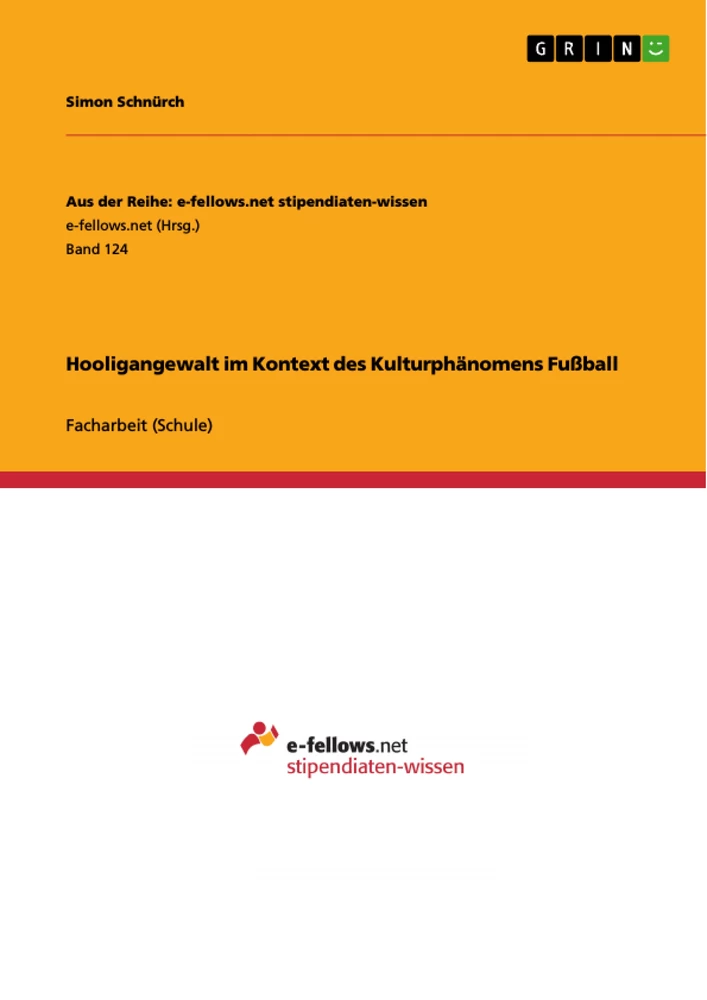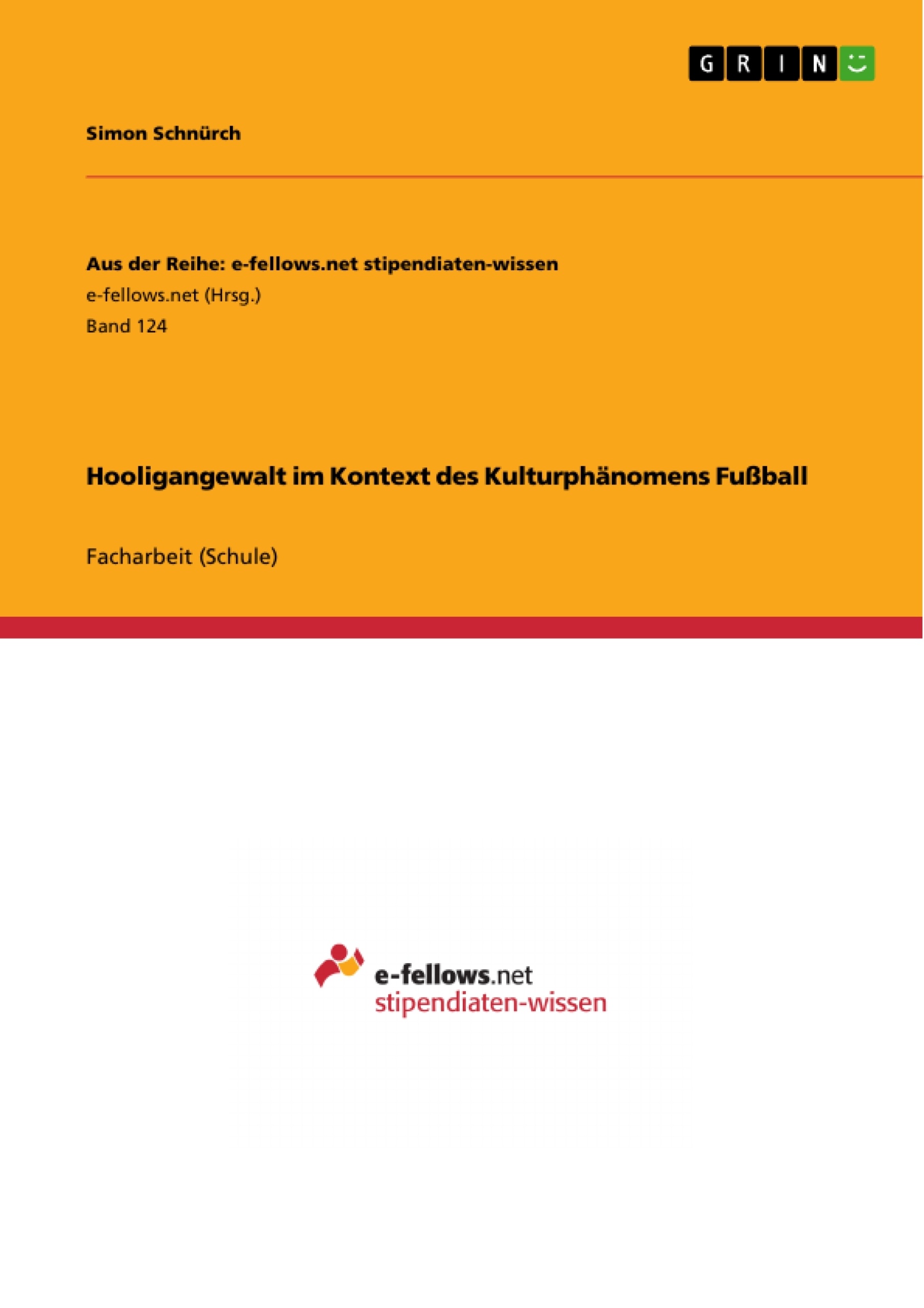Das Phänomen des Hooliganismus existiert im deutschen Fußball ungefähr seit den 1970er-Jahren. Großes öffentliches Aufsehen erregte es allerdings erst später, etwa mit Ausschreitungen im Jahr 1985 in Brüssel. Bei dem Europapokal-Endspiel zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin kamen dort 39 Menschen ums Leben, 400 wurden schwer verletzt. Der vielleicht prominenteste Fall von Hooligangewalt ereignete sich 1998 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich: Der französische Polizist Daniel Nivel wurde von deutschen Hooligans niedergestreckt und am Boden liegend weiterhin getreten und geschlagen. Er trug massive, bleibende Gesundheitsschäden davon; die beteiligten Hooligans wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
Angesichts solcher Gewaltexzesse und angesichts der Einstellung, die Hooligans offenbar dazu haben, drängen sich zahlreiche Fragen auf: Was ist der Grund für die Existenz einer Subkultur, die sich anscheinend ausschließlich zum Zweck der Gewaltausübung gebildet hat? Wieso eskaliert die Situation dabei nur allzu häufig? Haben Hooligans Spaß an stumpfer Gewalt, Spaß daran, andere Menschen schwer zu verletzen oder gibt es differenzierte Gründe für ihr Verhalten?
Um diese Fragen zu beantworten, ist es unumgänglich, sich genauer mit den Hooligans auseinanderzusetzen, indem man die Zusammensetzung ihrer Subkultur untersucht und gleichzeitig mit besonderem Augenmerk auf der Hooligangruppe nach den Ursachen der Gewalt forscht.
Dies ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellung der Arbeit
- 1.2 Konzept der Arbeit
- 2 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Gewalt
- 2.2 Subkultur
- 2.3 Hooligan
- 3 Charakterisierung der Hooligans als Gruppe und als Subkultur
- 3.1 Erscheinungsbild
- 3.2 Zusammensetzung der Subkultur
- 3.3 Die Gruppe: Organisation, Hierarchie und Ideale
- 4 Motivation für Hooliganismus
- 4.1 Fußball als mobilisierendes Ereignis: Die Entwertungsthese
- 4.2 Die Rolle der Gruppe: Gewalt als Mittel zur Identitätsbildung
- 4.3 Die Rolle der Gewalt: Weiterführende Ursachenforschung
- 4.3.1 Fortbestehen traditioneller Männlichkeitsnormen
- 4.3.2 Die Suche nach dem „Kick“
- 4.3.3 Die Wechselbeziehung von Sportler- und Zuschauergewalt
- 4.3.4 Stigmatisierung und übermäßig starke repressive Maßnahmen gegenüber Fans seitens Verein und Polizei
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen der Hooligangewalt im Kontext des deutschen Fußballs. Ziel ist es, die Ursachen und Motivationen hinter dem Hooliganismus zu ergründen und die Hooligan-Subkultur zu charakterisieren. Die Arbeit analysiert die Gewaltbereitschaft von Hooligans, ihre Gruppenstrukturen und die Rolle des Fußballs als mobilisierendes Ereignis.
- Definition und Charakterisierung von Hooligans als Subkultur
- Motivationen und Ursachen für Hooligangewalt
- Die Rolle des Fußballs als Auslöser und Kontext für Gewalt
- Gruppenstrukturen und -dynamiken innerhalb Hooligan-Gruppen
- Soziologische und kulturelle Aspekte des Hooliganismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Hooliganismus ein und skizziert die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Ursachen und Hintergründe gewalttätigen Verhaltens von Fußballfans. Sie stellt den Kontext der Hooligangewalt anhand von Beispielen wie den Ereignissen von Brüssel 1985 und dem Angriff auf Daniel Nivel 1998 dar, um die Brisanz des Themas zu verdeutlichen. Die Einleitung umreißt auch den methodischen Ansatz der Arbeit, der in der Definition relevanter Begriffe und der anschließenden Analyse der Hooligans als Gruppe und Subkultur besteht.
2 Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt wichtige Begriffe, die für das Verständnis der Arbeit unerlässlich sind. Der Begriff "Gewalt" wird definiert und eingegrenzt, wobei insbesondere die subjektive Wahrnehmung von Gewalt durch Hooligans berücksichtigt wird, die ihre Prügeleien oft als "Kampfsport" betrachten. Der Begriff "Subkultur" wird im Kontext der Hooligan-Szene erläutert, und es wird definiert, was ein Hooligan im Sinne dieser Arbeit darstellt. Die Ausführungen bilden die Grundlage für die anschließende Analyse.
3 Charakterisierung der Hooligans als Gruppe und als Subkultur: Dieses Kapitel beschreibt das Erscheinungsbild, die soziale Zusammensetzung und die Organisationsstruktur von Hooligan-Gruppen. Es analysiert die Gruppenhierarchie, die verbindenden Ideale und die Frage nach einem möglichen "Ehrenkodex". Es werden die sozialen Schichten untersucht, aus denen sich Hooligans rekrutieren, und es werden Merkmale ihrer Subkultur beleuchtet, die sie von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen.
4 Motivation für Hooliganismus: Dieses Kapitel untersucht die Motivationen hinter Hooligangewalt. Es analysiert den Fußball als mobilisierendes Ereignis und erörtert die Rolle der Gruppe bei der Identitätsfindung und der Eskalation von Gewalt. Die Analyse beleuchtet verschiedene Faktoren, wie das Fortbestehen traditioneller Männlichkeitsnormen, die Suche nach dem "Kick", die Wechselwirkung zwischen Sportler- und Zuschauergewalt sowie die Auswirkungen von Stigmatisierung und repressiven Maßnahmen. Es werden verschiedene Theorien und Perspektiven zu den Ursachen des Hooliganismus vorgestellt und diskutiert.
Schlüsselwörter
Hooligangewalt, Fußball, Subkultur, Gewaltmotivation, Identitätsbildung, Gruppenstrukturen, Männlichkeitsnormen, soziale Kontrolle, repressive Maßnahmen, Fußballfans, Kategorie C-Fans.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Hooligangewalt im deutschen Fußball
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Phänomen der Hooligangewalt im Kontext des deutschen Fußballs. Sie befasst sich mit den Ursachen und Motivationen hinter dem Hooliganismus und charakterisiert die Hooligan-Subkultur.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Gewaltbereitschaft von Hooligans, ihre Gruppenstrukturen, die Rolle des Fußballs als mobilisierendes Ereignis, die Definition und Charakterisierung von Hooligans als Subkultur, Motivationen und Ursachen für Hooligangewalt, die Rolle des Fußballs als Auslöser und Kontext für Gewalt, Gruppenstrukturen und -dynamiken innerhalb Hooligan-Gruppen sowie soziologische und kulturelle Aspekte des Hooliganismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen, Charakterisierung der Hooligans als Gruppe und als Subkultur, Motivation für Hooliganismus und Resümee. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Fragestellung. Kapitel 2 definiert wichtige Begriffe wie Gewalt, Subkultur und Hooligan. Kapitel 3 charakterisiert Hooligans als Gruppe und Subkultur, während Kapitel 4 die Motivationen für Hooliganismus untersucht. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie werden Hooligans in dieser Arbeit definiert und charakterisiert?
Die Arbeit definiert den Begriff "Hooligan" im Kontext der Arbeit und charakterisiert Hooligans anhand ihres Erscheinungsbilds, ihrer sozialen Zusammensetzung, ihrer Organisationsstruktur, ihrer Gruppenhierarchie und ihrer Ideale. Es wird untersucht, aus welchen sozialen Schichten sich Hooligans rekrutieren und welche Merkmale ihre Subkultur von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen.
Welche Motivationen für Hooligangewalt werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Motivationen, darunter den Fußball als mobilisierendes Ereignis, die Rolle der Gruppe bei der Identitätsfindung und der Eskalation von Gewalt, das Fortbestehen traditioneller Männlichkeitsnormen, die Suche nach dem "Kick", die Wechselwirkung zwischen Sportler- und Zuschauergewalt sowie die Auswirkungen von Stigmatisierung und repressiven Maßnahmen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Hooligangewalt, Fußball, Subkultur, Gewaltmotivation, Identitätsbildung, Gruppenstrukturen, Männlichkeitsnormen, soziale Kontrolle, repressive Maßnahmen, Fußballfans und Kategorie C-Fans.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Vorgehensweise, die in der Definition relevanter Begriffe und der anschließenden Analyse der Hooligans als Gruppe und Subkultur besteht. Sie analysiert verschiedene Theorien und Perspektiven zu den Ursachen des Hooliganismus.
Welche Beispiele werden in der Einleitung genannt, um die Brisanz des Themas zu verdeutlichen?
Die Einleitung veranschaulicht die Brisanz des Themas anhand von Beispielen wie den Ereignissen von Brüssel 1985 und dem Angriff auf Daniel Nivel 1998.
Wie wird der Begriff "Gewalt" in der Arbeit definiert?
Der Begriff "Gewalt" wird definiert und eingegrenzt, wobei insbesondere die subjektive Wahrnehmung von Gewalt durch Hooligans berücksichtigt wird, die ihre Prügeleien oft als "Kampfsport" betrachten.
Wie wird der Begriff "Subkultur" im Kontext der Hooligan-Szene erläutert?
Der Begriff "Subkultur" wird im Kontext der Hooligan-Szene erläutert, um die spezifischen Merkmale und die Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft zu beschreiben.
- Quote paper
- Simon Schnürch (Author), 2010, Hooligangewalt im Kontext des Kulturphänomens Fußball, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/175318