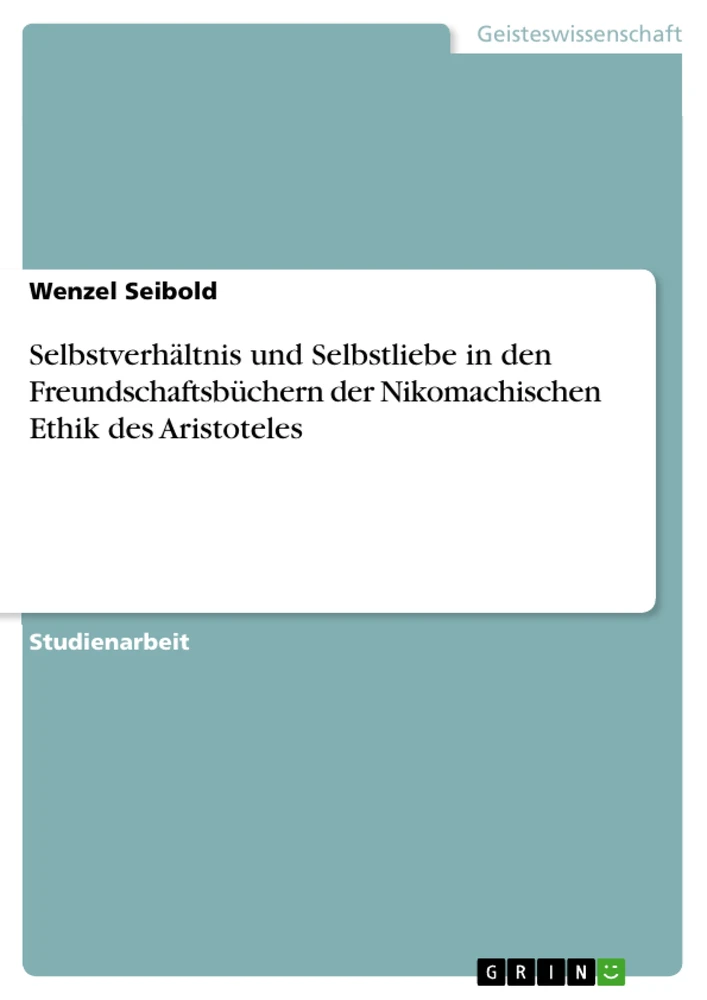„Wer Freunde haben will, der muss sich selbst Freund sein.“
Ein einleuchtender und nahezu von jedem mit Zustimmung bedachter Satz. So oder so ähnlich sehen Erkenntnisse von großen Denkern aus, wenn sie durch den Volksmund auf ihren wesentlichen Inhalt reduziert und über Generationen hinweg tradiert werden. Dabei ist nichts Schlechtes, bis darauf, dass der Autor eines solchen Gedankens meist nicht mehr mit demselben in Verbindung gebracht wird. Den obigen Satz würden sicherlich eine Reihe von Menschen als eigene Grundüberzeugung deuten, nur wenige würden ihn mit der Nikomachischen Ethik (NE) des Aristoteles in Verbindung bringen. Was unter anderem daran liegen mag, dass es einfacher ist, solch einen prägnanten Satz zu behalten, als sich mit dem mächtigen Gedankengebäude des Philosophen auseinanderzusetzen. Die Fülle seines Denkens, seine Präzision in der Begriffsfindung und seine argumentative Kunstfertigkeit machen es dem Interpreten seiner Arbeiten nicht gerade leicht. Dennoch soll hier versucht werden, sofern das im begrenzten Rahmen einer Hausarbeit möglich ist, sich in angemessener Weise einem zentralen Thema seiner Hauptethik anzunehmen – Dem Selbstverhältnis und der Selbstliebe.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. philia – Der antike Freundschaftsbegriff
- III. Die Nikomachische Ethik
- III.I. Die Seelenteile
- III.II. Freundschaft in der Nikomachischen Ethik
- IV. Die Selbstliebe
- IV.I. Das Selbstverhältnis
- IV.II. Gute Selbstliebe
- IV.III. Schlechte Selbstliebe
- V. Egoismus oder Altruismus – Eine gerechtfertigte Debatte?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Selbstverhältnis und der Selbstliebe im Kontext der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, insbesondere in den Büchern VIII und IX, die sich mit dem Thema der Freundschaft (philia) auseinandersetzen. Der Fokus liegt auf dem vierten und achten Kapitel des neunten Buches, in denen Aristoteles das Selbstverhältnis und die Selbstliebe analysiert. Ziel ist es, die Positionierung von Freundschaft und Selbstbeziehung innerhalb des Gesamtkonzepts der NE zu beleuchten und ihre Beziehung zueinander aufzuzeigen. Die Arbeit zeigt auf, wie die aristotelische Vorstellung von einem Verhaltens-zu-sich auf seiner Theorie von verschiedenen Seelenteilen basiert.
- Der antike Freundschaftsbegriff „philia“ und seine Entwicklung
- Die Grundgedanken der Nikomachischen Ethik, insbesondere die Unterteilung der Seele und die Behandlung der Freundschaft
- Die Bestimmung des Selbstverhältnisses nach Aristoteles
- Die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Selbstliebe
- Die Relevanz des aristotelischen Konzepts für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Der einleitende Abschnitt führt den Leser in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Selbstverhältnisses und der Selbstliebe in der Nikomachischen Ethik. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bücher VIII und IX, in denen Aristoteles die Freundschaft (philia) und ihre Beziehung zum Selbst behandelt.
- II. philia – Der antike Freundschaftsbegriff: Dieser Abschnitt beleuchtet den Begriff der philia in der Antike. Von den Vorsokratikern über Platon bis zur attischen Demokratie wird die Entwicklung des Freundschaftsbegriffs nachgezeichnet und dessen Bedeutung für die griechische Gesellschaft aufgezeigt. Der Abschnitt stellt den Unterschied zwischen dem antiken und dem modernen Verständnis von Freundschaft heraus.
- III. Die Nikomachische Ethik: Dieser Abschnitt widmet sich den Kerngedanken der Nikomachischen Ethik (NE) und legt den Fokus auf die Unterteilung der Seele und die Behandlung der Freundschaft in diesem Werk. Die NE stellt ein Idealbild eines guten Lebens dar, das durch das Streben nach Glückseligkeit (eudaimonia) gekennzeichnet ist.
- IV. Die Selbstliebe: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Selbstliebe und stellt zunächst die früheste Begriffsgeschichte der Selbstliebe dar. Anschließend wird die Definition des Selbstverhältnisses nach Aristoteles erläutert, wobei die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Selbstliebe im Vordergrund steht. Der Zusammenhang mit der aristotelischen Theorie der Seelenteile wird hervorgehoben.
- V. Egoismus oder Altruismus – Eine gerechtfertigte Debatte?: Der fünfte Abschnitt beleuchtet die Forschungsdebatte rund um das Selbstverhältnis und die Selbstliebe in der aristotelischen Philosophie. Die Relevanz des aristotelischen Konzepts für die heutige Zeit wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die die Arbeit durchziehen, sind Selbstverhältnis, Selbstliebe, philia, Nikomachische Ethik, Aristoteles, Seelenteile, eudaimonia, Freundschaft, Egoismus, Altruismus, antike Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Aristoteles unter dem Begriff "philia"?
Philia ist der antike griechische Begriff für Freundschaft, der bei Aristoteles weit über das moderne Verständnis hinausgeht und auch soziale sowie ethische Bindungen umfasst.
Wie hängen Selbstliebe und Freundschaft laut der Nikomachischen Ethik zusammen?
Aristoteles vertritt die Ansicht, dass ein Mensch sich selbst ein Freund sein muss, um ein guter Freund für andere sein zu können. Das Selbstverhältnis ist somit die Basis für die Freundschaft zu anderen.
Was ist der Unterschied zwischen guter und schlechter Selbstliebe?
Schlechte Selbstliebe ist purer Egoismus, bei dem man sich materielle Güter sichert. Gute Selbstliebe hingegen strebt nach dem sittlich Schönen und der Tugendhaftigkeit, was letztlich auch der Gemeinschaft nützt.
Welche Rolle spielen die "Seelenteile" in dieser Theorie?
Aristoteles' Konzept des Verhaltens zu sich selbst basiert auf seiner Theorie der Seelenteile, wobei die Vernunft den leitenden Teil übernehmen sollte, um ein tugendhaftes Leben zu ermöglichen.
In welchen Büchern der Nikomachischen Ethik wird dieses Thema behandelt?
Die zentralen Analysen zum Selbstverhältnis und zur Freundschaft finden sich in den Büchern VIII und IX der Nikomachischen Ethik.
- Arbeit zitieren
- Wenzel Seibold (Autor:in), 2008, Selbstverhältnis und Selbstliebe in den Freundschaftsbüchern der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/173709